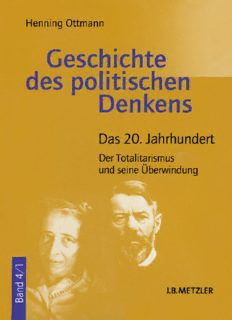Table Of ContentGeschichte des politischen Denkens, Band 4, 1
Henning Ottmann
Geschichte des
politischen Denkens
Von den Anfängen bei den Griechen
bis auf unsere Zeit
J.
Verlag B. Metzler
Stuttgart · Weimar
Henning Ottmann
Geschichte des
politischen Denkens
Band 4: Das 20. Jahrhundert
Teilband 1: Der Totalitarismus
und seine Überwindung
Mit 2 Abbildungen
J.
Verlag B. Metzler
Stuttgart ·Weimar
Der Autor:
Henning Ottmann ist Professor für Politische Wissenschaft an der Universität
München; Mitherausgeber der >>Zeitschrift für Politik<< und des >>Philosophischen
Jahrbuchs<<. Bei J. B. Metzler ist erschienen: >>Nietzsche-Handbuch<<, 2000.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de>
abrufbar.
ISBN 978-3-476-01633-1 ISBN 978-3-476-00023-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-00023-1
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2010 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2010
Vorwort
>>Habet ergo et superbia quendam appetitum unitatis et omnipotentiae,
sed in rerum temporalium principatu, quae omnia transeunt tamquam umbra<<
(Augustinus, De vera religione 45, 84).
Die Geschichte des politischen Denkens schließt mit zwei Teilbänden (4/1; 4/2), die
das politische Denken des 20. Jh.s behandeln. Der vorliegende Band (4/1) ist
hauptsächlich der ersten Hälfte des Jahrhunderts gewidmet. Eine scharfe Tren
nungslinie zwischen der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg wird jedoch
nicht gezogen. Der frühe Feminismus wird im Band 4/2 behandelt im Zusammen
hang mit den aktuellen Varianten der Theorie. Die frühe Frankfurter Schule wird
ebenfalls erst im Band 4/2 zur Sprache gebracht, wo sie zusammen mit der politi
schen Philosophie von Jürgen Habermas dargestellt wird. Der Schlußband wird
darüber hinaus Kapitel über Popper und den Kritischen Rationalismus, das politi
sche Denken der Postmoderne, neuere Utopien, John Rawls, den Kommunitaris
mus u. a.m. enthalten.
Im Mittelpunkt dieses Teilbandes stehen die totalitären Abstürze, wie sie sich in
Rußland, Italien, Deutschland und China vollzogen haben (Kap. III, VI-VII). Be
handelt werden außerdem die Dystopien (Kap. I), Max Weber (Kap. II), die Kon
servative Revolution (Kap. IV), Carl Schmitt (Kap. V) und die sogenannte >>norma
tive<< politische Philosophie (Arendt, Voegelin, Strauss). Sie wird hier aus noch zu
erläuternden Gründen >>neoklassische<< politische Philosophie genannt (Kap. VIII).
Wie schon in den Bänden, die das politische Denken der Neuzeit bis zum Ende
des 19. Jh.s darstellen (3/1-3/3), wird auch in diesem Teilband nicht die These ver
treten, daß die gesamte Entwicklung der Neuzeit in den Totalitarismus mündet.
Eine Totalverurteilung der Neuzeit, in deren gefährliche Nähe manche Neo-Klassi
ker geraten, wird hier nicht vollzogen. Allerdings auch keine Exculpierung, so als
ob die Moderne unschuldig wäre an dem, was in der ersten Hälfte des 20. Jh.s ge
schah. Der Totalitarismus ist ein modernes Phänomen. Er geht aus gewissen Zügen
der Neuzeit und der Moderne hervor. Ein Betriebsunfall ist er nicht. Er läßt sich
auch nicht normalisieren, indem man auf frühere Katastrophen und Gewaltherr
schaften verweist. Er ist in vielerlei Hinsicht unerhört, und er stellt für das politi
sche Denken eine Herausforderung nie gekannter Art dar. Wenn Verstehen, wie es
traditionell heißt, nur möglich ist, wenn man für das Zu-Verstehende Sympathien
empfindet, dann stößt die Hermeneutik im 20.Jh. an ihre Grenzen. Sie müßte >>ver
stehen<<, ohne Verständnis haben zu können.
Was war das 20. Jh.? War es das Jahrhundert der Dystopien? Das Jahrhundert
der Zweckrationalität? Das Jahrhundert der Oktoberrevolution, des Aufstiegs und
Falls des Marxismus-Leninismus? Das Jahrhundert der Konservativen Revolution
und der Auflösung der politischen Fronten? Das Jahrhundert des Ausnahmezu
standes? Das Jahrhundert der Lager? Das Jahrhundert der Chinesischen Revolu-
VI Vorwort
tion, das eine neue Weltmacht geboren hat? Das Jahrhundert, das nach den Kata
strophen um die Wiedergewinnung humaner Maßstäbe gerungen hat?
Alle diese Kennzeichnungen ließen sich vertreten. Sie könnten aber auch den
Eindruck erwecken, als ob das 20. Jh. nichts anderes gewesen wäre als das Jahr
hundert der totalitären Schrecken und des permanent gewordenen »Ausnahmezu
standes<< (Agamben). Vor einer solchen pauschalisierenden Betrachtung ist zu war
nen. Erstens wurden nicht alle Länder der Erde vom Totalitarismus erfaßt.
Zweitens ist das 20. Jh. auch das Jahrhundert, in dem der Totalitarismus überwun
den worden ist. Statt vom Jahrhundert des Totalitarismus zu sprechen, wäre es bes
ser, die Epoche als eine Konkurrenz zwischen Demokratien und Diktaturen zu um
schreiben (Bracher). In diesem Konkurrenzkampf haben die Demokratien gesiegt.
Das kann kein Anlaß zur Beruhigung sein. Die geistigen Erosionen, aus denen der
Totalitarismus entstanden ist, sind mit dem Ende der totalitären Systeme nicht zu
gleich gestorben. Sie sind durchaus noch lebendig. Selbst Spuren des alten Totalita
rismus wird man hier und da noch finden. Am Tiananmenplatz hängt unverändert
das riesige Mao-Porträt. Aus Rußland haben mir Studenten Zigaretten der Marke
>>Belomore<< mitgebracht. Die Zigaretten machen - ein halbes Jahrhundert nach
dem Ende des Stalinismus-Propaganda für den Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals.
Er war ein Prestige-Objekt Stalins, bei dessen Bau täglich ca. 700 Menschen gestor
ben sind. Die Vergangenheit ist nicht vorbei. Sie ist nicht einmal vergangen.
In dieser Geschichte des politischen Denkens treten neben Philosophen, Histori
kern, Juristen, Dichtern etc. immer auch >> welthistorische Individuen<< wie Alexan
der, Caesar oder Napoleon auf. Dies hat einen Kollegen zu der bangen Frage ver
anlaßt, ob denn, wenn es um das 20. Jh. gehe, auch noch Hitler oder Stalin
behandelt werden würden. Die Frage ist meines Erachtens falsch gestellt. Wie soll
man das hellenistische Königtum ohne Alexander erklären? Wie die Entstehung
des Kaisertums ohne Caesar? Wie den modernen Caesarismus ohne Napoleon? Im
20. Jh. verbinden sich die persönlichen Formen der Herrschaft mit den Ideologien.
Auch da läßt sich das eine ohne das andere nicht mehr erklären. Sicher, Hitler ist
kein Platon, Stalin nicht einmal ein Marx. Aber eine philosophische Vornehmheit,
die in die Niederungen der Ideologien nicht blicken will, ist der Geschichte des
20. Jh.s nicht gewachsen. Sie würde eine rein akademische Angelegenheit, wie so
manches, was sich heute Philosophie nennt.
Durch Gespräche und kritische Lektüre ist mir vielfach geholfen worden. Für
wertvolle Hinweise danke ich den stud. rer. pol. Sven Hauberg, Martin Ingenfeld,
Viktoriya Prysyazhna, Johannes M. Rapp, Matthias Schmid, Herrn Dr. Heinrich
Geiger, Frau Dr. Gitta Gess, PD Dr. Dirk Lüddecke, Prof. Dr. Reinhard Mehring,
Stefano Saracino, M. A., Dr. Peter Seyferth, Frau Dr. Sun Lei, Frau Prof. Dr. Bar
bara Zehnpfennig. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Günter Hockerts
und Herrn Dr. Klaus Weber. Verbleibende Irrtümer muß ich selber verantworten.
Für die Schreibarbeiten danke ich den Herren Michael Gaul und Wolf Marx sowie
vor allem Frau Marianne Wischer.
Die Arbeit an diesem Teilband wurde mit Mitteln der Fritz-Thyssen-Stiftung un
terstützt.
München, im Mai 2010
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
I. Dystopien (Wells, Capek, Samjatin, Huxley, Orwell) . 1
1. Herbert George Wells (1866-1946) ......... . 3
1.1. Futurismus, Evolutionstheorie, Religionskritik, Sozialismus. 4
1.2. >>A Modern Utopia<< (1905) oder Wells' Weltordnungsvisionen. 5
1.3. Scientific Romances von »The Time Machine<< (1895)
bis zu »When the Sleeper Wakes<< (1899) 7
1.3.1. »The Time Machine<< (1895) .... 7
1.3.2. »T he Island of Dr. Moreau<< (1896). 9
1.3.3. »The War of the Worlds<< (1898) . 10
1.3.4. »When the Sleeper Wakes<< (1899) 11
2. Karel Capek (1890-1938) .... . 13
2.1. »R. U. R.<< (1921) ......... . 13
2.2. Exkurs: Vom Golem über den Roboter zum Computer 14
2.3. »Krakatit<< (1922) ................... . 15
2.4. »Der Krieg mit den Molchen<< (1936) ......... . 16
3. Jewgeni Samjatin (1884-1937): »Wir<< (»My<<) (1920) 18
4. Aldous Huxley (1894-1963): »Brave New World<< (1932) 23
4.1. »Brave New World<< (1932) . 23
4.2. »>sland<< (1962) .................... . 28
4.3. »Ape and Essence<< (1948) ............... . 29
5. George Orwell (1903-1950): »Animal Farm<< (1945)
und »Nineteen Eighty-Four<< (1949) . 30
5.1. Frühe Jahre engagierter Schriftstellerei 31
5.2. »Animal Farm<< (1945) .... . 33
5.3. »Nineteen Eighty-Four<< (1949) ... . 34
II. Max Weber (1864-1920) oder Standhalten im »Gehäuse
der Hörigkeit« . . . . . . . 46
1. Disziplin und Leidenschaft. 47
2. Weber-Rezeptionen. . . . . 49
3. Das Postulat der Werturteilsfreiheit (1904, 1913, 1917). 53
3.1. Die These ........... . 53
3.2. Was Webers These voraussetzt . . . . . . . . . . . . . . 55
VIII Inhalt
3.3. Einwände. 58
4. Die Herrschaftssoziologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1. Soziologische Kategorien (Soziales Handeln, Sinnverstehen,
methodologischer Individualismus, Bestimmungsgründe
des sozialen Handelns, Idealtypen) . . . . . . 60
4.2. Macht - Herrschaft - Staat . . . . . . . . . . 62
4.3. >>Die drei reinen Typen legitimer Herrschaft<<. 65
5. >>Politik als Beruf<< (1919) .......... . 68
6. Zwischen Führerdemokratie und Parlamentarisierung. 71
7. Die Religionssoziologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.1. >>Die Vorbemerkung<< oder Eigentümlichkeiten der okzidentalen
Rationalisierung (1920) ................... . 74
7.2. >>Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus<<
(1904/05) ........................... . 75
7.3. >>Die Zwischenbetrachtung<< oder Paradoxien der entzauberten
Welt ................................ . 77
111. Politisches Denken in Rußland vor, während und nach
der Oktoberrevolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1. Politische Ideen vor der Revolution (Nihilismus, Volkstümlertum,
Marxismus, Slawophilen- und Westlertum) . . . . . . . . . . 88
2. Nikolai Danilewski (1822-1885) oder Rußland gegen Europa 91
3. Der Mythos der Oktoberrevolution . . . . 93
4. Lenin (1870-1924) ............ . 96
4.1. Vom Erbadligen zum Berufsrevolutionär . 97
4.2. Die Ideologie . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2.1. Abgrenzungen: Volkstümler, Menschewiki, legale Marxisten 99
4.2.2. >>Was tun?<< (1902) ...................... . 100
4.2.3. >>Materialismus und Empiriokritizismus<< (1909) ...... . 101
4.2.4. >>Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus<<
(1916) .......................... . 102
4.2.5. >>Staat und Revolution<< (August-September 1917) .. . 103
4.3. Was aus den Verheißungen von >>Staat und Revolution<<
geworden ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.4. Kritik an der >>Diktatur des Proletariats<< (Kautsky, Luxemburg,
Samjatin, Pasternak) ...................... . 106
5. Avantgarde und Revolution, eine kurze Allianz (Malewitsch,
Lissitzky, Rodtschenko, Tatlin, Blok, Gorki, Bogdanow,
Majakowski) ......................... . 108
6. Stalin (1879-1953) und die totalitäre Schreckensherrschaft. 114
6.1. Die Person .......................... . 115
6.2. >>Über die Grundlagen des Leninismus<< (April-Mai 1924) 117
6.3. >>Die Oktoberrevolution und die Taktik der russischen Kommu-
nisten<< (Dezember 1924). Stalin gegen Trotzki ........ . 118
Inhalt IX
6.4. Die drei Säulen der Hölle . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.4.1. Die »Liquidierung<< der Kulaken und der Holodomor
(1929-1933) ................ . 120
6.4.2. Säuberungen und Schauprozesse (1937/38) ...... . 123
6.4.3. Der Gulag (1919-1986) ................ . 125
6.5. >>Über dialektischen und historischen Materialismus<< (1 9 3 8)
oder Ideologie im Zustand der Versteinerung . . . . . . 128
6.6. Kunst im Zeichen des sozialistischen Realismus . . . . . 130
6.7. Stalinismus. Rechtfertigungen und Erklärungsversuche . 132
IV. Die Konservative Revolution (Arthur Moeller van den Bruck,
Thomas Mann, Oswald Spengler, Ernst Jünger) 143
1. Artbur Moeller van den Bruck (1876-1925) . . 145
2. Thomas Mann (1875-1953). . . . . . . . . . . 150
2.1. »Die Betrachtungen eines Unpolitischen<< (1918) 150
2.2. »Von deutscher Republik<< (1922). 154
2.3. »Der Zauberberg<< (1924) . . . 156
2.4. »Doktor Faustus<< (1947) . . . . . 159
3. Oswald Spengler (1880-1936) . . 166
3.1. Herrischer Ton und existentielle Angst . 166
3.2. »Der Untergang des Abendlandes<< (1918/22) 167
3.3. »Preußentum und Sozialismus<< (1919). . . . 172
3.4. »Jahre der Entscheidung<< (1933) . . . . . . . 174
3.5. Vorläufer und Quellen, Rezeptionen und Kritiken. 176
4. Ernst Jünger (1895-1998). . . . . . . . . . . . . . 180
4.1. >>In Stahlgewittern<< (1920) und »Der Kampf als inneres Erlebnis<<
(1922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4.2. Ȇber Nationalismus und Judenfrage<< (1930). 184
4.3. »Der Arbeiter<< (1932) . . . . . . . . . . . . . . 185
4.4. »Auf den Marmorklippen<< (1939) . . . . . . . 188
4.5. »Der Friede<< (geschrieben 1941-43) und »Der Weltstaat<< (1960) 192
4.6. »Heliopolis<< (1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.7. »Der Waldgang<< (1951). . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.8. »Eumeswil<< (1977) oder Postmoderne und Anarchie 198
V. Carl SchmiH (1888-1995) oder Politisches Denken für alle Fälle. 215
1. Verfemung und Weltkarriere. . . . 215
2. Die vielen Rollen des Carl Schmitt 217
3. Weimarer Jahre (1919-1932) . 226
3.1. »Politische Romantik<< (1919). 227
3.2. »Die Diktatur<< (1921). 228
3.3. Politisch-Theologisches . . . . 229
Description:Die politische Kultur der westlichen Welt in einer breit angelegten Gesamtschau. Von den Griechen und ihrer Entdeckung von Politik und Demokratie, über die Römer und die christliche Welt bis zur Gegenwart, die vom Kampf um Menschenrechte und dem Totalitarismus zugleich gezeichnet ist, wird das gan