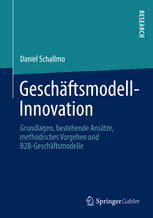Table Of ContentGeschäftsmodell-Innovation
Daniel Schallmo
Geschäftsmodell-Innovation
Grundlagen, bestehende
Ansätze, methodisches Vorgehen
und B2B-Geschäftsmodelle
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Leo Brecht
RESEARCH
Daniel R. A. Schallmo
Ulm, Deutschland
Die Arbeit basiert auf der Dissertation von Daniel Schallmo (Universität Ulm, 2012).
ISBN 978-3-658-00244-2 ISBN 978-3-658-00245-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-00245-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e;
detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufb ar.
Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht aus-
drücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Ein-
speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk be-
rechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürft en.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Gabler ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer
Science+Business Media.
www.springer-gabler.de
v
Geleitwort
Der Geschäftsmodell-Begriff entstand ursprünglich in Zusammenhang mit der Kommerzialisierung
des Intemets. Inzwischen ist der Geschäftsmodell-Begriff sowohl in der Praxis als auch in der Wis
senschaft weit verbreitet. Die Herausforderung liegt jedoch darin, dass sich trotz der Vielfalt an Pub
likationen bisher keine betriebswirtschaftliche Definition in der Fachwelt herauskristallisiert hat. Auch
ist das Vorgehen zur Entwicklung von Geschäftsmodellen im Kontext des Innovationsmanagements
nicht allgemeingültig und spezifisch genug für eine Anwendung im Unternehmen. Im Gegensatz zu
den etablierten Methoden des Stage-Gate-Prozesses der Produktinnovation bzw. Produktentwick
lung oder zu den Methoden des Prozessentwurfs im Rahmen des Business Engineerings ist ein
stringentes, methodisches Vorgehen zur Innovation von Geschäftsmodellen bisher nicht betrachtet
worden. Dabei stellt sich an dieser Stelle nicht die Frage, ob eine Methode im Sinne der Ge
schäftsmodell-Innovation Sinn macht, sondern vielmehr, wie eine stringente Methode nach welchen
Entwicklungsgrundsätzen auszugestalten ist.
Das vorliegende Buch zum Thema Geschäftsmodell-Innovation stellt das Ergebnis eines For
schungsprojektes am Institut für Technologie- und Prozessmanagement der Universität Ulm dar. Es
behandelt einen wichtigen Ansatz, der die Wissenschaft und Praxis in den letzten Jahren sehr stark
beschäftigt hat.
Mit den Ergebnissen des Forschungsprojelds wurden eine wissenschaftliche Einordnung vorge
nommen, gesicherte Erkenntnisse zur Bildung von Gaschäftsmodellen dargelegt, praktische Erfah
rungen integriert sowie die Anwendung der Erkenntnisse sichtbar gemacht.
Herrn Daniel Schallmo ist es gelungen, die Ziele des Forschungsprojelds voll umfänglich zu erfüllen
und mit dem Buch einen wertvollen Beitrag für Theorie und Praxis zu leisten. Für diese Arbeit, ge
tragen von Motivation, Ehrgeiz, Fachkompetenz und Flexibilität, gebührt großer, verbindlicher Dank.
Dem Buch wünsche ich eine breite, interessierte Leserschaft, die aufgrund der Lektüre und damit
der fachlichen Auseinandersetzung mit dem wichtigen Thema wertvolle Anregungen und Einsichten
gewinnt.
Prof. Dr. Leo Brecht
VII
Vorwort
Für Unternehmen wird es immer schwieriger, sich gegenüber ihren Wettbewerbem mit Produkt-,
Dienstleistungs- und Prozess-Innovationen zu differenzieren. Der Grund für diese schwierige Diffe
renzierung ist eine schnelle und einfache Imitierbarkeit von Produkten, Dienstleistungen und Pro
zessen.
In den letzten Jahren hat die Geschäflsmodell-Innovation in Theorie und Praxis eine hohe Aufrnerik
samkeit erlangt. Ein Geschäflsmodell orientiert sich an Kundenbedürfnissen, kombiniert unter
schiedliche Elemente eines Untemehmens und stiftet somit einen Kundennutzen. Ein Ge
schäflsmodell ist häufig schwerer imitierbar als Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse und
ermöglicht es einem Unternehmen, sich besser gegenüber seinen Wettbewerbern zu differenzieren.
Bisher liegen in der Literatur einige Ansätze für die Geschäflsmodell-Innovation vor, die sich aller
dings voneinander unterscheiden. Eine übersicht zu diesen Ansätzen fehlt bislang; ein Ansatz, der
alle Aspekte einer Methode berücksichtigt, fehlt ebenso. Analog zu den vorliegenden Ansätzen lie
gen generische Geschäflsmodelle vor, die allerdings die Business-tD-Business-Märkte starik ver
nachlässigen.
Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Methode der Geschäflsmodell-Innovation zu entwickeln, die es er
möglicht, kunden-, zukunfls- und technologieorientierte Geschäflsmodelle zu erarbeiten. Ein weite
res Ziel ist, generische Geschäflsmodelle für Business-to-Business-Märkte zu entwickeln.
Die Methode der Geschäflsmodell-Innovation ist allgemeingültig und bietet Untemehmen die Chan
ce, innovative und untemehmensspezifische Lösungen zu erarbeiten. Diese Lösungen ermöglichen
es Unternehmen, sich gegenüber ihren Wettbewerbern zu differenzieren und den Fortbestand ihres
Unternehmens abzusichern.
An dieser Stelle danke ich allen Freunden und Begleitern, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetra
gen haben. Prof. Dr. Leo Brecht, Leiter des Instituts für Technologie- und Prozessmanagement,
danke ich besonders für die wissenschaftliche Betreuung, die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen
und das praxisnahe Forschungsumfeld am Institut. Prof. Dr. Dieter Beschorner danke ich für die hilf
reichen Gespräche und wertvollen Anregungen. Folgenden Forscherkollegen und Autoren danke
ich für ihre Anregungen: Dr. Michael Blum (Toll Collee! GmbH), Dr. Oliver Grasl (transentis mana
gement consulting GmbH & Co. KG, Wiesbaden), Kati Järvi (Lappeenranta University of TechnoIo
gy, Kouvola, Finnland), Marik Johnson (Innosight, Lexington, USA), Dr. Alexander Osterwalder (Bu
siness Model Faundry GmbH, Zürich, Schweiz), Ingo Rauth (Chalmers University of Technology,
Göteborg, Schweden), Stephan Reinhold (Universität SI. Gallen, Schweiz), Andreas Rusnjak (Chris
tian-Albrechts-Universität zu Kiel), Tania Salarvand (Valeocon Management Consulting, New YOrik,
USA), Dr. Teemu Santonen (Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finnland), Dr. Patrick
Stähler (fluidminds GmbH, Zürich, Schweiz), Prof. Dr. David Teece (University of California, Berike-
VIII
ley, USA) und Nico Weiner (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, SluIt
gart).
Mein Dank gilt ebenfalls folgenden Untemehmen und deren Vertretem, die durch ihre engagierte
Teilnahme am CE VeMaB zu einer anwendungsorientierten Lösung beigetragen haben: Festo AG &
Co. KG (Stefan Abele, Markus Oll), MBtech Group GmbH & Co. KGaA (Marc Bayer, Jöm Ehlers,
Simone Kehr, Thorsten Reichle) und Voith GmbH (Roland Aeugle, Winfried Dressler, Barbara
Kampmeier, Bellina Monljoie, Heinz Tengler, Christoph Uhl).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit waren einige wissenschaftliche Arbeiten eingebunden, die mir
wichtige Anregungen gegeben haben. Diese wissenschaftliche Arbeiten entstanden z.T. in Koopera
tion mit Untemehmen und in enger Zusammenarbeit mitlnsa Müller, Janina Leimbach und Lin Rich
ter.
Meinen KOlleginnen und KOllegen, Simon Elsner, Barbara Graf, Melanie Hiller, Florian Kuffer, Birgit
Stelzer, Michael Schad, Andre Seemann, Oliver SinnweIl und Stephan Traa, danke ich für ihre
freundschaftliche Zusammenarbeit im Team und die zahlreichen Anregungen.
Meinen Freunden Bernd Benteie, Dr. Friederike Blicke, Christian Glaser, Tobias Gölz, Jens KOlb,
Thomas Limberg, Daniel Torka, Marco Wahlen und Thomas Weifen bach danke ich ebenfalls für hilf
reiche Anregungen.
Von ganzem Herzen danke ich meiner Familie, insbesondere meinen Eltern, ohne die diese Arbeit
nicht möglich gewesen wäre. Meiner Partnerin Marina Bauemfeind danke ich ganz besonders für ihr
Verständnis, ihre Unterstülzung und ihre Geduld, die sie während des Verfassens der Arbeit aufge
bracht haI.
Daniel RA Schallmo
IX
Inhaltsübersicht
1 Einführung .................................................................................................................................. 1
1.1 Ausgangssituation und Handlungsbedarf .......................................................................... 1
1.2 Forschungsziel und Forschungsfragen .............................................................................. 4
1.3 Forschungsansatz und Forschungsprozess ...................................................................... 5
1.4 Ergebnisse und Adressalen der Arbeil ............................................................................ 13
1.5 Aufbau der Arbei!... .......................................................................................................... 15
2 Theoretische Grundlagen ........................................................................................................ 17
2.1 Business-to-Business-Markt ............................................................................................ 17
2.2 Geschäftsmodell .............................................................................................................. 19
2.3 Geschäftsmodell-Innovation ............................................................................................ 23
2.4 Geschäftsmodell-Ebenen ................................................................................................ 29
2.5 Geschäftsmodell-Umwell ................................................................................................. 33
2.6 Charakterislika und Einordnung ...................................................................................... 38
2.7 Zusammenfassung ......................................................................................................... .45
3 Ansätze der Geschäftsmodell-Entwicklung ........................................................................... 47
3.1 Beschreibungsraster für die bestehenden Ansätze ......................................................... 47
3.2 Ansatz von Bieger und Reinhold ..................................................................................... 49
3.3 Ansatz von Boullon el al. ................................................................................................. 53
3.4 Ansatz von Bucherer ....................................................................................................... 56
3.5 Ansatz von Chesbrough .................................................................................................. 59
3.6 Ansatz von Giesen el al. .................................................................................................. 62
3.7 Ansatz von Grasi ............................................................................................................. 64
3.8 Ansatz von Hamel.. .......................................................................................................... 67
3.9 Ansatz von Johnson ........................................................................................................ 70
3.10 Ansatz von Linder und Canlrell. ....................................................................................... 74
3.11 Ansatz von Lindgarth el al ............................................................................................... 77
3.12 Ansatz von Milchel und Coles ......................................................................................... 79
3.13 Ansatz von Osterwalder el al. .......................................................................................... 81
3.14 Ansatz von Osterwalder und Pigneur .............................................................................. 85
3.15 Ansatz von Papakiriakopoulos el al. ................................................................................ 90
3.16 Ansatz von Teece ............................................................................................................ 92
3.17 Ansatz von Voelpel el al .................................................................................................. 94
3.18 Ansatz von Weiner et al. .................................................................................................. 97
3.19 Ansatz von Wirtz .............................................................................................................. 99
3.20 Ansatz von Zoll und Ami!... ............................................................................................ 104
3.21 Vergleich der Ansätze .................................................................................................... 106
3.22 Weilere Ansätze ............................................................................................................ 110
3.23 Zusammenfassung ........................................................................................................ 113
4 Methode der Geschäftsmodell-Innovatlon ........................................................................... 115
4.1 Anforderungen an eine Methode der Geschäftsmodell-Innovalion ................................ 115
4.2 Metamodell der Geschäftsmodell-Innovation ................................................................. 117
4.3 Vorgehensmodell der Geschäftsmodell-Innovalion ....................................................... 138
4.4 Techniken und Ergebnisse der Geschäftsmodell-Innovation ......................................... 155
x
4.5 Zusammenfassung ........................................................................................................ 246
5 Gaschäftsmodalla In Buslnass-Io-Buslnass-Märktan ........................................................ 247
5.1 Vorgehen für die Erarbeitung generischer Geschäflsmodelle ....................................... 247
5.2 Anwendung des Vorgehens .......................................................................................... 251
5.3 Zusammenfassung ........................................................................................................ 273
6 Fazit und Ausblick ................................................................................................................. 275
6.1 Zusammenfassung ........................................................................................................ 275
6.2 Kritische Würdigung ...................................................................................................... 275
6.3 Ausblick ......................................................................................................................... 276
XI
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort ......................................................................................................................................... V
Vorwort ........................................................................................................................................... VII
Inhaltsüb.rsicht.. ............................................................................................................................ IX
Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................................... XI
Abblldung.verzelchnl. ............................................................................................................... XVII
Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................... XXI
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. XXIII
1 Einführung .................................................................................................................................. 1
1.1 Au.gangs.ituation und Handlung.bedarf .................................................................... 1
1.2 Forschungsziel und Forschungsfragen ........................................................................ 4
1.2.1 Forschungsziel .............................................................................................................. 4
1.2.2 Forschungsfragen ......................................................................................................... 4
1.3 Forschung.ansatz und Forschung.proze.s ................................................................ 5
1.3.1 Forschungsansatz ......................................................................................................... 6
1.3.1.1 Eingesetzte Forschungsmethoden .......................................................................... 6
1.3.1.2 Empirisch gesteuerter Forschungsansatz ............................................................... 7
1.3.1.3 CE VeMaB ............................................................................................................. 10
1.3.2 Forschungsprozess der Arbeit. .................................................................................... 12
1.4 Ergebnisse und Adressaten der Arbeit ....................................................................... 13
1.4.1 Ergebnisse der Arbeit .................................................................................................. 13
1.4.2 Adressaten der Arbeit. ................................................................................................. 14
1.5 Aufbau der Arbeit .......................................................................................................... 15
2 Theoretische Grundlagen ........................................................................................................ 17
2.1 Business·to·Bu.iness·Markl ........................................................................................ 17
2.1.1 Bestehende Definitionen ............................................................................................. 17
2.1.2 Definition des Begriffs Business·to·Business·Markl .................................................... 18
2.2 Ge.chäftsmodell ............................................................................................................ 19
2.2.1 Bestehende Definitionen ............................................................................................. 19
2.2.2 Definition des Begriffs Geschäftsmodell ...................................................................... 22
2.3 Geschäftsmodell·lnnovation ........................................................................................ 23
2.3.1 Begriff der Innovation .................................................................................................. 23
2.3.1.1 Ergebnisorientierte Sichtweise .............................................................................. 23
2.3.1.2 Prozessorientierte Sichtweise ............................................................................... 25
2.3.2 Bestehende Definitionen ............................................................................................. 26
2.3.3 Definition des Begriffs Geschäftsmodell·lnnovation .................................................... 28
2.4 Geschäftsmodell·Ebenen .............................................................................................. 29
2.4.1 Bestehende Ansätze ................................................................................................... 30
2.4.2 Ansatz der Geschäftsmodell·Ebenen .......................................................................... 31
2.5 Geschäftsmodell·Umwelt .............................................................................................. 33
2.5.1 Bestehende Ansätze ................................................................................................... 33
2.5.2 Ansatz der Geschäftsmodell·Umwelt. .......................................................................... 35
2.6 Charakteristika und Einordnung .................................................................................. 38
XII
2.6.1 Charakteristika von Geschäflsmodellen ...................................................................... 38
2.6.2 Einordnung des Geschäflsmodells .............................................................................. 40
2.6.2.1 Geschäflsmodell und Strategie ............................................................................. 40
2.6.2.2 Parallelen des Geschäflsmodells zu anderen Konzepten ..................................... 45
2.7 Zusammenfassung ........................................................................................................ 45
3 Ansätze der Geschäftsmodell.Enlwicklung. .......................................................................... 47
3.1 Beschreibungsraster für die bastehenden Ansätze ................................................... 47
3.2 Ansatz von Bieger und Reinhold ................................................................................. 49
3.3 Ansatz von Boulton et al ............................................................................................... 53
3.4 Ansatz von Bucherer .................................................................................................... 58
3.5 Ansatz von Chasbrough ............................................................................................... 59
3.8 Ansatz von Giesen et al. ............................................................................................... 82
3.7 Ansatz von Grasi ........................................................................................................... 64
3.8 Ansatz von Hamel ......................................................................................................... 67
3.9 Ansatz von Johnson ..................................................................................................... 70
3.10 Ansatz von Llndar und Cantrell ................................................................................... 74
3.11 Ansatz von Lindgarth et al ............................................................................................ 77
3.12 Ansatz von Mllchel und Coles ...................................................................................... 79
3.13 Ansatz von Osterwalder et al ....................................................................................... 81
3.14 Ansatz von Osterwalder und Pigneur. ......................................................................... 85
3.15 Ansatz von Papakiriakopoulos et al ............................................................................ 90
3.16 Ansatz von Teece .......................................................................................................... 92
3.17 Ansatz von Voelpel et al ............................................................................................... 94
3.18 Ansatz von Weiner et al ................................................................................................ 97
3.19 Ansatz von Wlrtz ........................................................................................................... 99
3.20 Ansatz von Zoll und Amit ........................................................................................... 104
3.21 Vergleich der Ansätze ................................................................................................. 106
3.22 Weitere Ansätze ........................................................................................................... 110
3.23 Zusammenfassung ...................................................................................................... 113
4 Methode der Geschäftsmodell·lnnovation ........................................................................... 115
4.1 Anforderungen an eine Methode der Geschäftsmodell ... nnovation ........................ 115
4.2 Matamodell dar Gaschäftamodall·lnnovation ........................................................... 117
4.2.1 Ansatz mit Geschäflsmodell·Dimensionen und ·Elementen ..................................... 117
4.2.2 Metamodell und Erläuterung der Objekte der Methode ............................................. 124
4.2.2.1 Geschäflsmodell·Vision ...................................................................................... 125
4.2.2.2 Kundendimension ............................................................................................... 126
4.2.2.3 Nutzendimension ................................................................................................ 128
4.2.2.4 Wertschöpfungsdimension .................................................................................. 130
4.2.2.5 Partnerdimension ................................................................................................ 132
4.2.2.6 Finanzdimension ................................................................................................. 134
4.2.2.7 Geschäflsmodell·Führung ................................................................................... 135
4.2.3 Schnittstellen des Metamodells der Geschäflsmodell·lnnovation ............................. 136
4.2.4 Zusammenfassung .................................................................................................... 138
4.3 Vorgehensmodell der Geschäftamodell·lnnovation ................................................. 138
4.3.1 überblick zum Vorgehensmodell der Geschäflsmodell·lnnovation ........................... 138