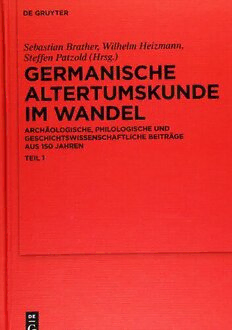Table Of ContentGermanischeAltertumskundeimWandel
Ergänzungsbände zum
Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde
Herausgegeben von
Sebastian Brather, Wilhelm Heizmann
und Steffen Patzold
Band 100/1
Germanische
Altertumskunde
im Wandel
Archäologische, philologische und
geschichtswissenschaftliche Beiträge aus 150 Jahren
Herausgegeben von
Sebastian Brather, Wilhelm Heizmann
und Steffen Patzold
Teil 1: Einleitung, archäologische und
geschichtswissenschaftliche Beiträge
ISBN978-3-11-056185-2
e-ISBN(PDF)978-3-11-056306-1
e-ISBN(EPUB)978-3-11-056197-5
ISSN1866-7678
LibraryofCongressControlNumber:2020947328
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschenNationalbibliografie;
detailliertebibliografischeDatensindimInternetunterhttp://dnb.dnb.deabrufbar.
©2021WalterdeGruyterGmbH,Berlin/Boston
Satz:IntegraSoftwareServicesPvt.Ltd.
DruckundBindung:CPIbooksGmbH,Leck
www.degruyter.com
Inhaltsverzeichnis
SebastianBrather,WilhelmHeizmannundSteffenPatzold
‚GermanischeAltertumskunde‘imRückblick.Einführung 1
ZurEinrichtungderTexte 37
I Etablierung(ca.1850 bis1900)
GeorgWaitz
ZurDeutschenVerfassungsgeschichte(1845) 41
Kommentar 70
LudwigLindenschmitundWilhelmLindenschmit
ZeitbestimmungunsererAlterthümer(1848) 75
Kommentar 85
II Verfestigung(um 1900)
GustafKossinna
DievorgeschichtlicheAusbreitungderGermaneninDeutschland(1895) 91
Kommentar 104
IIINeuansätze undihr Fortwirken(1930erbis1950erJahre)
HansZeiß
DiegeschichtlicheBedeutungderVölkerwanderungskunst(1937) 111
Kommentar 122
HeinrichDannenbauer
Adel,BurgundHerrschaftbeidenGermanen.Grundlagenderdeutschen
Verfassungsentwicklung(1941) 127
Kommentar 174
WalterSchlesinger
HerrschaftundGefolgschaftindergermanisch-deutschen
Verfassungsgeschichte(1953) 179
Kommentar 221
VI Inhaltsverzeichnis
IVNeueAkzente(1970erund1980erJahre)
ReinhardWenskus
Einleitungzu:StammesbildungundVerfassung.DasWerdender
frühmittelalterlichengentes(1961) 227
Kommentar 239
HeikoSteuer
FrühgeschichtlicheSozialstruktureninMitteleuropa.ZurAnalyseder
AuswertungsmethodendesarchäologischenQuellenmaterials(1979) 243
Kommentar 281
VNeuausrichtungen (1990–2010)
WalterPohl
VomNutzendesGermanenbegriffeszwischenAntikeundMittelalter:eine
forschungsgeschichtlichePerspektive(2004) 287
Kommentar 304
JörgJarnut
Germanisch.PlädoyerfürdieAbschaffungeinesobsoletenZentralbegriffes
derFrühmittelalterforschung(2006) 307
Kommentar 316
HubertFehr
GermanischeEinwanderungoderkulturelleNeuorientierung?Zuden
AnfängendesReihengräberhorizontes(2008) 319
Kommentar 351
PhilippvonRummel
TheFadingPowerofImages.Romans,Barbarians,andtheUsesofa
DichotomyinEarlyMedievalArchaeology(2013) 355
Kommentar 393
NachweisderOriginalpublikationen 397
Sebastian Brather,Wilhelm HeizmannundSteffen Patzold
‚ ‘
Germanische Altertumskunde im Rückblick.
Einführung
Vorspann
WasderBegriff‚germanisch‘bezeichnetundwelcheVorstellungensichmitGerma-
nenverbinden,dashatsichimmerwiederverändert.UmdieMittedes19.Jahrhun-
dertsbegannendiedeutschePhilologie,dieGeschichteunddieArchäologiegerade
erst,sichalswissenschaftlicheDisziplinenimheutigenSinnezuetablieren.Biszur
Wende zum20.Jahrhundert aberwarendannschonetlichejenerInstitutionen ge-
gründet,dienochbisheutefürdieFächervonBedeutungsind.Esentstandennicht
nur spezialisierte Lehrstühle und Universitätsinstitute für die Geschichte und die
PhilologiendesMittelalters,sondernauchdieverschiedenenHistorischenKommis-
sionen, auf Dauer angelegte Großunternehmen wie die „Monumenta Germaniae
Historica“ (ab1826), die „Regesta Imperii“ (ab1839) oder das „GrimmscheWörter-
buch“ (ab 1854), Institutionen wie das Römisch-Germanische Zentralmuseum in
Mainz (1852) oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg (1852), zentrale
Publikationsorgane wie die „Zeitschrift für deutsches Altherthum“ (ab 1841), die
„Historische Zeitschrift“ (ab 1859), die „Zeitschrift für deutsche Philologie“ (ab
1869),außerdemdiverseHandbücherundFachlexika.
AlseinenTeildiesesInstitutionalisierungsprozesseskannmanauchden„Hoops“
begreifen, der in den Jahren 1911 bis 1919 erschien:1 jenes umfassende „Reallexikon
derGermanischenAltertumskunde“,dasab1968ineinerzweitenAuflageüberarbei-
tet wurde2 und seit 2011, nunmehr elektronisch, als „Germanische Altertumskunde
Online“ stetig aktualisiert und ergänzt wird.3 Seit 1986 wird das Reallexikon zudem
voneinerBuchreihebegleitet:Diese„Ergänzungsbände“bietenvorallemRaum,um
spezifischeEinzelthemendesFeldesinMonographienoderSammelbändenabzuhan-
deln.ImmerwiedersindinErgänzungsbändenaberauchderZuschnitt,dieAusrich-
tungunddieGrenzenderGermanischenAltertumskundeselbstdiskutiertworden.
Das vorliegende Buch bildet nun den 100. Band dieser Reihe. Wir möchten
den Anlass nutzen, um im historischen Rückblick zumindest einen kleinen Aus-
schnitt aus der langen Geschichte der Germanischen Altertumskunde seit Mitte
des 19. Jahrhunderts anschaulich zu machen – und damit zugleich beizutragen
1 Reallexikon der germanischen Altertumskunde, unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten
hrsg.JohannesHoops,Bd.1–4(Straßburg1913–1919).
2 ReallexikonderGermanischenAltertumskunde,begründetvonJohannesHoops,2.,völligneubear-
beiteteundstarkerweiterteAuflage,Bd.1–35sowie2Registerbände(Berlin,NewYork1968–2008).
3 Vgl.https://www.degruyter.com/view/db/gao
https://doi.org/10.1515/9783110563061-001
2 SebastianBrather,WilhelmHeizmannundSteffenPatzold
zur aktuellen Diskussion über die Inhalte und den Zuschnitt dieses Feldes insge-
samt. Wir haben dafür philologische, geschichtswissenschaftliche und archäolo-
gische Beiträge aus rund 150 Jahren Forschungsgeschichte ausgewählt, die wir
hier erneut abdrucken. In kurzen Kommentaren verorten wir diese Beiträge je-
weils in ihrem historischen Kontext und umreißen ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung des Forschungsfeldes. Was wir damit bieten, ist von vornherein nicht
als umfassendes Kompendium gedacht: Kein einzelnes Buch dieser Art kann für
sich in Anspruch nehmen, die Fülle der internationalen Forschungen aus rund
eineinhalbJahrhundertenwissenschaftlicherArbeitangemessenabzubilden.Uns
war es jedoch wichtig, nicht nur die aktuelle, sehr internationale Diskussion zu
bündeln,sondernweitins19.Jahrhunderthineinzurückzublicken.DenneinGut-
teil auch noch der jüngeren Debatten kreist um Annahmen, die schon sehr früh,
teilsschon im Zuge der Verwissenschaftlichung der beteiligten Disziplinen selbst
kanonisiert worden sind – und wohl gerade deshalb auch so erstaunlich lange
habenwirkmächtigbleibenkönnen.
Statt ein auf Vollständigkeit ausgerichtetes Handbuch der Geschichte der Alter-
tumskunde bieten wir also nur Schlaglichter auf einen langen und komplexen For-
schungsprozess.ManchederhierwiederabgedrucktenBeiträgewirdmanzweifellosals
Meilensteine der Germanischen Altertumskunde bezeichnen dürfen; sie sind immer
wieder zitiert worden und füllen noch immer die wissenschaftlichen Apparate ein-
schlägiger Publikationen. Andere Beiträge sind dagegen mittlerweile fast vergessen.
SiebildenjedochZeittypischesab,daszunächstdurchauswichtigwar,auchwennes
heutekaummehreineRollespielt.BeiderAuswahlhabenwirunsvorallemeineharte
Grenzegesetzt:DerBandbeschränktsichaufdiedeutschsprachigeForschung.Selbst-
verständlichistdieDiskussionüberGermanenundihreKulturschonfrühauchinter-
nationalgeführtworden.Dochistder RaumeineseinzelnenBandesbeschränkt, und
es erschien uns wichtiger, das hohe Alter und die erstaunliche Wirkmacht mancher
Grundannahmendes19.JahrhundertsinnerhalbderdeutschsprachigenForschungan-
schaulich zu machen. Wir haben deshalb Beiträge ausgewählt, die miteinander in
einergewissenBeziehungstehen–undgarnichterstversucht,dieVielstimmigkeitder
internationalenForschunganzudeuten,dieineinemsolchenRahmenohnehinnurin
Ansätzenabzubildengewesenwäre.DassdieAuswahlsubjektivist,dasssichauchan-
dereAkzentehättensetzenlassen,dassdieFülleder ForschungindiesemBuchbes-
tenfallsangedeutetist–alldasgestehenwirvonvornhereinein.
Dennoch hoffen wir, dass der Band nicht ohne Nutzen sein wird. Er kannStu-
dierenden und Doktoranden helfen, sich einen ersten Eindruck von wesentlichen
EtappeninderErforschungjenerGesellschaftenzuverschaffen,diemanim19.Jahr-
hundert wie selbstverständlich als ‚Germanen‘ bezeichnete. Da die Forschung in
diesemFeldaberschonseitihrenAnfängenebensointerdisziplinärausgerichtetgewe-
senistwieder„Hoops“inseinendreiAuflagen,sindwiroptimistisch,dassdieZusam-
menschau von philologischen, archäologischen und geschichtswissenschaftlichen
‚GermanischeAltertumskunde‘imRückblick.Einführung 3
Forschungsbeiträgen aus 150 Jahren auch für manchen Kenner noch interessante
Einsichtenbereithaltenkann.
Für die Struktur des Bandes haben wir fünf Zeitschnitte gesetzt und uns be-
müht,ausallendreiDisziplinenjeweilseinenparadigmatischen(oderdochzumin-
dest zeittypischen) Beitrag zusammenzustellen. Allein aus Gründen des Umfangs
und der Arbeitsorganisation finden sich die – besonders eng aufeinander bezoge-
nen – archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Beiträge in einem ersten
Teilband, die philologischen in einem zweiten. Den ersten Schnitt haben wir um
dieMittedes19.Jahrhundertsangesetzt,alsdieEtablierungder‚GermanischenAl-
tertumskunde‘ als wissenschaftliches Feld gerade erst begann. Einen zweiten Zeit-
schnitt stellen die Jahre um 1900 dar; damals waren viele Thesen und Annahmen
bereitskanonisiertundkonntensichdahernuningroßenHandbüchernundFach-
lexika zu disziplinärem Grundwissen verfestigen. Die 1930er/1940er Jahre bildeten
danneineZeit,indersichunterdenBedingungendernationalsozialistischenHerr-
schaft in Deutschland ein Paradigmenwechsel vollzog, unter dessen Oberfläche
freilichmancheKernannahmendes19. Jahrhundertskraftvollweiterwirkten. Wäh-
rend das Jahr 1945 wissenschaftlich in diesem Feld kaum einen Einschnitt bedeu-
tete und die Leitperspektiven der 1930er/1940er Jahre zunächst ohne tiefen Bruch
weiterbestanden, lässt sich seit den 1960er Jahren erneut ein Wandel beobachten.
Nunwurde,wennauchanDiskussionender1930erJahreanknüpfend,dieExistenz
germanischer Stämme und Völker nicht mehr als immer schon gegeben vorausge-
setzt, sondern deren Werden und Wandel unter dem Begriff der ‚Ethnogenese‘ er-
forscht.UnserletzterZeitschnittschließlichführtbisindiejüngsteVergangenheit:
AuchhierhabenwirbewusstkeineganzaktuellenForschungsbeiträgeversammelt,
bilden aber dochTeile jener Diskussion ab, die um2000 dazuführte, dassder Be-
griffdes‚Germanischen‘selbst–jedenfallsalsanalytischerBegriffderForschung–
injeeigenerWeiseinArchäologieundGeschichtswissenschaftfragwürdigwurde.
Wirhoffen,dassdasBuchmithilfedieserZeitschnittedieWirksamkeitmancher
GrundfragenundVorannahmeninallendreiDisziplinensichtbarmachenkann,zu-
gleich aber auchfächerübergreifende Rezeptionsprozesse und Phasenverschiebun-
gen veranschaulicht, bis hin zu Brüchen, Spannungen und Missverständnissen im
interdisziplinären Austausch. Um die historische Kontextualisierung wie auch den
VergleichdereinzelnenBeiträgezuerleichtern,stellenwirimFolgendendieeinzelnen
Zeitschnittenochetwasausführlichervor.
I.Etablierung(ca. 1850bis1900)
AlssichumdieMittedes19.JahrhundertsdieGeschichtealswissenschaftlicheDis-
ziplin im heutigen Sinne zu etablieren begann, hatten die Vertreter des jungen
Fachsmeist(auch)Jurastudiert.DasInteressederHistorikerwaraufdieGeschichte
desRechts,derVerfassungundderpolitischenStrukturengerichtet.MitdemBlick