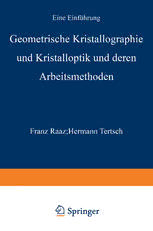Table Of ContentGeometrische Kristallographie
und Kristalloptik
und deren Arbeitsmethoden
Eine Einführung von
Prof. Dr. Franz Raaz und Prof. Dr. Hermann Tertsch
Wien Wien
Zweite, verbesserte Auflage
Mit 260 Textabbildungen
Springer-Verlag Wien GmbH
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten
Copyright 1939 and 1951 by Springer-Verlag Wien
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag in Vienna 1951
Softcover reprint of the hardcover 2nd edition 1951
ISBN 978-3-7091-3473-3 ISBN 978-3-7091-3472-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-7091-3472-6
Dem Andenken
Friedrich Becke's
gewidmet
Vorwort zur 1. Auflage.
Langjährige Beobachtungen bei Abhaltung mineralogischer Übungen
im Hochschulbetrieb ließen die Verfasser zu der Überzeugung kommen,
daß es an einem modernen Lehrbehelf mangle, der zur Einführung gerade
in die praktische Arbeit dienen könnte. Die verschiedenen Lehrbücher,
die in den letzten Jahren erschienen und zum Teil in ganz hervorragender
Weise der Einführung in das theoretisch-mineralogische Wissen dienlich
sind, können aus raumtechnischen Gründen nicht auch noch ausreichende
Winke zur praktischen Handhabung geben. Die großen Handbücher
aber, die im besonderen der Darstellung der Arbeitsweisen gewidmet
sind, schrecken den Anfänger, der seine ersten tastenden Versuche macht,
durch ihren Umfang und die dabei unvermeidlich in die Breite gehende
Darstellungsweise ab.
Die Verfasser legen nun hier einen Versuch vor, dem Bedürfnis nach
einem solchen Lehrbehelf nachzukommen, der neben der knappen Dar
stellung der theoretischen Grundlagen auch noch praktische Hinweise
auf die Verwertung dieser Grundlagen enthält. Sie glauben damit auch
das Wagnis rechtfertigen zu können, neben den bestehenden, vielfach
ausgezeichneten und bewährten Büchern über kristallographische und
kristalloptische Fragen noch einen weiteren Darstellungsversuch heraus
zugeben.
Die Verfasser sind sich dessen voll bewußt, daß dabei noch viele Wün
sche offen bleiben und daß sie mit der vorliegenden Arbeit die großen
Handbücher in keiner Weise zu ersetzen vermöchten. Es soll deren
Studium nur erleichtert werden, und zwar dadurch, daß hier einmal die
wesentlichsten Grundlagen und Methoden kurz dargestellt werden und
dann durch fortlaufende Bezugnahme auf besonders ausgewählte, aus
führliche Handbücher ersichtlich gemacht wird, wo der Leser gründlichere
und weitergehende Unterweisung finden kann.
Mit diesem einführenden Lehrbehelf glauben die Verfasser auch jenen
Kreisen zu dienen, für die mineralogische Fragen und Arbeitsweisen
nur im Sinne einer Hilfswissenschaft von Bedeutung sind, wie das vielfach
bei den Studien und Arbeiten der Physiker, Ohemiker und Pharmazeuten
der Fall ist.
VI Vorwort.
Es ist uns eine angenehme Pflicht, dem Verlage Julius Springer für
das weitgehende Entgegenkommen, das wir bei der Herausgabe dieses
Einführungsbüchleins fanden, herzliehst zu danken.
Mag das Büchlein allen jenen, die auf dem schwierigen, aber so überaus
reizvollen Gebiet der Kristallographie und Kristalloptik eine erste prak
tische Übersicht anstreben, ein brauchbarer Behelf werden.
Wien, im Juni 1939.
F. RAAZ, H. TERTSCH.
Vorwort zur 2. Auflage.
Die notwendig gewordene zweite Auflage ist im Wesentlichen ein
Nachdruck der ersten, wobei - durch die Art des Herstellungsver
fahrens bedingt - nur an wenigen Stellen kleine Verbesserungen vor
genommen werden konnten. Weitergehende Änderungen schienen auch
nicht unbedingt erforderlich zu sein, denn die freundliche Aufnahme
des Buches in Leserkreisen ließ bei den Verfassern die Überzeugung
entstehen, daß sie hinsichtlich der Darbietung des Stoffes den rich
tigen Weg eingeschlagen hatten. Trotzdem wäre es unser Wunsch ge
wesen, da und dort gewisse Ergänzungen vorzunehmen, so beispiels
weise im kristallographischen Teil eine Erläuterung der SCHOENFLIEsschen
Symbole, die bisher nur in der Tabelle I den Projektionsschemas der
32 Kristallklassen einfach beigesetzt wurden. Die Verwendung der
HERMANN-MAuGUINschen Symbolik jedoch liegt außerhalb des Rahmens
dieses als Einführung in die Grundlagen des Faches gedachten Lehr
behelfes.
Wien, im Dezember 1950. Die Verfasser.
Inhaltsverzeichnis.
A. Kristallographie.
Von Dr. FRANZ RAAZ.
Seite
Einleitung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
1. Die kristallographischen Grundgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a) Gesetz von der Konstanz der Flächenwinkel ........ " . . . . 4
Anlegegoniometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
b) Das Symmetrieprinzip in der Kristallwelt ................ 6
c) Das Parametergesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Achsenkreuz und Parametergesetz ..................... 7
2. Charakterisierung der Flächenarten .................... 10
3. Erklärung des Parametergesetzes aus dem Peinb au der
Kristalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
4. Indizierungsmethoden................................. 13
MILLERsche Indices .................................. 14
d) Das Zonengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Das Zonensymbol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
Die Zonenregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
e) Kristallmessung mittels Reflexionsgoniometers . . . . . . . . . . . .. 20
1. Prinzip des einkrei~igen Reflexionsgoniometers . . . . . . . . .. 20
2. Das einkreisige Goniometer ........................... 21
3. Das zweikreisige Reflexionsgoniometer. Sphärische Koordi-
naten rp und e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
II. Methoden der graphischen Darstellung der Kristalle.. . . . . . . .. 23
a) Bildhafte Darstellung (Parallelperspektive) ................ 23
b) Schematische Darstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
1. Stereographische Projektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
2. Gnomonische Projektion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
3. Als Beispiel: Schwefelkristall in stereographischer und
gnomonischer Projektion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
c) Konstruktion des Achsenverhältnisses bei Kristallen mit
rechtwinkeligem Achsenkreuz ............................ 29
TII. Die Grundaufgaben der stereographischen Projektion ......... 31
a) Konstruktive Durchführung (mittels Zirkel und Lineal) .... 31
b) Die Anwendung des WULFFschen Netzes.. .. . . .. . .. .. . .. .. 34
IV. Die Symmetriegesetze in der Kristallwelt und ihr Einfluß auf die
Verteilung und die Form der Flächen ...................... 36
a) Das Symmetriezentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
VIII Inhaltsverzeichnis.
Seite
b) Drehungsachsen (Deckachsen), Gyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
Über die Möglichkeiten von Deckachsenkombinationen . . . .. 38
c) Spiegelebene (Symmetrieebene) und deren Beziehung zum
Symmetriezentrum ..................................... 39
d) Achsen der zusammengesetzten Symmetrie (Achsen H. Art),
Gyroiden: Inversionsachsen und Drehspiegelachsen. . . . . . . .. 39
e) Flächensymmetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
V. Entwicklung der Kristallklassen auf Grund der fünf Prinzipien
der Formbildung (fünf einfache Stufen der Symmetrie) . . . . . .. 42
VI. Die 32 Kristallklassen in ihrer Gruppierung auf sieben Abteilungen
(Kristallsysteme ) .......................................... 45
a) Hauptzonenverband : Neunzonensystem ................... 45
b) Die sieben Kristallsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46
c) Kristallklassen mit zentrogyroidaler Herleitung . . . . . . . . . . .. 51
VII. Formenbeschreibung für die einzelnen Kristallsysteme mit Bei
spielen konstruktiver Darstellung in stereographischer Projektion 52
a) Triklines System........................................ 52
b) Monoklines System ..................................... 55
c) Rhombisches System.................................... 60
d) Tetragonales System.................................... 64
e) Hexagonales System .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
f) Rhomboedrisches oder trigonales System.................. 82
g) Kubisches oder tesserales System ........................ 93
VIII. Zwillings bildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107
a) Zwillingsgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107
b) Ausbildung der Zwillingskristalle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
IX. Die Raumgittervorstellung über den Feinbau der Kristalle .... 114
a) Anfänge und Entwicklung der Theorien über die Kristall-
struktur ............................................... 114
b) Die 14 BRAVAIsschen Gitter (Translationsgruppen) und die
Weiterentwicklung der Theorie durch L. SOHNCKE ......... 116
c) Zusätzliche Symmetrieelemente des Feinbaues : Schrauben-
achsen und Gleitspiegelebenen ........................... 120
d) Die Vollendung der Strukturtheorie. Die 230 SCHoENFLIEsschen
Raumgruppen .......................................... 121
B. Kristalloptik.
Von Dr. HERMANN TERTSCH.
I. Grundlagen im optischen Verhalten der Kristalle .............. 124
a) Allgemeine Grundlagen .................................. 124
b) Farbe, Durchlässigkeit, Glanz ............................ 127
1. Farbe 127. - Strich 129. - Interferenzfarben 130.
2. Brechung (Durchlässigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
Prismenmethode 133. - Einbettungsmethode 133. - Me
thode der Totalreflexion 134. - BEcKEsche Lichtlinie . . .. 136
3. Glanz................................................ 137
Inhalts verzeichniH. IX
Seite
c) Doppelbrechung und Polarisation ......................... 138
1. Doppelbrechung ....................................... 138
2. Polarisation .......................................... 141
Spiegelpolarisatioll 141. - Doppelbrechungspolarisation 143.
d) Beziehungen zur Kristallsymmetrie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147
1. FLETCHERS Indikatrix ................................. 148
2. BECKES Skiodromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
3. Optik der niederen KristalllS'ylSteme ..................... 149
e) Die Brechung8quotienten doppelbrechelluer KrilStallo .... . . .. 154
1. Prismenmethode ....................................... 154
2. !llethode (leI' Totalreflexion ............................ 155
1 r. DalS Polarisation>lmikroskop ................................. 157
a) Beobachtungen im Orthoskop ............................ 159
1. Unterscheidung VOll Einfachbrechullg uuu Doppelbrechullg . 15D
2. Bestimmung (101' Auslöi:lchungsrichtungen ................ 159
3. Bestimmung VOll a' uud y' ............................ 161
4. Bestimmung der Brechungsquotiellte11 a' U11U y' ......... 164
5. Bestimmung der Doppelbrechung (y' - (1') .............. 165
6. Bestimmung des "optischen Charakters" ................ 170
7. Drehtischmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171
b) Beobachtungen im K0110"kop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173
1. Beobachtungsgrundlagen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173
2. Achsellbilder einachsiger KrilStalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
3. EinachsigEs Achsenbild und optischer Charaktor. . . . . . . . .. 180
4. Achsenbilder zweiachsiger Kristalle ..................... 182
5. Zweiachsiges Achsenbild und optischer Charakter. ........ 185
6. Messung des }. . chsenwinkels .................... . . . . . . .. 188
7. Achsenwinkeldi"persion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190
c) Auswählende Absorption -- l'leochroitilllut> ................. 194
III. Kristalle mit optischem Drehvermögen ....................... 197
a) Die Grunder8cheillungen des optischeu Dreh vermöge11" . . . . .. 197
b) Die Arten optisch aktiver Substanzen ..................... 200
J V. Beeinflussung ues optischen Verhaltens der Kri"talle .......... 201
a) Einfluß <1or Templ'ratur auf die optischen Eigenschaften .... 201
b) Einfluß des Druckes auf die optischen Eigenschaften ....... 203
c) Optische Anomalien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207
Sach verzeichnis .............................................. 209
Ergänzungen ..... '" ........................... .. ............ X
Ergänzungen.
:::leite 38, nach Fußnote 2: Die dritte, vollständig uIllgearbeitete Auflage
(Berlin, Borntraeger, 1941) ü;t betitelt: Lehr buch der Mineralogie unu Kristall
cheIllie; oben zitierter Symrnetriesatz findet sich dort im '1'eil I, S.44.
Seite 105, bei Legende zu A bb. 150 den Zusatz: Die beiden negaiiven
Formen unterscheiden sinh von den positiven bloß dureh die um 90° gedrehte
Stellung (analog dem Tetraeder in positiver und negativer 8tellung).
A. Kristallographie.
Einleitung.
Kristallographie heißt wörtlich Kristallbeschreibung, und zwar meint
man unter Kristallographie schlechthin die geometrische Kristallographie,
zum Unterschied von der physikalischen und chemischen Kristallo
graphie.
Da die Kristallgestalten vor· allem dem Mineralogen in seinen Unter
suchungsobjekten - den Mineralien - in oft wundervoller Schönheit
entgegentreten, wurde die Formenlehre dieser Naturgebilde in erster
Linie von Mineralogen gepflegt und entwickelt und ihre beherrschenäen
Gesetzmäßigkeiten von ihnen studiert. So entstand die Kristallographie
als der grundlegende Teil der allgemeinen Mineralogie. Gleichwohl hat
sich die Kristallographie in der Folgezeit namentlich durch die Er
weiterung des Blickfeldes auf die Gesetzmäßigkeiten der Feinstruktur -
den atomistischen Innenaufbau der Kristalle - in den letzten Jahr
zehnten immer mehr und mehr zu einer selbständigen, mathematisch
physikalischen Wissenschaft entwickelt. Jedenfalls aber ist sie für den
wissenschaftlichen Mineralogen nach wie vor eine unentbehrliche Grund
lage, ja eigentlich das durchgreüende Element seines gesamten Wissens
gebietes. Selbst die früher deskriptiv arbeitende spezielle Mineralogie
wird durch die Erkenntnisse der röntgenographischen Feinstrukturlehre
und ihrer Forschungsergebnisse (Kristallchemie) von gänzlich neuen
Gesichtspunkten beherrscht.
Da ist es zunächst nötig, das Wesen des Kristalls eindeutig zu um
schreiben. Man könnte sagen: Kristalle sind homogene, anisotrope
Naturkörper, d. h . .in physikalischem und chemischem Sinne" in sich
gleichartige Körper, die aber hinsichtlich gewisser Eigenschaften richtungs
abhängig sind.
Diese physikalische Richtungsabhängigkeit tritt auch geometrisch in
Erscheinung, wenn man den wachsenden Kristall studiert.
Kristallisation tritt nämlich dann ein, wenn die Materie vom flüssigen
(oder gasförmigen) Aggregatzustand in den festen übergeht; also beim
Erstarren einer .S chmelze, beim Ausfällen eines gelösten Stoffes, bzw.
beim Ausscheiden von gelöster Substanz aus einer übersä.ttigten Lösung.
ll.aaz-Tert&ch, 2. Ann. 1