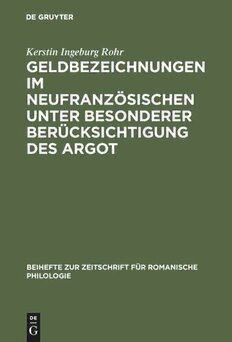Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
FORTGEFÜHRT VON WALTHER VON WARTBURG
HERAUSGEGEBEN VON KURT BALDINGER
Band 214
Kerstin Ingeburg Rohr
Geldbezeichnungen
im Neufranzösischen unter
besonderer Berücksichtigung
des Argot
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1987
Meinen Eltern
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Rohr, Kerstin Ingeburg:
Geldbezcichnungen im Neufranzösischen unter besonderer Berücksichtigung des Argot /
Kerstin Ingeburg Rohr. - Tübingen : Niemeyer, 1987.
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie ; Bd. 214)
NE: Zeitschrift für romanische Philologie / Beihefte
ISBN 3-484-52214-3 ISSN 0084-5396
© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1987
Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, dieses Buch
oder Teile daraus photomechanisch zu vervielfältigen. Printed in Germany.
Druck: Weihert-Druck GmbH, Darmstadt.
Einband: Heinrich Koch, Tübingen.
V
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung VII
I. Wortanalyse 1
II. Die formalen Techniken bei der Argot-
bildung 266
1. Suffixbildungen 266
2. "Largonji" 277
3. Anagramm 279
A. Kürzungen 279
5. Wortkreuzungen 279
6. Spaßhafte Umbildungen 280
7. "Derivation synonymique" 281
8. Bildspender 290
a. Das zum Prägen vewandte Metall 290
b. Eigenschaften der zur Prägung verwandten
Metalle 293
Glanz 293
Härte 29 i.
Klang 294
c. Farbe der Geldmünzen 297
Weiß 297
Gelb 299
Braun 302
d. Farbe der Geldscheine 302
e. Form der Geldmünzen 303
Knöpfe 307
Steine 308
f. Form der Geldscheine 309
g. Konsistenz des Papiergeldes 310
h. Schaubild bei Münze und Geldschein 313
Inschriften und Sachmotive 313
Personennamen und Personifikation 315
Tiernamen 322
Ländernamen 326
Zahlen 327
i. Bezeichnungen nach dem Wert der Münze 330
j . Verächtliche Bezeichnungen 332
k. Materieller Gegenwert 333
Geld als Grundstoff, Mittel und Besitz .... 333
Knochen 334-
Bezeichnungen aus dem Haushalt 335
VI
Brennstoff 335
Nahrungsmitte], Pflanzen und Fette 337
1. Bezeichnungen aus verschiedenen Berufs-
ständen 344
Soldaten und Jäger 34-4
Handwerker 345
Spieler 34.7
in. Zähl-, Maßeinheiten und Quantitätsbe-
zeichnungen 348
n. Einstellung zum Geld 352
0. Wirkung des Geldes 353
p. Verschiedenes 354
9. Geldbezeichnungen anderer Sprachen 356
III. Zusammenfassende Darstellung der Geldbezeichnungen
im FEW 362
1. Etymologisierte Wörter 362
2. Nicht etymologisierte Wörter 401
IV. Literaturverzeichnis 405
1. Primärliteratur ' 405
Primärliteratur chronologisch geordnet .... 414
2. Sekundärliteratur 4-15
Französisch 415
Etymologische Wörterbücher 422
Gemeinsprachliche Nachschlagewerke 422
Spanisch 422
Portugiesisch 423
Englisch 423
Deutsch 424
V. Register 425
Französisch 425
Spanisch 436
Portugiesisch 438
Italienisch 438
Rumänisch 439
Englisch 439
Deutsch 440
VII
EINLEITUNG
Die Mannigfaltigkeit der Geldbezeichnungen zeigt das leb-
hafte Interesse des Volkes für das allmächtige Zahlungs-
mittel. Die zentrale Stellung des Geldes im Alltagsleben,
das ständige Trachten nach ihm und die Probleme, die sich
damit verbinden, vergrößern das Bedürfnis vom Geld zu
sprechen1 bzw. es mit affektgeladenen Bezeichnungen zu
benennen. Die Gemeinsprache bietet, im Gegensatz zur
Volkssprache und zum Argot, keine Bezeichnungen für "Geld"
an, die die Eigenschaft der Realität Geld oder ihr Ver-
hältnis zum Menschen, also das Vorstellungs- und Gefühls-
mäßige, in befriedigender Weise auszudrücken vermögen.
Ziel unserer Arbeit ist, die Geldbezeichnungen im Neu-
französischen2 unter besonderer Berücksichtigung des
Argot nach onomasiologischen Gesichtspunkten darzustellen.
Es handelt sich hier im Prinzip um eine diachronische Be-
trachtungsweise, der Schwerpunkt verlagert sich aber
automatisch auf das 19. und 20. Jahrhundert, da die von
uns verwendeten Quellen überwiegend aus dieser Zeit stam-
men. Aus den älteren Epochen sind kaum Quellen vorhanden;
die Argotwörter wurden in der Regel mündlich weitergege-
1Vgl. hierzu H. Sperber Einführung in die Bedeutungslehre
Bonn, Dümmlers Verlag 31965,S.39:« |...I haftet an einem
bestimmten Vorstellungskreis ein starker Gefühlston ir-
gendwelcher Art, so ist die Folge in der Regel eine Ten-
denz, von diesem Vorstellungskreis, oder damit verwand-
ten so viel und so oft zu sprechen, bis die Stärke des
Gefühlstons unter ein gewisses Minimum herabgesunken ist.
Affektstarke Vorstellungen werden also zu bevorzugten
Gesprächsthemen und zwar selbstverständlich nicht nur
des Einzelnen, sondern, wenn sie für eine ganze Gruppe
von Menschen gefühlsbetont sind, auch für die Gruppe.»
2Aufgegriffen werden auch die mfrz. Argotwörter haiJigue.,
he./iaie., ove.nde., paitlie., paitle. und vine.tte..
VIII
ben. Erst ab dem 19« Jahrhundert erfahren sie eine starke
schriftliche Fixierung.
Unsere Untersuchung umfaßt insgesamt 697 Einzelbe-
zeichnungen für "Geld", einschließlich der Varianten
durch verschiedene Schreibung.
Eine semantisch-lexikalische Zergliederung des Wort-
materials tritt in den Hintergrund; der Begriff "Geld"
besitzt quantitativen Charakter und läßt sich allenfalls
in "Geld im allgemeinen", "Geldmünzen und -scheine" und
"gewisse Geldsummen" unterteilen. Einer solchen Unter-
scheidung werden wir nicht weiter nachgehen, da viele der
zu untersuchenden Geldbezeichnungen mehrere dieser Bedeu-
tungen innehaben (so z.B. -iac "argent, 1000 francs,100
francs,billet de 10 millions").
Die an "Geld" angrenzenden Wortinhalte wie etwa "Er-
sparnisse", "Lohn", "Trinkgeld" und "Reichtum" werden
von der Untersuchung ausgeschlossen. Sie würden den Rah-
men der Arbeit sprengen. Auch die sprichwörtlichen Redens-
arten über das Geld bleiben unbeachtet, es sei denn, daß
sie zur Klärung der zu untersuchenden Bezeichnungen bei-
tragen. Bestimmte Münznamen werden nur berücksichtigt,
wenn sie im Sinn von "Geld" generalisiert werden (z.B.
copeck "monnaie russe" > arg. kope(c)k sg. "sou", pl.
"argent").
Was das Erstellen des Wortkorpus anbelangt, erweist
sich ein Rückgreifen auf die onomasiologische Literatur
als ziemlich aussichtslos. Die Arbeiten Da-ö Qeld, ein
Be.it/iag zun. Voik-ikunde von G. Niemer, Die. flilnz.e. in dei
Kuliu/ige^chichie von F. Friedensburg und Die nllnzieze ic.h -
nungen in deA. a{./iz. Lite/iaiusi von G. Beiz sind3,im Gegen-
satz zur Abhandlung über Bezeichnungen* ¿¡in. "Qeld" im Spa-
3G. Niemer Das Geld ein Beitrag zur Volkskunde, Breslau
1930.
F. Friedensburg Die Münze in der Kulturgeschichte, Berlin
1926.
G. Beiz Die Münzbezeichnungen in der altfranzösischen
Literatur, Straßburg 19H.
IX
niicken und ande.zi.iuo von A. Greive"1, für unsere Zwecke
kaum geeignet.
Als Quellen dienten uns daher
zahlreiche Argotwörterbücher (angefangen von Chéreau
A/igot n.&{.o/imi 1628 bis hin zum Dici ionnai/ie ¿¿¿u^t/i£ d'
Argot 1981), unter denen sich das Werk von Gaston Esnault
Dictionnaire h i-itoA. ¿que. de4 Argot4 f.ranç.ai4 besonders her-
vortut, da es sich nicht nur auf das reine Aufzählen von
Argotwörtern beschränkt, sondern sich auch um deren Klä-
rung bemüht5;
verschiedene Arbeiten, die sich mit der Beschreibung
bzw. dem Erforschen von Volkssprache und Argot befassen,
bes. Le tangage populaire von H. Bauche und Le langage
parisien au XIXe- ¿iecle von L. Sainéan6;
Literaturtexte, vorwiegend Sozial- und Kriminalromane
mit stark umgangssprachlichen Einschlag: von Pechon de
Ruby, Grandveau, Vidocq spannt sich der Bogen (u.a.) über
Hugo,.Sue, Balzac, Richepin, Carco, Céline zu Queneau,
Boudard und den "Kriminalisten" Simonin, Le Breton und
San Antonio, Pseudonym für Frédéric Dard.
Die einzelnen Bezeichnungen werden in alphabetischer
Reihenfolge auf ihre Herkunft hin untersucht (I. Wortana-
lyse). Hierbei stützen wir uns in erster Linie auf das
umfassende Werk von Walther von Wartburg Tranzö* i^che*
£tymo £og itche-i Uö/iteriuch ( FEW ) , 25 Bände, seit 1928. In
zweiter Linie werden wir auf die etymologischen Wörter-
bücher Nouveau Dictionnaire ¿tymo Log icfue ei Hi^tor ¿que.
""Erschienen in Umgangssprache in der Iberoromania, Fest-
schrift für Heinz Kröll, hrsg. von G. Holtus und E. Radt-
ke, Tübinger Beiträge, Bd.235, 1984, S.351-357.
50. Chéreau Le Jargon ou Langage de l'Argot réformé,comme
il est à présent en usage parmy les bons pauvres, Paris,
Veuve Carroy 1628; Genève, Slatkine Reprints 1968.
R. Giraud Dictionnaire illustré d'Argot moderne, Paris
Grancher 1981.
G. Esnault Dictionnaire historique des Argots français,
Paris, Larousse 1965.
6H. Bauche Le langage populaire, Paris, Pa^ot 21928.
L. Sainéan Le langage parisien au XIXe siecle, Paris
1920.
X
(DDM), Paris 1964. von A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand
und £tymo¿og¿AcheA blön.ten.6.uc.h. d.e.1 TA.anz.64i4ch.en Spiache.
(Garn), Heidelberg 1969 von E. Gamillscheg bzw. auf die
gemeinsprachlichen Nachschlagewerke 7A.IAO/I de La tangue.
liantaUe. (TLF), Paris 1971-1983, D¿etionnaiie alphall-
tigue de la tangue. {.A.anq.aiAe ,"Pet it R0He.1t" (PR), Paris
1978, * Qiand Role/if (GR), Paris 1970 und QA. and LaA.ou.44e
de la. tangue ¿A.anc.ai4e (GLLF), Paris 1971-1978 ausweichen.
Das Erfassen der Etymologien der zu untersuchenden
Geldbezeichnungen, die meist in der untersten diastrati-
schen Schicht, dem Argot, angesiedelt sind, ist nicht
immer leicht. Die Gründe hierfür liegen im Geheimcharak-
ter des Argot, der sich im Hang zur Unkenntlichmachung
des Signifikanten und zur ständigen Innovation des Wort-
schatzes äußert. Zudem entstehen die Argotwörter aus be-
stimmten Situationen und Milieus, deren Umstände nur
schwer oder gar nicht rekonstruierbar sind. Die von uns
vorgeschlagenen Etymologien bzw. Bedeutungstransfers ba-
sieren daher oftmals nur auf Hypothesen.
Nach der Wortanalyse, die auch Aufschluß gibt über das
"Leben" bzw. die "Kurzlebigkeit" der verschiedenen Geld-
bezeichnungen, gehen wir der Frage nach, welche sprach-
lichen Mittel die Geldbezeichnungen veranlaßt haben (II.
Die formalen Techniken bei der Argotbildung). Hierbei
richtet sich unser Augenmerk weniger auf die phonetischen
und morphologischen Motivierungsweisen (Suffixbildungen,
Anagramme und ähnliche Deformierungen), als vielmehr auf
das Phänomen der "d&rivation synonymique". Oberflächlich
betrachtet, läßt die große Bezeichnungsfülle auf viel
Phantasie, Originalität und Ideenreichtum schließen. Die
Anhäufung der Geldbezeichnungen mittels der "derivation
synonymique", die durch den Wunsch entsteht, verblassende
Bezeichnungen durch aussagekräftigere zu ersetzen, ent-
larvt zumindest den anscheinenden Ideenreichtum. Es zeigt
sich nämlich, daß den Geldbezeichnungen nur eine begrenz-
te Anzahl von Bildspendern zugrunde liegt. Im Vordergrund
stehen hierbei die konkreten Bezeichnungsmotive, besonders