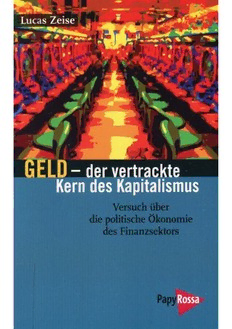Table Of ContentLucas Zeise
Geld - der vertrackte
Kern des Kapitalismus
Versuch über die politische
Ökonomie des Finanzsektors
PapyRossa Verlag
© 2010 by PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Köln
Luxemburger Str. 202, 50937 Köln
Tel.: +49(0) 221 -44 85 45
Fax: +49 (0) 221 - 44 43 05
E-Mail: [email protected]
Internet: www.papyrossa.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Willi Holzel, Lux siebenzwo
Druck: Interpress
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
ISBN 978-3-89438-444-9
Inhalt
1. Einleitung (7)
2. Arbeit und Wissenschaft von der Arbeit (10)
3. Gelderklärungen (16)
Geld in der neoklassischen Lehre (17) - Die Lehre von Gesell (25)
- Die Rolle des Geldes bei Keynes (30) - Anwendungsgeschich-
te des Keynesianismus (35) - Die >Eigentumstheorie< des Gel-
des (42)
4. Ein marxistischer Geldbegriff (49)
5. Varianten des Geldes (61)
Wertpapiere (64) - Versicherungen (68) - Fonds (71) - Deriva-
te (76)
6. Die kapitalistische, neoliberale Geldverfassung (88)
Angst vor Inflation (90) - Wie Geld entsteht (92) - Die Mindest-
reserve (97) - Eigenkapitalunterlegungspflicht (100) - Die Inter-
aktion von Geschäftsbanken und Notenbank (110) - Die asym-
metrische Geldpolitik (119)
7. Der Neoliberalismus und seine Krise (125)
Spekulationswellen (129) - Der Fall von Lehman Brothers (132)
- Ein Boom in der Krise (139) - Die Krise bereinigt nicht (141)
8. Die Gewinne des Finanzsektors (147)
Das Rätsel der hohen Gewinne (153) - Kredit ohne Grenzen (156)
- Spekulationsgewinn (159)
9. Staat und Finanzsektor (164)
Staatspleiten (170)
10. Die Bändigung (178)
Eigenkapital der Banken (180) - Makroökonomische Warnsyste-
me (181) - Regulieren ist möglich (186)
1. Einleitung
Wir haben es derzeit mit einer der gewichtigeren Krisen des Kapitalis-
mus zu tun. Diese Erkenntnis hat sich auch bei denen durchgesetzt, die
gewöhnlich nicht vom Kapitalismus reden. Der Vergleich mit der Welt-
wirtschaftskrise 1929 bis 1939 liegt nahe oder auch - harmloser - mit
der Umbruchphase der 1970er Jahre. Mit diesen beiden Vorgängerkri-
sen hat diese 2007 offen ausgebrochene Finanz- und Weltwirtschafts-
krise eine Sache gemeinsam: So wie bisher kann es nicht weitergehen.
Da das so ist, ergibt sich die einfache These: Die Krise markiert das
Ende des Neoliberalismus.
Das klingt wie historischer Optimismus. Und man muss einräu-
men, dass die Aussage vom Ende des Neoliberalismus bisher nur eine
ökonomische Schlussfolgerung ist. Politisch ist von einem Ende des
Neoliberalismus fast nirgendwo etwas zu erkennen. Ausnahmen sind
die Streiks und Demonstrationen in Griechenland gegen das von den
Euro-Partnern, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und den
Finanzmärkten auferlegte Spardiktat sowie die Tatsache, dass sich die
Bevölkerung Islands erfolgreich gegen die Pflicht zur Rückzahlung
der Schulden gewehrt hat, die die isländischen Banken in den Nieder-
landen und Großbritannien aufgehäuft hatten. Die Parole der Isländer
und Griechen ist die gleiche, die auch in Deutschland - allerdings zu
schwach - zu hören ist: »Wir zahlen nicht für eure Krise«. Es ist die
genau richtige Parole.
Die Unfähigkeit der Regierungen, mit der Krise und ihren Aus-
wirkungen fertig zu werden, hat das politische System in allen (al-
ten) kapitalistischen Ländern geschwächt. Mit Verblüffung nehmen in
8
GELD - DER VERTRACKTE KERN DES KAPITALISMUS
Deutschland die Bürger die Orientierungslosigkeit der rechten, liberal-
konservativen Regierung zur Kenntnis. Ihr Handeln in der Europa-
politik, in der Finanz- und Steuerpolitik widerspricht eigenen, früher
für heilig gehaltenen Prinzipien. Die Anhänger dieser Prinzipien und,
was meist dasselbe ist, diejenigen, die hofften, von einem gelungenen
Wirtschaftsaufschwung zu profitieren, sind bitter enttäuscht. Sie laufen
davon und, wenn sie Wahlmänner oder -frauen in der Bundesversamm-
lung sind, wählen sie nicht Frau Merkels Kandidaten, sondern einen
scheinbar prinzipienfesten Mann der Reaktion, Joachim Gauck.
Das ist in anderen Ländern ganz ähnlich. Keine Regierung kann da-
von ausgehen, wiedergewählt zu werden. Sogar im hyperstabilen Japan
wurden die Liberaldemokraten, die alte stockkonservativ-neoliberale
Partei aus der Regierung entfernt - und der neue Premier gleich wie-
der gestürzt. In Großbritannien gab es einen klassischen Regierungs-
wechsel hin zu den Konservativen. Barack Obama, Nicolas Sarkozy,
Silvio Berlusconi, Jose Luis Zapatero können nicht sicher sein, die
nächsten Wahlen wieder zu gewinnen. Sie haben den Wählern noch
weniger zu bieten als in früheren Zeiten. Der Druck im Inland macht
diese Regierungen weniger fähig zum Kompromiss im Ausland. In
Kopenhagen und Toronto haben die Teilnehmer gar nicht versucht,
ihre Differenzen höflich vor der Öffentlichkeit zu glätten. Die Krise
des Euro ist von einer innenpolitisch bedrängten deutschen Kanzlerin
verschärft worden. Politisch sieht das wie Wetterleuchten aus. Noch
scheint das Gewitter ein paar Dutzend Kilometer entfernt.
Die Weltwirtschaftskrise geht ökonomisch nicht von selbst vor-
bei. Ebensowenig erscheint ein rettender Helfer, etwa eine dauerhaft
schnell wachsende chinesische Volkswirtschaft. Dadurch mildert sich
zwar die Krise, sie verschwindet aber nicht. Die US-Volkswirtschaft
gerät vor allem wegen der rasch steigenden Arbeitslosigkeit und da-
mit sinkender Nachfrage erneut in ein Konjunkturtal. In Europa hat
die Wirtschaftsleistung noch bei weitem nicht den Vorkrisenstand er-
reicht. Nun wird die staatliche Nachfrage zurückgenommen, werden
die Haushalte unter Zwang oder freiwillig konsolidiert. Die leichte
Erholung aus dem zweiten Halbjahr 2009 und dem ersten 2010 bricht
ab. Voraussichtlich folgt Stagnation.
1. EINLEITUNG 9
Die Weltwirtschaftskrise ist von einer Krise des Finanzsektors aus-
gelöst worden. Das ist nicht untypisch für den Kapitalismus. Aber es
wirft Fragen zum Charakter des Finanzsektors auf und danach, warum
er eine herausragende und eben auch niederreißende Rolle zu spielen
vermag. Solche Fragen sind zum Beispiel, inwieweit der Spekulations-
gewinn eine ganz eigene Form des Profits darstellt; welche Rolle staat-
liche Institutionen für die Existenz von Banken und Finanzmärkten
spielen; warum die Finanzinstitutionen einen so nachhaltigen Einfluss
auf die Politik der Nationalstaaten haben; wie es den Akteuren am Ka-
pitalmarkt gelingt, immer größere Anteile des Gesamtprofits für sich
abzuzweigen; und weshalb gerade der Finanzsektor der immer wieder
rückfällig werdende Krisenproduzent im Kapitalismus ist.
Um solche Fragen diskutieren oder gar beantworten zu können,
braucht es eine einigermaßen schlüssige Theorie über das Geld. Da-
bei orientiert sich der Autor im Grundsatz an Karl Marx. Dennoch
ist auch ihm klar, dass es damit allein nicht getan ist. Daher versucht
er, ihm wichtige Geldtheorien und insbesondere John M. Keynes zu
rezipieren und darzustellen (Kapitel 3). Eine marxistische Geldtheorie
wird im 4. Kapitel versucht. Dabei geht es darum, einige Schwächen
der Marx'schen Darlegung so zu beseitigen, dass eine Analyse des
hochmodernen und hochdestruktiven Finanzsektors möglich wird.
Die Eskimos, sagt man, hätten die meisten Synonyme für »Schnee«,
weil er in ihrer Welt das Wichtigste ist. In Deutschland, wie sicher
auch in allen anderen Nationen, die die kapitalistische Produktions-
weise genießen, gibt es die meisten Synonyme für das schöne Geld.
Hier eine Auswahl: Knete, Zaster, Kies, Moos, Kohle, Moneten,
Pinke und Pinkepinke, Scheine, Währung, Devisen, Bares, Valuta,
Kröten, Peseten, Diri-Dari, Mäuse, Piepen, Schotter, Lappen, Penun-
zen, Mammon, Eier, Koks, Marie und die dicke Marie, Quickser,
Bimbes, Pieselotten, Knatze, Knatter, Mücken, Pekuniäres, Blech,
Pimperlinge, Cash, Stutz, Rubel, Taler, Blüten, Peanuts, Altendiezer,
Pulver, Okken, Draht, Money, Flocken... Die Bedeutung des Themas
sei hiermit noch einmal nachgewiesen.
2. Arbeit und Wissenschaft
von der Arbeit
Wenn man mit Marx beginnt, ist die Herangehensweise in einem
Punkt klar. Die grundlegende Kategorie der Ökonomie ist die Arbeit.
In frühen Jahren haben Karl Marx und Friedrich Engels eine Erkennt-
nis formuliert, die später als »historischer Materialismus« in die Ideen-
geschichte eingegangen ist. Sehr knapp zusammengefasst bedeutet diese
Herangehensweise an die menschliche Geschichte, dass Gesellschaften
grundlegend geprägt werden von der Art und Weise, wie sie für ihren
Fortbestand, ihre Weiterexistenz und ihre Weiterentwicklung sorgen.
Die Menschen können nur existieren, weil sie arbeiten. Um zu essen,
um zu schlafen, um Kinder aufzuziehen, kurz um leben zu können,
müssen Menschen arbeiten.
Sie tun das von vornherein in einem gesellschaftlichen Zusam-
menhang. Die Arbeit ist nur in den seltensten Fällen wirkliche Einzel-
arbeit. Sie ist fast immer Arbeit mit den anderen, sie ist zumindest auf
die Arbeit anderer bezogen. Es ist gesellschaftliche Arbeit. So wenig,
wie der einzelne Mensch sich reproduzieren kann, so wenig kann er
auch als einzelner arbeiten. Die Art und Weise der gesellschaftlichen
Arbeit ist das erste und wichtigste Merkmal der Kulturen. Dass Wis-
senschaft die menschlichen Kulturen so betrachtet, hat sich seit Marx'
und Engels' Zeiten durchaus eingebürgert. Altsteinzeit und Neustein-
zeit, Bronzezeit sind ebenso Begriffe der Geschichtswissenschaft wie
alt- oder neusteinzeitliche Gesellschaften Begriffe der Ethnologie sind.
Der Übergang von der Alt- zur Neusteinzeit, in dessen Verlauf sich
aus den Gesellschaften oder Stämmen, die von Jagd und Sammeln