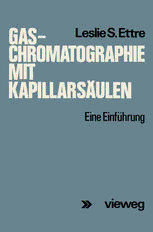Table Of ContentGas-Chromatograph F-22 vom Bodenseewerk Perkin-Eimer & Co.
G.m.b.H. - Modul-System für optimale Bausteinkombinationen.
Kapillarsäulen-Version für alleDünnfilm-und Dünnschicht
kapillaren. Lückenloses Glas·System von der Probenaufgabe bis zur
Detektordüse beim Betrieb von Glaskapillarsäulen.
Leslie S. Ettre
Gas
Chromatographie
mit Kapillarsäulen
Eine Einführung
Mit 27 Abbildungen
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Originalausgabe "Open Tubular Colurnns-An lntroduction", veröffentlicht
im Herbst 1973 von The Perkin-Eimer Corporation, Norwalk, Connecticut, U.S.A.
Verlagsredaktion: Udo Wittig
1976
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1976
Ursprünglich erschienen bei Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1976
Die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder, auch
für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit dem Verlag
vorher vereinbart wurden. Im Einzelfall muß über die Zahlung einer Gebühr für die Nutzung
fremden geistigen Eigentums entschieden werden. Das gilt ftir die Vervielfältigung durch alle
Verfahren einschließlich Speicherung und jede Übertragung auf Papier, Transparente, Filme,
Bänder, Platten und andere Medien.
Satz: Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig
ISBN 978-3-663-01913-8 ISBN 978-3-663-01912-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-01912-1
Vorwort
Diese Schrift soll den Leser mit den Grundlagen der Gas-Chromatographie mit
Kapillarsäulen vertraut machen. Wir werden kurz auf das Prinzip dieser Säulen
eingehen, sie bezüglich Trennleistung und Analysengeschwindigkeit mit ge
packten Säulen vergleichen sowie die instrumentellen Bedingungen fur ihre
Anwendung diskutieren, ohne jedoch die theoretischen Grundlagen dieser
Säulen erschöpfend zu behandeln. Der daran interessierte Leser sei dazu auf
die zitierte Literatur oder die einschlägigen Bücher verwiesen; einige elementare
Beziehungen sind jedoch insoweit angegeben als sie zur optimalen Anwendung
dieser Säulen erforderlich sind.
In den vergangenen Jahren ist die Literatur über Glaskapillarsäulen beträchtlich
angewachsen. Da aber sowohl deren Anwendung als auch die theoretischen Grund
lagen gleich sind wie die von Metallsäulen, gelten die Ausftihrungen in dieser
Schrift natürlich gleichermaßen auch flir Glaskapillarsäulen. Einige spezielle
Fragen bei der Verwendung von Glaskapillarsäulen ergeben sich bezüglich der
Anschlüsse sowie der Dosiersysteme, auf die aber hier nicht eingegangen wird,
da nach unserer Meinung die Dinge hier noch zu stark im Fluß sind, um solche
Fragen in eine Einftihrung mitaufzunehmen.
Die vorliegende Schrift ist die deutsche Übersetzung einer überarbeiteten Fassung
der englischen Originalausgabe "Open Tubular Columns-An Introduction",
veröffentlicht im Herbst 1973 von The Perkin-Eimer Corporation, Norwalk,
Connecticut, U. S. A. In der Übersetzung wird die Bezeichnung "Kapillarsäulen"
anstelle von "open tubular columns" verwendet, während die beiden Säulentypen
als "Dünnfilmkapillaren" bzw. Dünnschichtkapillaren" bezeichnet werden entspre
chend den englischen Ausdrücken "wall-coated open tubular (WCOT) columns" bzw.
"support coated open tubular (SCOT) columns".
In dieser Schrift sind die Säulendimensionen im allgemeinen im amerikanischen
System (foot-inch) angegeben. Eine Umrechnung ins metrische System hätte nur
unhandliche Zahlen ergeben. Lediglich beim inneren Durchmesser der Kapillar
säulen ergibt diese Umrechnung bequeme Zahlenwerte: 0.25 mm flir 0.010 in.
und 0.50 mm flir 0.020 in.
Die Symbole sind gleich wie in der englischen Ausgabe; da sich aber einige von
ihnen von der Schreibweise in der europäischen Literatur unterscheiden, ist zu
Beginn des Textes eine Liste der verwendeten Symbole zusammengestellt.
Der Autor dankt an dieser Stelle Herrn Dr. B. Kolb (Bodenseewerk Perkin-Eimer & Co.
GmbH, Überlingen) herzlich flir die sachkundige und sorgfältige Übersetzung dieser
Schrift.
L. S. Ettre
Norwalk, Connecticut, 10. November 1974
Inhaltsverzeichnis
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Elementare chromatographische Beziehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elementare chromatographische Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Relative Retention und Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Auflösung und Trennleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trennleistung und Trägergasgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Die Analysenzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vergleich von gepackten Säulen mit Kapillarsäulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gepackte Säulen und Kapillarsäulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dünnfilm-und Dünnschichtkapillaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Belastbarkeit und Nachweisgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dünnfilmkapillaren mit verschiedenen Durchmessern . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gerätetechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dosiersysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Säulenanschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Spezielle Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Temperaturprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wahl der Detektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Liste der Symbole
A Term aus der van-Deemter-Gleichung, charakteristisch für die
Streudiffusion in einer gepackten Säule
B Term aus der van-Deemter-Gleichung, charakteristisch für die
Längsdiffusion in der Gasphase
Bo Spezifische Permeabilität (Durchlässigkeit) einer Säule
c
Term aus der van-Deemter-Gleichung, charakteristisch für den
Stoffaustauschwiderstand
Durchflußgeschwindigkeit des Trägergases gemessen am Säulenende,
korrigiert auf Säulentemperatur
h,HETP Höhenäquivalent eines theoretischen Bodens
HETPmin HETP-Wert im Minimum der van-Deemter-Hyperbel
k Kapazitätsfaktor (Verteilungsverhältnis)
K Verteilungskoeffizient
L Säulenlänge [für die Umrechnung von (foot) in (m) ist die Näherung
150 (ft.) = 45.72 (m) ""'45 (m) ausreichend]
Erforderliche Säulenlänge für eine bestimmte Auflösung
n Anzahl der theoretischen Böden
Auflösung zwischen zwei Peaks
Retentionszeitdifferenz zweier aufeinanderfolgender Peaks
Durchbruchszeit (Aufenthaltszeit eines nicht zurückgehaltenen
Stoffes in der Säule)
Retentionszeit
Nettoretentionszeit, auch reduzierte Retentionszeit genannt
Mittlere lineare Gasgeschwindigkeit
Optimale mittlere lineare Gasgeschwindigkeit (entsprechend dem
Minimum der van-Deemter-Hyperbel)
Gasvolumen, das einem Peak entspricht
Volumen der Gasphase in der Säule
Volumen der flüssigen Phase in der Säule
Peakbreite an der Basislinie (Schnittpunktsabstand der Wende
tangenten auf der Basislinie)
Peakbreite in halber Höhe
Menge des Stoffes in der Gasphase
Menge des gelösten Stoffes in der flüssigen Phase
a Relative Retention
ß Phasenverhältnis
EINFÜHRUNG
Chromatographie ist ein Trennverfahren, mit dem sich die Zusammensetzung eines
komplexen Gemisches, das aus Stoffen mit ähnlichen chemischen und/oder physi
kalischen Eigenschaften besteht, bestimmen läßt. Diese Tatsache allein erklärt aber
noch nicht, warum sich dieses Verfahren in kurzer Zeit zur meist verwendeten
analytischen Technik entwickelt hat. Schließlich ließen sich auch bereits vor Ein
flihrung der Chromatographie komplexe Gemische mit anderen analytischen Methoden
trennen und analysieren. Der Vorteil der Chromatographie im Vergleich zu den
meisten anderen Trennverfahren liegt jedoch in der kürzeren Analysenzeit. Infolge
dessen müssen zur Beurteilung der Chromatographie Trennleistung und Trennge
schwindigkeit zusammen betrachtet werden.
Wenden wir uns nun der Gas-Chromatographie zu. Die Trennung fmdet hier in
einer Säule statt, die mobile Phase ist ein Gas und die Probenkomponenten liegen
ebenfalls gasförmig vor. Anfangs bestand so eine Säule lediglich aus einem Metall
rohr, geftillt mit dem porösen und relativ inerten Material Diatomeenerde, auf dem
die {flüssige) stationäre Phase als dünner Film aufgebracht war. Die Probe wird in
einen geheizten Einspritzblock eingespritzt, dort verdampft und der Dampf wird
vom Trägergas durch die Säule gespült. Während ihrer Wanderung halten sich die
Moleküle der Probe zeitweilig in der stationären Phase auf, während sie in der
übrigen Zeit vom Trägergas durch die Säule transportiert werden. Die Verzögerung
der verschiedenen Probenkomponenten ist nun unterschiedlich, und infolgedessen
treten sie am Ende der Säule auch getrennt voneinander zu unterschiedlichen
Zeiten aus.
Die Wirksamkeit einer Säule, ihre Trennkraft, ist eine komplexe Funktion und
hängt von zahlreichen Parametern ab, u. a. von der Diffusion der Probenkomponenten
in der Gas-und Flüssig-Phase. In gepackten Säulen wird die Trennkraft begrenzt
durch die langsame Diffusion der Probenmoleküle innerhalb der Poren des Träger
materials. Um diesen begrenzenden Faktor zu eliminieren, machte 11:. J. E. Golay
1957 den Vorschlag, die gepackten Säulen mit ihren unregelmäßigen, porösen
und mit der flüssigen Phase bedeckten Teilchen durch ein langes Rohr zu ersetzen,
bei dem die flüssige Phase als dünner Film auf der inneren Oberfläche des Rohres
verteilt ist [1, 2]. Dadurch bietet sich dem Trägergas ein offener und freier Weg
durch die Säule. So sind die Kapillarsäulen entstanden. Es muß noch hinzugefUgt
werden, daß Golay gleichzeitig die Bedeutung des pneumatischen Widerstands einer
Säule erkannte und zeigen konnte, daß die Trennkraft - die Güte einer Säule unter
den gegebenen Bedingungen -und die Analysengeschwindigkeit, die ihrerseits eine
Funktion der Trägergasströmung oder ihres Druckabfalls ist, gegeneinander aufge
rechnet werden können.
Golays Werk, die Entwicklung von Kapillarsäulen, war eine Revolution in der
Gas-Chromatographie, da damit sehr viel bessere Trennungen als mit gepackten
Säulen und noch dazu in kürzeren Analysenzeiten ermöglicht wurden.
Die von ihm entwickelten Säulen, bei denen die flüssige Phase als dünner Film die
innere Oberfläche des Rohres bedeckt, werden nach der heutigen Terminologie
als Dünnftlm-Kapillaren oder WCOT-Säulen ("wall-coated open tubular columns")
bezeichnet. Die einfache Bezeichnung Kapillarsäule ist zwar auch gebräuchlich,
da der Durchmesser dieser Säulen klein ist - üblicherweise zwischen 0.25 mm und
0. 75 mm - sie ist aber nicht ganz korrekt, da nach Golay nicht der kleine Durch·
messer, sondern der freie Durchgang durch den offenen Längskanal für die Ver
besserung gegenüber gepackten Säulen maßgebend ist [3]. Abgesehen davon werden
auch gepackte Säulen mit "kapillaren" Durchmessern in der Gas-Chromatographie
benutzt [4].
Einige Jahre später machte Golay [3]1960 auf dem Edinburgh Symposium zur
weiteren Verbesserung der Kapillarsäulen den Vorschlag, die Filmdicke dadurch
zu reduzieren, daß eine poröse Schicht auf der Innenwand der Kapillare mit dem
Film der flüssigen Phase bedeckt wird. Da die Oberfläche dieser porösen Schicht
größer ist als die ursprüngliche Fläche, die sich aus der Geometrie des Rohres ergibt,
resultiert eine kleinere Filmdicke der flüssigen Phase. Tatsächlich kann die Ober
fläche so vergrößert werden, daß eine größere Menge der flüssigen Phase unterge
bracht werden kann und trotzdem noch ein dünnerer Film aufrechterhalten wird.
Auf die besondere Bedeutung dieser Tatsache kommen wir später noch zurück.
Es dauerte einige Jahre, bis Golays Vorschlag in die Praxis umgesetzt wurde, und
das ist hauptsächlich das Verdienst von Halilsz und Horvath, damals an der Uni
versität Frankfurt/Maiß [5, 6]. Wir in den Entwicklungslaboratorien von Perkin
Eimer griffen diese Arbeiten auf, entwickelten sie weiter und machten diese Säulen
auch kommerziell verfügbar [7-16]. Bei diesem Verfahren wird die poröse Schicht
erzeugt, indem die Rohrwand mit einer Lage aus sehr feinen, porösen Teilchen
bedeckt wird. Das Aufbringen von Teilchen ist aber nicht die einzige Möglichkeit,
eine poröse Schicht zu erzeugen, auch andere Techniken sind in der Literatur be
schrieben [17-21].
Sicherlich ist aber die Herstellung dieser Säulen durch Bedeckung mit einer Schicht
und unter Verwendung einer Suspension aus porösen Teilchen sowie besonders durch
die Anwendung der sogenannten statischen Benetzungsmethode [ 16] der beste Weg,
um solche porösen Schichten reproduzierbar zu erzeugen.
In der englischen Literatur gibt es zwei Ausdrücke für Säulen mit einer porösen
Schicht. Der allgemeinere Ausdruck ist "porous-/ayer open tubular columns" oder
PLOT -Säulen, und dieser Ausdruck umfaßt alle diese Säulen, die eine poröse Schicht
2
enthalten-unabhängig vom Verfahren ihrer Herstellung und der Natur dieser
Schicht. Daneben verwendet man auch einen anderen Ausdruck, der sich dann aber
speziell auf solche Säulen bezieht, die durch Bedeckung ("coating") der inneren
Rohrwand mit einer Schicht aus feinen Teilchen eines Trägermaterials ("support")
hergestellt werden. Im Englischen bezeichnet man diese Säulen dann als "support
coated open tubular columns" oder SCOT-Säulen. Man kann zwar sagen, daß jede
SCOT-Säule unter den Begriff der PLOT-Säule fallt, daß aber umgekehrt nicht jede
PLOT-Säule eine SCOT-Säule ist.
In der deutschen Terminologie kennen wir keine entsprechenden Ausdrücke fiir
PLOT-und SCOT-Säulen und im allgemeinen werden alle PLOT-Säulen - unab
hängig von der Herstellungsmethode - als Dünnschichtkapillaren bezeichnet. In
dieser Schrift werden wir ebenfalls diesen Ausdruck anwenden. Es soll aber betont
werden, daß wir mit der Bezeichnung "Dünnschichtkapillare" immer eine SCOT
Säule meinen. Natürlich können manche Teile unserer Diskussion auch auf Dünn
schichtkapillaren übertragen werden, die durch andere Verfahren hergestellt wurden;
da sich unsere Erfahrungen aber auf SCOT-Säulen beschränken, möchten wir unsere
Betrachtungen nicht verallgemeinern.
Die Vorteile der Kapillarsäulen-sowohl der Dünnfllm- als auch der Dünnschicht
kapillaren - gegenüber den gepackten Säulen lassen sich folgendermaßen zusammen
fassen:
Sie bringen eine sehr viel bessere Trennung in gleicher oder kürzerer Zeit, oder
anders ausgedrückt, die gleiche Auflösung kann in sehr viel kürzerer Zeit erreicht
werden. Dünnschichtkapillaren haben gegenüber den Dünnfilmkapillaren noch den
Vorteil, daß die Probenkapazität größer ist, daß sie nicht so strenge Anforderungen
an die apparativen Voraussetzungen stellen und daß sie in vielen Fällen sogar
noch kürzere Analysenzeiten ermöglichen als die Dünnfllmkapillaren.
Der Zweck dieser Schrift besteht nun darin, die Vorteile der Kapillarsäulen, speziell
der Dünnschichtkapillaren zu zeigen, einige Fragen in Zusammenhang mit ihrer
Anwendung zu klären und ihre Leistungsfahigkeit an einigen Beispielen zu zeigen.
Zum besseren Verständnis müssen wir aber zuerst kurz einige theoretische Fragen
diskutieren.*)
*) Für eine ausführlichere Information sei auf allgemeine Lehrbücher über Gas-Chromatographie
verwiesen bzw. auf die beiden Bücher, die speziell Kapillarsäulen behandeln [22, 23 ).
3