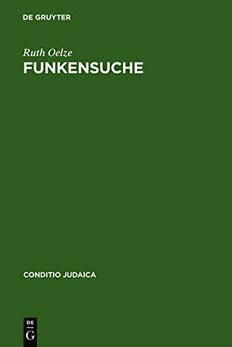Table Of ContentConditio Judaica 61
Studien und Quellen zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte
Herausgegeben von Hans Otto Horch
in Verbindung mit Alfred Bodenheimer, Mark H. Gelber und Jakob Hessing
Ruth Oelze
Funkensuche
Soma Morgensterns Midrasch
»Die Blutsäule« und der jüdisch-
theologische Diskurs über die Shoah
Max Niemeyer Verlag
Tübingen 2006
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 13: 978-3-484-65161-6 ISBN 10: 3-484-65161-X ISSN 0941-5866
(Ö Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2006
Ein Unternehmen der K. G. Saur Verlag GmbH, München
http://mrw.memeyer.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: Laupp & Goebel GmbH, Nehren
Einband: Industriebuchbinderei Nädele, Nehren
Inhalt
1 »Funkensuche« nach der Shoah 1
1.1 Soma Morgensterns Leben und Werk 8
1.2 Morgenstern als deutsch-jüdischer Schriftsteller 19
2 Exilliteratur 25
2.1 Flucht in Frankreich 32
2.2 Morgenstern und der deutschsprachige Literaturmarkt 36
3 Shoahliteratur 43
3.1 »Wo nur finden die Worte ...« 53
3.2 Sprachlosigkeit und Sprachbewältigung 59
4 Zachor! Geschichtsbewußtsein im Judentum 71
4.1 Theologie und Literatur nach Auschwitz 75
4.2 Die chassidische Mystik bei Morgenstern 90
4.3 Das Opferverständnis in Die Blutsäule 97
5 Die Gerichtsverhandlung 105
5.1 Die Geschichte des Toraschreibers 124
5.2 Mechzio 131
5.3 Die Zöllner 140
5.4 Der Schuldspruch gegen Europa 145
6 Exodus — Shoah — Erlösung 155
7 Schlußbemerkung 167
8 Literaturverzeichnis 171
9 Danksagung 185
10 Personenregister 187
1 »Funkensuche« nach der Shoah
Das ist unser letztes Blut, das ist unser letztes
Gebet, das ist unser letztes Wort, das ist unser
letztes Aufgebot. Mehr haben wir nicht.1
Die Shoah als finales Martyrium, die Millionen Toten als Opfer für den Beginn
der Erlösung: das ist Soma Morgensterns verzweifelte messianische Interpreta-
tion der Vernichtung der europäischen Juden. Die Blutsäule. Zeichen und Wun-
der am Sereth ist die Sinnsuche eines Gläubigen, ist Klage und Anklage und
die feierliche Begrüßung des Staates Israel als Hoffnungsschimmer, als »Fun-
ke im Abgrund«2 des jüdischen Leids.
Morgenstern wollte und mußte ein »Totenbuch« schreiben, er begann die
Arbeit unmittelbar nach Kriegsende im amerikanischen Exil, quälte sich über
Jahre mit seiner Sprach- und Schreiblähmung und vollendete das Werk
schließlich 1953 nach einem Israel-Aufenthalt. Entstanden ist ein »Midrasch«,3
ein in Inhalt und Erzählstruktur zutiefst in der jüdischen Kultur verwurzeltes
religiöses Bekenntnis - in deutscher Sprache. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte
sich der mehrsprachig aufgewachsene galizische Schriftsteller in seiner Kunst
für die »Sprache der Gebildeten«4 entschieden und behielt sie bei. Zwar be-
mühte er sich hier um eine ganz eigene Konstruktion in Anlehnung an die
Sprache der Bibel, doch blieb sie gleichzeitig die Sprache der »verhaßten«
Täter.5 Fünfzig Jahre nach seiner Entstehung bereichert dieses Werk die deut-
sche Shoahliteratur nun um eine besondere Facette.
Wie viele Exilanten ist Morgenstern nach der Vertreibung, dem Bruch in
der Biographie, auf der Suche nach seiner Identität, dies zeigen sowohl der
1 Soma Morgenstern: Die Blutsäule. Zeichen und Wunder am Sereth. Hg. von Ingolf
Schulte. Lüneburg: Zu Klampen 1997 (Werke in Einzelbänden), S. 144.
2 Dieser Ausdruck aus der chassidischen Mystik wird im folgenden erläutert.
3 Das hebräische Wort »Midrasch« bedeutet soviel wie »Auslegung« in Form einer
Geschichte. Abraham J. Heschel, amerikanischer Professor am Jewish Theological
Seminary und Förderer Morgensterns, sah eine solche in »Die Blutsäule« (vgl. Al-
fred Hoelzel: Soma Morgenstern. In: Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933. Hg.
von John M. Spalek und Josef Strelka. Bd 2, New York, Bern: Francke 1989 [Studi-
en zur deutschen Exilliteratur], S. 675).
4 Dies war die Meinung seines Vaters, der allen seinen Kindern Deutsch beibringen
ließ (vgl. Soma Morgenstern: In einer anderen Zeit. Jugendjahre in Ostgalizien. Hg.
von Ingolf Schulte. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag 1999, S. 86).
5 Vgl. Soma Morgenstern: Kritiken - Berichte - Tagebücher. Hg. von Ingolf Schulte.
Lüneburg: Zu Klampen 2001 (Werke in Einzelbänden), S. 648.
2 1. Die »Funkensuche« nach der Shoah
innere Kampf um die richtige Sprache und der letztlich gewählte Sprachstil als
auch der Inhalt. Halt findet er schließlich in der chassidischen Mystik und im
traditionellen Glauben, in dem er erzogen wurde. Nachdem er zuvor den Zio-
nismus als eine Anpassung der Juden an den Nationalismus der Völker emp-
fand,6 wendet er sich in Die Blutsäule von Europa ab und sieht in Israel die
alte und neue Heimat des jüdischen Volkes. Doch wirkt diese Sicht auf die
Geschichte stark konstruiert, und sein weiteres Leben und Schaffen zeigen,
daß ihm selbst ein solch radikaler Neuanfang nicht gelungen ist. Er beschäftigt
sich in den verbleibenden dreißig Jahren seines Lebens mit den Aufzeichnun-
gen seiner Erinnerungen an Europa und seine Freunde, und er schreibt weiter
auf Deutsch, obwohl keines seiner Werke im eigenen Sprachraum angemessen
gewürdigt oder publiziert wird.7 Er wandert nicht nach Israel aus, sondern wird
amerikanischer Staatsbürger und sieht die USA als neue Heimat an, doch gibt
sie ihm offensichtlich kaum eigene künstlerische Impulse. Er bleibt, so scheint
es, ein gebrochener Mensch und lernt, mit den Widersprüchen zu leben.
Die Begriffe Religion, Sprache und Identität miteinander in Beziehung zu
setzen, hilft bei der Annäherung an diesen befremdenden Roman. Denn nicht
nur in Morgensterns Gesamtwerk nimmt Die Blutsäule eine Sonderstellung
ein.8 Bei einem ersten Blick auf die bekannte deutsche Shoahliteratur läßt sich
kaum eine vergleichbare Deutung der Ermordung der europäischen Juden
finden. Das große »Kaddisch« für die Opfer der Shoah wirkt isoliert in der
Fülle der Literatur über den Judenmord, in einer Rezension heißt es sogar, daß
es »als ein Roman [...] die Kategorien des Genres [sprengt] und [...] sich in
seiner tiefen Religiosität der literarischen Kritik [entzieht]; es ist erhaben über
jede Ästhetik, da es zu sehr im Religiösen verwurzelt ist.«9
Die Bewertungsmaßstäbe und ästhetischen Ansprüche an Shoahliteratur10
sind von Anfang an diskutiert worden, und die »Darstellungsgebote« haben
6 Vgl. Soma Morgenstern: Joseph Roths Flucht und Ende. Erinnerungen. Hg. von Ingolf
Schulte. 2. Aufl., Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998, S. 35.
7 Aus dem amerikanischen Exil bemühte sich Morgenstern immer wieder um einen deut-
schen Verleger fur seine Werke. 1963 wurde schließlich eine gekürzte und bearbeitete
Version des letzten Teils der Trilogie unter dem Titel »Der verlorene Sohn« publiziert.
»Die Blutsäule« wurde 1964 vom österreichischen Hans Deutsch Verlag veröffent-
licht, jedoch, wie Ingolf Schulte feststellte, in einer »wenig sorgsamen Ausgabe« (vgl.
Ingolf Schulte: Nachwort des Herausgebers. In: Morgenstern, Die Blutsäule (Anm. 1),
S. 191. Auch weil sich der Verlag wenig einsetzte, blieb das Echo zurückhaltend.
8 Vgl. ebd., S. 175. Schulte, Wiederentdecker und sorgfältiger Herausgeber der Schriften
Soma Morgensterns, nennt »Die Blutsäule« das »wohl dichteste, das schwierigste und
das fremdeste unter seinen Werken«. Sowohl die Romantrilogie, die zwischen 1930
und 1943 entstand, als auch die fragmentarischen Erinnerungsberichte werden im fol-
genden kurz vorgestellt.
9 Ulrich Seiich: Totenbuch und Buch der Hoffnung. In: Handelsblatt, 30. Januar 1998.
10 Den Begriff Shoahliteratur verwende ich hier und im folgenden allgemein fur Litera-
tur, die die Shoah als zentrales Thema behandelt; als Oberbegriff umfaßt er also so-
wohl Zeugnisse von Überlebenden als auch fiktionale Texte von Zeitzeugen oder Nach-
1. Die »Funkensuche« nach der Shoah 3
sich in den letzten Jahrzehnten verändert, doch die zentralen Fragestellungen
bleiben: Wie verarbeitet man literarisch ein Ereignis, das so viele unschuldige
Opfer forderte, mit welchem Verständnis von Gott, vom Sinn des Lebens, vom
Gang der Menschheit lebt man weiter? Auschwitz ist
[...] nicht einfach ein Stück Geschichte [...], das in absehbarer Zeit in den Bereich
des Vergangenen abgehen könnte ... Es hat vielmehr mythische Qualität. Wie die
Sintflut, wie der Auszug aus Ägypten, wie Christi Tod - oder wie auch (in anderem
Maßstab) die Französische Revolution, wie für unsere Eltern und auf kurze Zeit
Verdun, wie auf hoffentlich lange Zeit Hiroshima. Und es überragt all diese anderen
Monumentalereignisse von mythischer Qualität um einiges.11
Nicht zufällig hat der Historiker Christian Meier biblische Ereignisse und Kata-
strophen aus der Geschichte des jüdischen Volkes zur Illustration zuerst ange-
führt. Diese Shoah unterscheidet sich deutlich von den anderen Diskriminierun-
gen, Verfolgungen und Pogromen, denen Juden in den letzten Jahrhunderten
immer wieder ausgesetzt waren. Die jüdische Katastrophe des 20. Jahrhunderts
bedrohte das »Volk der Geschichte« ganz existentiell - diesmal gab es nicht die
Möglichkeit der Taufe, keine Wahl, die das Überleben ermöglicht hätte. In einer
Kultur und Tradition, die sich hauptsächlich durch Erinnerung und Gedächtnis
definieren,12 wird die Frage nach dem Gedenken der Shoah und die Einordnung
des Genozids seit über fünfzig Jahren ganz elementar diskutiert. Die Literatur
kann sich freier als die Theologie mit der Frage nach der Deutung des Gesche-
hens beschäftigen, und da im Judentum Wissen und Erkenntnis schon immer in
Erzählungen, in der Schrift tradiert wurden, ist die besondere Bedeutung der
Shoahliteratur, auch für das Gottesbild, nicht zu unterschätzen. So steht für Ye-
rushalmi außer Zweifel, daß das Bild der Shoah »nicht am Amboß des Histori-
kers, sondern im Schmelztiegel des Romanciers geformt wird«.13
Doch was ist die angemessene Form des Schreibens über die Shoah? Die
vielfach postulierte Unverstehbarkeit des Geschehens hat im nachhinein zu der
von Meier angesprochenen Mythisierung geführt: Für das, was man nicht ver-
stehen kann, kann man auch keine angemessenen Worte finden. So ist eine Art
Konsens entstanden über die Unaussprechlichkeit11 dessen, was geschah. So-
geborenen. In die nähere Betrachtung kommen in dieser Arbeit allerdings nur Beiträge
jüdischer Autoren.
11 Christian Meier: Zur deutschen Geschichtserinnerung nach Auschwitz. In: Modern
Age - Modern Historian. In Memoriam György Ranki. Hg. von Ferenc Glatz. Buda-
pest: Institute of History of the Hungarian Acad, of Sciences 1990, S. 367-380, hier
S. 379.
12 Abraham I. Heschel definierte: »Glauben bedeutet: sich erinnern«, hier zit. nach
Christoph Münz: Der Welt ein Gedächtnis geben. Geschichtstheologisches Denken im
Judentum nach Auschwitz. 2. Aufl., Gütersloh: Kaiser 1996, S. 24.
13 Yosef Hayim Yerushalmi: Zachor: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches
Gedächtnis. Berlin: Wagenbach 1988, S. 104.
14 Hier muß man zwischen Opfer- und Täterliteratur unterscheiden, denn das Schweigen
auf der Täterseite hat eine ganz andere Bedeutung als in diesem Zusammenhang. Zur
Täterliteratur vgl. auch die Untersuchung von Ernestine Schlant: Die Sprache des
4 1. Die »Funkensuche« nach der Shoah
ma Morgensterns Schreiblähmung, die er in dem vorangestellten Motivenbe-
richt beschreibt, korrespondiert mit den uns bekannten Erfahrungen von
Schriftstellern und Dichtern wie Elie Wiesel, Paul Celan, Nelly Sachs und
anderen, die ebenfalls versuchten, das Unverstehbare in Worte fassen. Der fur
den oben zitierten Rezensenten so irritierende religiöse Bezugsrahmen von
Morgensterns Geschichte ist insofern direkte Folge der Konstanten von Unver-
stehbarkeit und Unaussprechlichkeit, Christoph Münz stellt fest:
Die epistemologische und hermeneutische Problematik dieses Postulats [...] wird
vornehmlich in ihrer Beziehung zum Problem der Sprache und des Schreibens über
den Holocaust zu bedenken sein. Von hier aus ergeben sich dann teilweise überra-
schende Bezüge zwischen der Unverstehbarkeit des Holocaust und der religiösen
Frage an ihn.15
Bei näherer Betrachtung wird deutlich, daß die Beschwörung einer transzen-
denten Ebene geradezu typisch ist fur Shoahliteratur. Und da Beschreibung
illustrieren muß, sind biblische Motive, Bilder aus der Zeit der Existenzgrö«-
dung, die sich anbietende Form des Gedenkens an ein existenzbedrohendes
Ereignis wie die Shoah. Dabei muß es sich keineswegs gleichzeitig um solch
starke Glaubensbekenntnisse handeln wie bei Morgenstern, so sei beispiels-
weise auf das verstärkte Auftreten des Hiob-Motivs in der Literatur über den
Judenmord hingewiesen: Das Hadern mit Gott, das In-Frage-stellen der göttli-
chen Gerechtigkeit hat Tradition und ist im Judentum Teil des Gesprächs mit
Gott. Denn, so Morgenstern, Juden sind immer Gläubige: »Even if he's an
atheist, he believes in atheism.«16 Läßt man also auch gebrochene Gottesbil-
der, biblische Metaphern und Anspielungen gelten, erscheint die im jüdischen
Glauben wurzelnde Aussage von Die Blutsäule zwar besonders radikal, aber
durchaus nicht einzigartig.
Im Verlauf dieser Arbeit werden der religiöse wie zeitgeschichtliche und li-
terarische Hintergrund von Morgensterns Werk aufgezeigt und in die bekann-
ten Diskurse zum Thema eingeordnet. Zunächst werden Soma Morgensterns
Leben und seine Werke vor und während seines lebenslänglichen Exils kurz
vorgestellt; dies wird hauptsächlich anhand seiner Erinnerungsschriften gesche-
hen. Da der Schwerpunkt dieser Untersuchung auf der spezifisch jüdischen
Interpretation der Shoah und den Bedingungen für das Schreiben über den
Judeozid liegt, folgt eine Betrachtung der Besonderheiten von Exilliteratur im
jüdischen Kontext.
1964 gelang es Morgenstern, nach langer Suche einen Verleger für Die
Blutsäule zu finden; warum das Werk damals kaum Beachtung fand und auf
welchen Leserkreis es damals stieß, soll in einem kurzen Abriß über die Re-
zeption von Shoahliteratur in Deutschland illustriert werden.
Schweigens. Die deutsche Literatur und der Holocaust. München: Beck 2001. Sie un-
terscheidet zwischen Be- und Verschweigen.
15 Münz, Der Welt ein Gedächtnis geben (Anm. 12), S. 28.
16 Israel Shenker: Morgenstern. In: Present Tense, 1 (1973/74) Nr 3, S. 6.