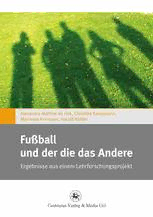Table Of ContentAlexandra de Hek, Christine Kampmann,
Marianne Kosmann, Harald Rüßler
Fußball und der die das Andere
Gender and Diversity
Herausgegeben von Prof. Dr. Marianne Kosmann, Prof. Dr. Katja Nowacki
und Prof. Dr. Ahmet Toprak, alle Fachhochschule Dortmund
Band 1
Alexandra de Hek, Christine Kampmann,
Marianne Kosmann, Harald Rüßler
Fußball und der die das Andere
Ergebnisse aus einem Lehrforschungsprojekt
Centaurus Verlag & Media UG
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86226-050-8 ISBN 978-3-86226-949-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-86226-949-5
ISSN 2192-2713
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der
Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch
Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbei-
tet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© CENTAURUS Verlag & Media KG, Freiburg 2011
Umschlaggestaltung: Jasmin Morgenthaler
Umschlagabbildung: 463640 RKB by Rainer Sturm, www. pixelio.de
Satz: Vorlage des Autoren
Inhalt
Marianne Kosmann/Harald Rüßler
Einleitung 6
Christine Kampmann
Fußballerinnen – Frauen in einer Männerdomäne 10
Alexandra Martine de Hek
Homophobie im Fußballsport 68
Alexandra Martine de Hek/Christine Kampmann/
Marianne Kosmann/Harald Rüßler
Fußballsport, Rechtsextremismus und die Konstruktion des Anderen 122
5
Einleitung
In seinem Vortrag über Rechtsextremismus im Fußball, den der Fanforscher Gunter
Pilz 2009 an der Fachhochschule Dortmund hielt, erinnerte er an die Szene in einem
der Derbyspiele zwischen Dortmund und Schalke, in der Torwart Weidenfeller vom
BVB den Schalker Stürmer Asamoah als schwarze Sau tituliert haben soll. Darauf-
hin angezeigt, gab Weidenfeller an, statt schwarze Sau, du schwule Sau gesagt zu
haben. Dafür bekam er einige Spielsperren als Strafe.
Nach den Regeln des DFB wäre die Beleidigung als schwarze Sau stärker sank-
tioniert worden.
Was zeigt dieses Beispiel?
Rassismus und Homophobie sind dem Fußball genauso wenig fremd wie anderen
Teilen der Gesellschaft. Die im letzten Jahr massenmedial aufbereitete Debatte um
scheinbar fehlgelaufene ‚Multikultikonzepte‘, durchaus in Absetzung zum so eupho-
risch aufgenommenen Auftreten der bunten, multikulturellen Fußballnationalmann-
schaft, die im Sommer 2010 mit schönen Bildern beworben wurde, zeigt, dass die
Auseinandersetzungen um Integration in einer Einwanderungsgesellschaft wieder
einmal fortgesetzt werden.
Das Beispiel der inkriminierten Äußerung zeigt ferner, dass es Abstufungen dazu
gibt, was als verpönter gilt und was als weniger schlimm. Doch in der Wertigkeit scheint
eine Akzeptanz der Insultation auf, wie Lützenkirchen (2009: 4) völlig zu Recht kons-
tatiert: „Wenn aber die eine Beleidigung weniger schlimm sein soll als die andere, dann
ist diese schon halb gerechtfertigt.“
Solche und andere Denkweisen und Beleidigungen gehören zum Fußball; ob
sie sein Wesen konstituieren, kann hier nicht entschieden werden. Ihre Basis sind
Ungleichwertigkeitsvorstellungen; diese werden in nicht wenigen sozialwissen-
schaftlichen Begriffsbestimmungen als ein Bestandteil des Rechtsextremismus
benannt.
Fußball ist für uns, Lehrende und Absolventinnen an einer Fachhochschule für
Soziale Arbeit, auch deshalb ein wichtiges Untersuchungsfeld, weil er zu einem
sehr bedeutsamen Erscheinungsort rechtsextremer Gruppen geworden ist. Seit den
70ern des vergangenen Jahrhunderts nutzen rechtsextreme Gruppen und Fanclubs
die Spiele der Bundesligavereine für rassistische und rechtsextreme Pöbeleien und
Angriffe. Neorechte und nationalistische Gruppierungen wollten und wollen weiter-
hin die enorme gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs für ihre Zwecke nutzen.
Das konnte relativ erfolgreich durch sehr unterschiedliche Initiativen eingedämmt
werden, wobei sowohl die institutionelle Sicherheit als auch die finanzielle Förde-
rung dieser Initiativen und Projekte immer in Frage steht.
So bleibt das Thema Fußball und Rechtsextremismus ein drängendes gesellschaft-
liches Problem.
6
Die herausragende gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs trägt zu dieser Konstel-
lation bei, Fußball- und Fanforscher wie Gunter Pilz, Almut Sülze und andere fragen
jedoch auch danach, inwieweit fußballimmanente Faktoren zu dieser zweifelhaften
Attraktivität beitragen. Gibt es Mechanismen im Fußballsport, die eine besondere
Affinität oder Begünstigung des Rechtsextremismus befördern- oder verhindern?
Dazu könnte insbesondere das Thema der Zugehörigkeiten zählen.
Denn in der Tat, ob massenmedial inszeniert oder auf dem kleinen holprigen Dorf-
acker, Fußball ermöglicht immer die Inszenierungen von Zugehörigkeiten (Görling/
Trinkaus 2008:9). Ob diese enger oder weiter sind, wie stark sie inszeniert werden,
ist hier nicht so sehr von Belang wie die Frage, wer denn über Zugehörigkeiten ent-
scheidet, nicht nur zu der jeweiligen Mannschaft oder dem Team, sondern wer zum
Fußball gehört. Das geht einher mit der altbekannten Behauptung, dass Fußball ein
Männersport sei, also scheinbar eine Männerenklave, ein Männerreservat ist, einher-
gehend mit der im- oder auch expliziten Festlegung, dass mit Männern die weißen,
nichtbehinderten, heterosexuellen Männer gemeint sind, wobei weiß (in Deutsch-
land) immer noch für deutsch bzw. assimiliert im Sinne einer an Homogenität orien-
tierten Leitkultur steht.
Der deutsche Fußballsport ist männlich, ungeachtet der größeren Erfolge des
Frauennationalteams und ungeachtet einer durchaus erklecklichen und stetig wach-
senden Anzahl von Fußballerinnen, Zuschauerinnen, weiblichen Fans sowie von
Trainerinnen und Schiedsrichterinnen. Woher also diese immer wieder vorgetragene
Ausschlussbehauptung, Fußball sei ein Männersport, der eben auch ganze Männer
(was immer das auch sei) erfordert?
Diese Fragestellungen werden in den folgenden Aufsätzen aufgegriffen:
Im ersten Aufsatz von Christine Kampmann geht es um verschiedene Generati-
onen im Frauenfußball. Wie haben Frauen vor 50 Jahren ihren seinerzeitigen Aus-
schluss aus dem Spielbetrieb erlebt, wie haben jüngere Fußballerinnen an den im
Zuge der Modernisierung von Gesellschaft realisierten oder erkämpften Veränderun-
gen partizipiert, und wo zeigen sich Beharrungstendenzen, die Frauenfußball stets
als (Frauen-)Fußball sehen lassen? Es ist der andere Fussball, nicht etwa der Fuß-
ball der Nationalelf oder der Bundesliga-Fußball, die beide grundsätzlich männlich
konnotiert sind. Wie sind jüngere Frauen damit umgegangen oder gehen damit um?
Kampmann interviewte Frauen aus drei Fußballgenerationen, um diesen Fragen an
Einzelfällen nachgehen zu können. Die Deutung dieser Aussagen geschieht vor der
Folie der komprimiert referierten Positionen der Geschlechterforschung, die sich u.a.
intensiv mit der Konstruktion von Geschlecht befasst. Kampmann untersucht den
Sport als ein besonderes Feld für diese Konstruktionen, da es im Unterschied zu den
mittlerweile aufgelösten geschlechtergetrennten Bereichen Schule, Freizeit sowie
großen Teilen der Berufswelt in den meisten Sportarten eine Geschlechtertrennung
gibt, mit einem im Vergleich zum Frauensport höher angesiedelten Männersport.
7
Kampmann verfolgt die Fragestellung, ob und inwieweit Frauen in dem immer wie-
der noch als Männersport ausgegebenen Fußball einen Freiraum für Geschlechterrol-
len erleben können. Zum einen kann sie das in ihren Fallbeispielen aufzeigen; zum
anderen aber, so in ihrem Schlusswort, zeigen die Erfahrungen, die den Interviews
zugrunde liegen, dass geschlechtliche Zuschreibungen größtenteils gesellschaftlich
konstruiert sind.
Im Beitrag von Alexandra Martine de Hek geht es um den faktischen oder ge-
danklichen Ausschluss einer anderen Gruppe. De Hek befasst sich mit den ‚anderen
Männern‘, mit der untergeordneten Männlichkeit (Connell 1999) im Fußballsport,
unter dem Thema der Homophobie im Fußball. Sie untersucht, wie die Homophobie
im (Männer-) Fußball erklärt werden kann und vor allem, wie homosexuelle Fuß-
baller damit umgehen. Dabei referiert sie das Konzept der hegemonialen Männlich-
keit von Connell und übertragt seine Männlichkeitstypen gewissermaßen auf das
Fußballfeld. Anhand von Einzelfällen und Untersuchungsergebnissen gibt sie einen
Überblick zur Lage homosexueller Fußballspieler. In einer Umfrage erhob sie die
Umgangsweisen der Fußballbundesligavereine und fragte nach möglichen Gegen-
strategien angesichts der weit verbreiteten Homophobie auf den Rängen und in den
Kabinen. Die Frage, ob das Thema im Frauenfußball wesentlich anders gehandhabt
wird, bezieht sie in ihre Ausführungen ein. Mit Blick auf die von ihr präsentierten,
teilweise ermutigenden Gegenstrategien, teilweise erschreckenden Erfahrungen ho-
mosexueller Männer folgert sie ein erforderliches Umdenken sowohl bezogen auf
die weiterhin herrschenden Vorstellungen von Männlichkeit als auch auf die starke
Verankerung der „kulturellen Logik des Fußballs“, ähnlich wie beim durchaus auf-
genommen Kampf gegen den Rassismus im Fußball.
Den Zusammenhang zwischen dem Rechtsextremismus, dem Fußball und Aus-
grenzungs- oder Ausschließungsstrategien durch die Konstruktion des Anderen un-
tersuchte ein Lehrforschungsprojekt, das über zwei Jahre an der Fachhochschule
Dortmund durchgeführt wurde. Mit Spielbeobachtungen und Experteninterviews
wurde die zunächst verfolgte Forschungsfrage nach rechtsextremistischen Phäno-
men im Amateurfußball ausgeweitet auf die Frage nach solchen Ausschlüssen, Ab-
und Ausgrenzungen, die in das Vorfeld rechtsextremer Einstellungen gehören. Ver-
einsvorsitzende, Trainer, Spieler und andere geben Einblicke in Denkweisen, die
zwischen traditionsverhaftet und reaktionär changieren, mit durchaus vorfindbarer
latenter schleichender Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit, bisweilen einherge-
hend mit deutlichem Sexismus, bei gleichzeitig beeindruckendem Einsatz für den
Sport, für die Jugendarbeit und auch für ihre jeweiligen Gemeinden.
Folie für diese Haltungen scheinen uns die Konstruktionen zu sein, mit denen
„die Türken“, „die Russen“, „die Frauen“ usw. als die anderen konstruiert werden,
es werden Bilder erzeugt oder ausgetauscht, die es erlauben, sich auf dem Feld als
selbstverständlich gesetzt zu betrachten. Diesen Mechanismen wollten wir in dem
8
Forschungsprojekt nachgehen.
Aus den drei Beiträgen ergibt sich der Titel unseres Sammelbandes in der Reihe
Gender und Diversity:
1. Fußball und der Andere, hauptsächlich als anders erlebte und/oder
konstruierte Männer, im Kontext von Ethnizität und sexueller Prä-
ferenz.
2. Fußball und die Andere, Frauen und ihre Bilder im Männerfußball,
Frauen als Fußballerinnen, auf einem zunehmend weniger abge-
schlossenen Territorium.
3. Fußball und das Andere, das scheinbar nicht eigene, das als anders,
das als fremd Erlebte.
Marianne Kosmann
Harald Rüßler
Dortmund, im Januar 2011
Literatur
Görling, Reinhold/Trinkaus, Stephan (2008) Milieu, Zugehörigkeit und kulturelles Ver-
mögen, Vortragsmanuskript zur Veranstaltung Kulturelle Vielfalt: erforschen, erleben,
verstehen, Düsseldorf, Landtag NRW, 30.6.2008, http://www.interkulturpro.de/ik_pdf/
goerling_trinkaus.pdf [21.01.11]
Lützenkirchen, H.-Georg (2009) Rassistische Erscheinungsformen im Fußball und Ge-
genstrategien, Neuwied, http://www.mynetcologne.de/~nc-luetzeh/Neuwied-vortrag-
2009.pdf [21.01.11]
9