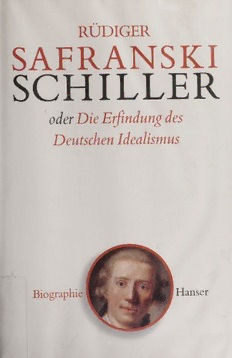Table Of ContentRÜDIGER
SAFRANSKI
SCHILLER
Die Erfindung des
oder
Deutschen Idealismus
t
y
Hanser
Biographie
«
Vielleicht haben ihn die Studienräte des
19. und 20. Jahrhunderts auf dem Ge-
wissen, mit lustlosem Auswendiglernen
und stupidem Interpretieren geflügelter
Worte. Dabei ist Friedrich Schiller (1759-
1805) eine der schwungvollsten Gestalten
unserer Literatur. Während in der Metro-
pole Paris die Revolution tobte, revolutio-
nierte er zuerst in Stuttgart und dann in
Jena und Weimar die deutsche Geistes-
geschichte. Sein Enthusiasmus wirkte an-
steckend, daher seine Begabung für die
Freundschaften, daher sein Charisma. Was
Schiller in Schwung brachte - sogar Goe-
the ließ sich mitreißen -, hat man später
den »Deutschen Idealismus« genannt, und
Beethoven hat es in Töne gesetzt: »Freude,
schöner Götterfunken
. . .
Dieses Buch erneuert die abgerissene Ver-
bindung zu einem Genie. Rüdiger Sa-
franski schildert Schillers Leben von den
bedrückenden Anfängen in der Stuttgarter
Karlsschule bis zu den letzten Jahren in
Weimar, als er dem hinfälligen Körper mit
ungebrochener Willenskraft sein Spät-
werk abringt. Er erzählt, wie Schiller (zu-
sammen mit Goethe) über ein Jahrzehnt,
zwischen 1790 und 1805, zum Zentral-
gestirn des deutschen Geisteslebens wer-
den konnte. Alle sind auf der Bühne ver-
sammelt: Novalis, Hölderlin, Schelling,
die Brüder Schlegel, Fichte, der junge
Hegel, Tieck, Brentano. Mit diesem Buch
über Leben, Werk und Epoche eines gro-
ßen Geistes könnte Schillers Renaissance
beginnen.
Boston ^uSCic LiSraiy
Qiß^oftfic
Qoetfie-Institut
Digitized by the Internet Archive
2016
in
https://archive.org/details/friedrichschilleOOsafr
Sl
ISI
Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget.
Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, riefer zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle.
Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich.
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Rüdiger
Safranski
Friedrich Schiller
oder
Die
Erfhidut\^ des
Deutschen Idealismus
Carl Hanser Verlag
Für Gisela Maria Nicklaus,
die sich dieses Buch gewünscht hat
2345
08 07 06 05 04
ISBN 3-446-20548-9
Alle Rechte Vorbehalten
©
2004 Carl Hanser Verlag München Wien
Satz; Fotosatz Reinhard Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Gennany
1
Inhaltsübersicht
Prolog
1
Erstes Kapitel
Herkommen Der sagenhafte Vetter. Abenteuer des Vaters. Die Idylle von Lorch.
.
Der Stock. Den Vater achten und überbieten. Der Mutter Leid. Rokoko in
Ludun^sbur^. Lebens^aloppade des Herzoy^s. »Bist du närrisch (geworden, Fritz?«
i6
Zweites Kapitel
Väterliche und mütterliche Frömm{(fkeit. Der kleine Prediger. Karlsschule. Der
Herzog erzieht. Der Knabe und die Macht. Schaiffenstein: der ideale und der
wirkliche Freund. Klopstock. Schillers erste Gedichte: Lesefrüchte. Den Träumen
derJugend treu.
30
Drittes Kapitel
DasJahr 1776. Veränderungen des Ortes und der Zeit. Der Geist des Sturm
und Drang. Herder und die Folgen. EineJahresfeier an der Karlsschule.
Diegroße Ermunterung: Abels Rede über das Genie. Shakespeare lesen.
44
Viertes Kapitel
Popularphilosophie. Die anthropologische Wende. Die Karriere des Empirismus.
Im »Audienzsaal des Geistes« das Leben zur Sprache bringen: Shaftesbury,
Rousseau, Herder. Schiller zwischen den Fronten. Schiller lernt bei Ferguson
und Garve: »Das Haupt ist nichtgeöffnet worden«.
61
Fünftes Kapitel
Efitscheidun^ für die Medizin. Über den Grenzverkehr zwischen Körper und
Seele. Schillers Dissertationen. Das kosmische Mandat der Liehe. Die »^roße
Kette der Wesen«. Rätselhafter Übergang von Materie in Geist. Neurophysiolo-
gische Irrgänge. Wie frei'i^ das Gehirn? Der Lichtstrahl derAufmerksamkeit.
Trübe Stimmungen. Affäre Grammont. Streicher sieht Schiller.
78
Sechstes Kapitel
Schillers Rückblick aufdie »Räuber«-Zeit. Schuhart der Märtyrer.
Empörung und Eifahrungsarmut. Räuberwelten und »Die Räuber«:
Experimentalanordnung fürphilosophische Ideen und extreme Gharaktere.
Ideen-Theater undAffekterregungskunst. Auch die Schönheit muß sterben.
GlücklicheAugenblicke unter dem Theaterhimmel.
100
Siebtes Kapitel
Als Militärarzt in Stuttgart. Verzweifelte Kraftmeierei. Die poetische und
die wirkliche Laura. Schwäbische Literatuffehde. Aufführung der »Räuber«.
Stuttgarter Misere. Flucht nach Mannheim.
121
Achtes Kapitel
Mannheim. Das neue D’hen. Ermutigung zum Mut. Mißlungene Lesung des
»Fiesko«. Enthusiasmus und Kälte. Entstehung des Stückes. Maskenspiele der
Verschwörung. Offenes Ende. Utworhersehbarkeit der Freiheit. Flucht aus
Mannheim. Verzweißung in Frankfurt. Oggersheim. Streicher spielt Klavier.
Aufdem Weg nach Bauerbach.
142
Neuntes Kapitel
Freundschaft mit Reinwald. Vexierbriefe. Werben um Gharlotte von Wolzogen.
Rückruf nach Mannheim. »Kabale und Liebe«. Die Liebesphilosophie aufdem
Prüfstand. Die soziale Maschine des Bösen.
162
6