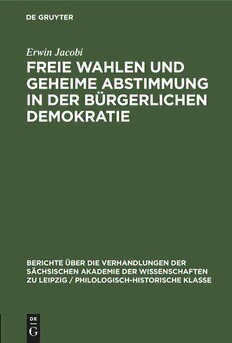Table Of ContentBERICHTE ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER SÄCHSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG
Philologisch- historische Klasse
Band, 103 • Heft 1
ERWIN JACOBI
FREIE WAHLEN
UND GEHEIME ABSTIMMUNG
IN DER BÜRGERLICHEN
DEMOKRATIE
A K A D E M I E - V E R L A G • B E R L IN
19 5 8
Vorgetragen in der Sitzung vom 23. Januar 1956
Manuskript eingeliefert am 21. Juni 1956
Druckfertig erklärt am 3. Dezember 1957
Erschienen im Akademie-Verlag GmbH., Berlin W 8, Mohrenstraße 39
Lizenz-Nr. 202 • 100/425/57
Satz und Druck der Buchdruckerei F. Mitzlaff KG., Rudolstadt/Thür. V/14/7 (910>
Bestell- und Verlagsnummer 2026/103/1
Preis: DM 2,50
Printed in Germany
Freie Wahlen und geheime Abstimmung sind heute in der
bürgerlichen Demokratie allgemein anerkannte Grundsätze für
die Wahl der Volksvertretung als des höchsten Staatsorgans,
das den Willen des souveränen Volkes zum Ausdruck bringen
soll. Geheime Abstimmung wird dahin verstanden, daß der
Inhalt der vom Stimmberechtigten abgegebenen Stimme gegen-
über jedermann geheim bleiben muß, damit nicht von irgend-
einer Seite der Stimmberechtigte beeinflußt werden kann an-
ders abzustimmen, als seinem wahren Willen entspricht. Ge-
rade dadurch soll die „freie Wahl" des Parlaments gewährleistet
und der wirkliche Wille des Volkes erfaßt werden.
Freilich ist längst erkannt, daß diesem Ziel andere Erschei-
nungen der bürgerlichen Demokratie entgegenwirken. In einem
Großstaat mit mehreren politischen Parteien kann der ein-
zelne Wähler praktisch nicht die Person wählen, die er wirklich
als Volksvertreter will, sondern er ist auf die Kandidaten an-
gewiesen, die die verschiedenen Parteien präsentieren, er hat
sich also nur zwischen diesen Parteien zu entscheiden, denn
bei der Kandidatenaufstellung ist der Einfluß des einzelnen
Wählers angesichts der Macht der Parteiapparate gering, trotz
aller gesetzgeberischen Experimente, wie sie in dieser Hin-
sicht namentlich in den USA durch die primary-laws gemacht
werden. Dazu kommen Bestimmungen der Wahlgesetze, wie die
bekannten Prozentklauseln, die eine Stimmabgabe für die Kan-
didaten kleinerer oder örtlich nicht massierter Parteien aus-
sichtslos machen. Vielleicht werden sogar bestimmte politische
Parteien verboten, so daß der Wähler aus diesem Grunde
nicht in der Lage ist, seine Stimme dem zu geben, den er wirk-
lich wählen möchte.
Vor allem aber ist die geistige Beeinflussung der Wähler durch
die Macht der Propaganda zu bedenken; hier wählt der „legal"
4 ERWIN JACOBI
bearbeitete Wähler zwar scheinbar den Kandidaten, den er
wählen will, in Wahrheit aber den, den er wählen soll, so daß
es dann zu Erscheinungen wie der „legalen" Machtübernahme
Hitlers kommt.
Auf alles das kann hier nicht eingegangen werden, auch
nicht auf die von der Parlamentswahl der bürgerlichen Demo-
kratie völlig verschiedene Wahl der Volksvertreter in der DDR.
Unser Thema ist nur die bürgerliche Demokratie und hier nur
die formale Frage der freien Wahlen und der geheimen Abstim-
mung. Es soll dargetan werden, daß in der bürgerlichen Demo-
kratie die Verbindung von „freier Wahl" und „geheimem
Stimmrecht" nicht immer bestanden hat, sondern daß in bür-
gerlichen Demokratien zum Teil jahrhundertelang „freie Parla-
mentswahlen" mit „öffentlicher Abstimmung" anerkannt wor-
den sind; die Entwicklung der bürgerlichen Demokratie soll
aufgezeigt werden von der freien WTahl mit offener Stimmge-
bung zur freien Wahl mit geheimer Abstimmung bis zu deren
letzter Konsequenz, der Unzulässigkeit eines Verzichts auf das
Abstimmungsgeheimnis. Dabei muß es für einen Vortrag ge-
nügen, im wesentlichen auf die Rechtsquellen der verschiedenen
bürgerlichen Demokratien in den verschiedenen Zeiten zurück-
zugehen; die historischen und politischen Hintergründe können
nur ausnahmsweise berührt werden.
I
Im Mutterland des Parlamentarismus, dem Königreich
England, werden von König Johann in der Carta von 1214
(Statutes of the realm Bd. 1, Charters of liberties, p. 5) der
englischen Kirche „freie Wahlen" zugesichert:
„ut de cetero in universis et singulis ecclesiis et nionasteriis cathe-
dralibus et conventualibus tooius regni nostri Anglie liberae sint in
perpetuum electiones quoruirummque prelatorum maiorum et minorum."
Ein Jahr später wiederholt die Magna Carta desselben Königs
vom 15. Juni 1215 (Statutes of the realm, Vol. I, Chartres of
liberties, p. 9):
Freie Wahlen und geheime Abstimmung 5
„quod libertatem electionum . . . ecclesiae Anglicanae . . . coneessimus
et carta nostra confirmavivus ..."
Mit diesen freien Wahlen wird die englische Kirche vor Ein-
griffen des Königs in die kanonische Wahl der Geistlichen
sichergestellt; es handelt sich hier nm die Freiheit der eng-
lischen Kirche entsprechend dem — allerdings in einer jüngeren
Handschrift beigefügten — Untertitel der Magna Carta: „Con-
cordia inter Regem Johannem et barones pro concessione
libertatum ecclesie et regni Angelte."
Die neben den Freiheiten der Kirche in der Magna Carta
konzedierten Freiheiten des regnum Anglie, d. h. der Großen
des Reiches, wirkten sich aus in dem Commune Consilium der
Barone, das durch Zuziehung des niederen grundbesitzenden
Adels und der Städte im 13. Jahrhundert zum Parlament er-
weitert und im 14. Jahrhundert in das House of Lords und
das House of Commons mit zwei Vertretern des niederen Adels
aus jeder Grafschaft und zwei Bürgern aus jeder Stadt getrennt
wurde. In den Grafschaften setzte sich 1419 an Stelle der
ursprünglichen einfachen Akklamation der Bürger zu den zwei
Vertretern des niederen Adels die Wahl dieser Parlaments-
mitglieder nach Mehrheitsprinzip durch. Sie vollzog sich folgen-
dermaßen : Die Kandidaten wurden in öffentlicher Grafschafts-
versammlung von Stimmberechtigten vorgeschlagen und stellten
sich persönlich mit einer Ansprache den Wählern vor; dann
wurde zunächst formlos durch Handaufheben abgestimmt; er-
gab sich hierbei keine zweifellose Mehrheit, so erfolgte mündliche
Einzelabstimmung vor einem besonderen Schreiber (poll clerc).
Dieses öffentliche Bekenntnis zum Inhalt der Abstimmung, da-
mals wegen der vielen des Lesens und Schreibens unkundigen
Bürger naheliegend, hat sich in England durch die Jahrhunderte
erhalten, auch über die englische Revolution des 17. Jahrhun-
derts hinaus. Das agreement of the fteofile vom 28. Oktober 16471)
Abgedruckt bei Gardiner, History of the great civil war, Bd. III, 1898,
S. 392; Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte,
4. Aufl. München und Leipzig 1927, S. 78.
6 Krwix Jacobi
verlangt zwar ausdrücklich (unter I und III), daß die Wahlen
der Abgeordneten des Volkes zum Parlament neugestaltet
werden sollen, spricht aber nicht von geheimen Wahlen. Mit
der Restauration der Stuarts 1660 werden die beiden Häuser
des alten Parlaments wiederhergestellt, und es bleibt bei dem
alten Parlamentswahlrecht mit offener Stimmabgabe. Als
dann 1688 das Parlament, in seinen beiden politischen Parteien
der Tories und der Whigs aus Vertretern der Kirche, des Grund-
besitzes und des Großbürgertums zusammengesetzt, die Stuarts
in der „Glorreichen Revolution" vertreibt und Wilhelm von
Oranien auf den englischen Thron beruft, legen die geistlichen
und weltlichen Lords und die Commons, versammelt in einer
„füll and free Representative of this nation", die Rechte und
Freiheiten der Untertanen (,,the rights and liberties of the
subjects") in einer „Declaration of Rights", einer Art Wahl-
kapitulation nieder, die von dem neuen Herrscher angenommen
und als „Bill of Rights" mit Gesetz I William and Mary Sess. 2
von 1689 (Statutes of the Realm, Vol. VI, p. 142) verkündet
wird. Durch diese Vereinbarung zwischen Parlament und
Krone werden in einem besonderen Abschnitt freie Parlaments-
wahlen grundsätzlich festgelegt:
„That election of members of Parlyament ought to be free."
Das Wahlverfahren bleibt aber gleichwohl für die Graf-
schaftswahlen unverändert das alte seit 1419 entwickelte mit
mündlichem, öffentlichem Bekenntnis des einzelnen Stimm-
berechtigten zum Inhalt seiner Abstimmung. Die „freie Parla-
mentswahl" in der bill of rights von 1689 richtet ihre Spitze
gegen die Krone; der König soll nicht wie in den Zeiten der
Tudors und Stuarts die Parlamentswahlen verhindern oder in
irgendeiner Weise in sie eingreifen; das zur Macht gelangende
Großbürgertum setzt der Staatsleitung Schranken; mit den
freien Wahlen werden der Regierung Pflichten auferlegt, nicht
subjektive Rechte des Bürgers begründet1). Freie Wahlen
1) So auch Georg Jellinek, a.a.O.
Freie Wahlen und geheime Abstimmung
sind noch auf fast zwei Jahrhunderte nicht mit geheimem
Stimmrecht verbunden.
Erst als im Laufe der Zeit der mehr oder weniger sports-
mäßig betriebene Wahlkampf zwischen den beiden in ihrer
klassenmäßigen Zusammensetzung nicht verschiedenen poli-
tischen Parteien sich verschärft, kommt es zu schweren Miß-
bräuchen der öffentlichen Stimmabgabe: Große Landlords
führen ihre Freisassen und Pächter wie Vieh zu den öffent-
lichen Abstimmungen1); kleine Ladenbesitzer und Handwerker
müssen den Kandidaten des benachbarten Großgrundbesitzers
wählen, um sich dessen Kundschaft zu erhalten; die Wähler
werden bestochen, bearbeitet, bewirtet und trunken zur Wahl
geschickt, und der Wahlvorgang selbst verläuft so, daß die
Vorstellung der Kandidaten auf der Bühne durch Blechmusik
und Trommeln der Gegenpartei unverständlich gemacht wird,
daß Backsteine, tote Katzen und faule Eier um die Kandidaten
fliegen und die Menge unten sich prügelt2), wie das in den
Pickwickiern von Dickens anschaulich geschildert ist. Erst
nachdem zu Ausgang des 18. Jahrhunderts durch die indu-
strielle Revolution in England und durch die Bauernenteignung
die Arbeiterklasse gewaltig angewachsen ist, wird von ihr und
dem gleichfalls vom Wahlrecht ausgeschlossenen Bürgertum
der Mittelklasse die Forderung nach Reform des Wahlrechts
zum Unterhaus in der Richtung zunächst auf das allgemeine,
schon bald aber auch auf das geheime Stimmrecht gestellt.
Jeremy Bentham (1748—1832) tritt für das geheime Stimm-
recht ein, im Gegensatz zu John Stuart Mill (1806—1873),
der das geheime Stimmrecht bekämpft. Die 1836 gegründete
Working Mens' Association arbeitet 1837 eine ,,peoples charter"
aus, in der allgemeines, gleiches, geheimes Wahlrecht gefor-
dert wird. Entsprechende Anträge, seitdem im Parlament
gestellt, bleiben zunächst erfolglos; aber nach dem Durchbruch
') de Franqueville, Gouvernment et parlament Britanniques, Bd. 2,
S. 417 ff.
a) Mac Carthie, History of our own times, Bd. IV, S. 137.
8 ERWIN JACOBI
des Liberalismus auf dem Kontinent konnte bei der Beratung
der Parlamentsreform von 1866 und 1867 nicht mehr zweifel-
haft sein, daß die Einführung der geheimen Abstimmung
nahe bevorstand1).
Mit der geheimen Abstimmung sollte die Unabhängigkeit der
Wähler vor Beeinflussungen aller Art gesichert, besonders der
wirtschaftlich Schwächere vor Druck durch den wirtschaftlich
Stärkeren geschützt und gleichzeitig der Wahlbestechung ein
Ende bereitet werden, weil bei geheimem Stimmrecht der
Stimmenkäufer nicht mehr kontrollieren kann, ob der Ver-
käufer seine Stimme wirklich in dem vereinbarten Sinne ab-
gibt; außerdem wollte man durch das geheime Stimmrecht
einen ruhigeren und würdigeren Verlauf der Wahlen sichern.
Im Jahre 1872 wurde dann die sog. englische Ballotbill unter
dem starken Druck der öffentlichen Meinung von beiden Häu-
sern des Parlaments angenommen. Der genaue Titel des Ge-
setzes lautet:
An act to amend the law relating to procedure at parliamentary
and municipal elections2).
Das Gesetz schreibt geheime Abstimmung vor und enthält
bereits die unter dem Namen des Australian ballot3) bekannten
Sicherungen gegen Verletzungen des Wahlgeheimnisses (amt-
liche Stimmzettel, Isolierraum zur Kennzeichnung des Ge-
wählten, Versiegelung der Wahlurne). Erst damit ist für Eng-
land die Verbindung von freien Wahlen und geheimem Stimm-
recht hergestellt worden, während bis dahin freie Wahlen der
Parlamentsmitglieder mit öffentlicher Stimmabgabe verbunden
waren.
II
Die englische Formel von der freien Wahl der Parlaments-
mitglieder ist aus der englischen declaration und bill of rights
') Georg Meyer, Das parlamentarische Wahlrecht. Berlin 1901, S. 545.
2) 35 und 36 Victoria c. 33.
3) Julius Hatschek, Allgemeines Staatsrecht II. Leipzig 1909, S. 63.
Wigmore, Australian Ballot System.
Freie Wahlen und geheime Abstimmung 9
von 1689 in das Recht der Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika übernommen worden.
Als die dreizehn Kolonien Englands in Nord-Amerika am
15. Mai 1776 vom Kongreß in Philadelphia aufgefordert wur-
den, sich Staatsverfassungen zu geben, gliederten sie diese fast
ausnahmslos in eine declaration oder bill of rights entsprechend
der englischen declaration oder bill of rights von 1689 und
in einen plan oder frame oder form of government. Die de-
claration oder bill of rights enthält regelmäßig auch den eng-
lischen Artikel über die freien Wahlen zum Parlament.
Vorbildlich war in dieser Beziehung die Virginia Bill of
Rights vom 12. Juni 1776:
„A declaration of rights made by the representatives of the good
people of Virginia, assembled in full and free convention; which rights
do pertain to them and their posterity, as the basis and foundation
of government."
Durch Section 6 dieser Bill of Rights wird in unverkenn-
barem Anschluß an die englische declaration oder bill of rights
von 1689 festgelegt:
„Thit elections of members to serve as representatives of the people
in assembly ought to be free."
Mit diesem Inhalt ist die Virginia Bill of Rights in die spä-
teren bills of rights der Verfassungen Virginiens von 1830
(Art. I), 1850, 1864, 1870 übernommen worden, nur daß seit
der Verfassung von 1850 ganz allgemein „freie Wahlen", nicht
nur freie Parlamentswahlen, festgelegt werden:
„That all elections ought to be free1)."
Wie Virginia haben viele nordamerikanische Einzelstaaten
die Formel von den freien Wahlen der Parlamentsmitglieder
oder von den freien Wahlen überhaupt in die declaration oder
bill of rights ihrer Verfassungsurkunden aufgenommen2). Dieses
Constitution of Virginia 1850, B. S. Poore. The Federal and State
Constitutions ... of the United States, Bd. II, S. 1919, Bill of rights VI.
2) Vgl. z. B. Verfassungen von Nord-Carolina 1776, 1868 und 1876; Penn-
sylvanien 1776, 1873; Vermont 1777, 1786, 1793; Massachusetts 1780; New
Hampshire 1784, 1792; Tennessee 1796, 1834, 1870; Missouri 1820, 1865,
1875; Nebraska 1875.
10 ERWIN JACOBI
Grundrecht der freien Wahlen richtet sich, wie in der eng-
lischen declaration of rights, in erster Linie gegen die Staats-
regierung. In der „Unabhängigkeitserklärung der dreizehn
Vereinigten Staaten von Amerika" vom 4. Juli 1776 wird aus-
geführt, wie in der Vergangenheit der englische König die
Wahlen beeinflußt habe: er habe versucht, die Bevölkerung
großer Bezirke zum Verzicht auf ihre Vertretung in der gesetz-
gebenden Körperschaft zu zwingen; er habe die Volksvertre-
tungen wiederholt ohne berechtigten Grund aufgelöst und es
dann lange Zeit abgelehnt, Neuwahlen anzuordnen. Solche
und ähnliche Beeinflussungen der Wahlen durch die Staats-
regierung sollen durch die verfassungsmäßige Gewährleistung
„freier Wahlen" ausgeschlossen werden. Vereinzelt wird mit
den freien Wahlen auch das Verbot der Korruption verbunden,
so in Vermont, Verfassung von 1786, Chapter I (declaration of
rights) unter IX:'
„That all elections ought to be free and without corruption."
Manche jüngeren Verfassungen erläutern dann den Begriff
der freien Wahlen durch Zusätze wie in der Verfassung Penn-
sylvaniens von 1873, Art. I (declaration of rights) sec. 5, und
fast wörtlich übereinstimmend in der Verfassung Missouris
von 1875, Art. II (bill of rights) sec. 9:
„Elections shall be free and no power, civil or military, shall at
any time interfere to prevent the free exercise of the right of suffrage."
Wird hier ausdrücklich jede Einmischung, sei es der Zivil-
oder der Militärgewalt, verworfen, die der freien Ausübung
des Stimmrechts entgegenstehen könnte, so erklärt die Ver-
fassung Nebraskas von 1875, Art. I (bill of rights) sec. 22, noch
allgemeiner:
„All elections shall be free; and there shall be no liinderance or
impediment to the right of a qualified voter to exercise the elective
franchise."
Solche Verfassungssätze über das Grundrecht der freien
Wahlen besagen aber noch nichts über die Frage offenes oder
geheimes Stimmrecht, selbst wenn das Grundrecht die Wahlen