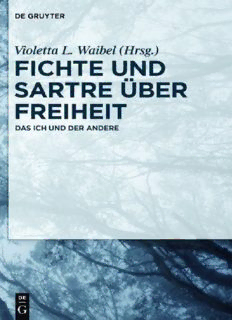Table Of ContentGedruckt mit Förderung der Universität Wien,
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft ISBN 978-3-
11041089-1
e-ISBN (EPUB) 9783110411096
e-ISBN (PDF) 978-3-11-041092-1
e-ISBN (EPUB) 978-3-11041109-6
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP
catalog record for this book has been applied for at the Library
of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
www.degruyter.com
Epub-production: Jouve, www.jouve.com
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Einleitung
Freiheit
Selbstheit
Andersheit
Teil I: Fichte und Sartre über Freiheit
Authenticity and Duty
1 Sartre on Authentic Freedom
2 Fichte
3 Conclusion
Freiheit in Situation – ein Paradoxon?
Wie frei sind wir wirklich?
1
2
3
4
5
6
7
Fichte and Sartre on Cartesian Freedom and
Rousseau’s Problem
1 An ordinary view of freedom
2 Freedom and subjectivity
3 The Cartesian subject and human freedom
4 Fichte on human freedom
5 Sartre, Descartes and human freedom
6 Conclusion: Fichte and Sartre on Cartesian
freedom and Rousseau’s problem
Teil II: Fichte und Sartre über Selbstheit
Fichte and Sartre
1
2
3
4
5
Vom Selbstverhältnis zum Selbstbewusstsein
Teil III: Fichte und Sartre über Andersheit
The Problem of Free Interaction (Wechselwirkung
durch Freiheit) in Fichte and Sartre
1 Sartre’s Initial Perspective: Looking/Looked-at
2 An Aesthetic Resolution of the Impasse of
Nonobjectifying Communication
3 A Social Ontological Solution to the Impasse
4 Additional Fichtean Anticipations
5 The Primacy of the Practical
6 Only indirect action is possible on another
freedom
7 Philosophical Use of the Imagination.
8 Free Interaction in Retrospect: The Individual and
the Social
There is No We
1 The Concept of Recognition in Fichte’s Jena
Writings
2 Sartre’s Appropriation and Critique of
Recognition
3 Concluding Remarks: Relation, Mechanism and
Teleology
Der Blick des Anderen, den Anderen erblicken
1 Fichtes Theorie der Freiheit Anderer und die Idee
der Erziehung zur Freiheit
2 Intersubjektive Akte des Sehens und Hörens
mittels zweier Organe und zweier Materien in
Fichtes Theorie
3 Wie erkennen Subjekte vernünftige
Aufforderungen? - Ein Rekonstruktionsversuch
4 Der Blick in Sartres Theorie vom Andern
5 Der Blick als Instanz des Normensetzens und das
Gewissen
6 Abschließende Bemerkungen
Ich ist ein/e Andere/r
1 Ich und der Andere
2 Die These Fichtes: Ich = Ich (A = A)
3 Der Mensch ist frei. Eine unstatthafte Abstraktion
4 Zwischenstück. Ich ist ein Anderer
5 Sartre. Ich ist ein Anderer (A = X)
Über die Autoren
Siglenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Sachregister
Namensregister
Viotetta L. Waibel
Einleitung
Die frappierende konzeptionelle Nähe von Fichte und Sartre ist
in der Forschungsliteratur wiederholt zum Thema geworden,
obwohl nicht belegt ist, und, von kleinen Hinweisen abgesehen,
kaum angenommen werden kann, dass Sartre ein besonders
eifriger Leser der Fichteschen Wissenschaftslehre gewesen
wäre. Bekanntlich sind die bedeutenden geistigen Wegmarken
für Sartre Hegel, Husserl und Heidegger. Hinzuzuzählen sind der
in Sartres Schriften allgegenwärtige Antipode Freud, aber auch
Descartes und Kant. Trotz der überragenden Bedeutung der
Freiheit für beide Denker ist sie für Fichte vor allem eine den
Menschen vor aller Kreatur auszeichnende Freiheit der
Sittlichkeit und der Selbstbestimmung, während Sartre den
Menschen unausweichlich in eine Freiheit und
Verantwortlichkeit geworfen und zu einer Freiheit verurteilt
sieht, die er trotz aller Auszeichnung durch die dem Denken
innewohnende Transzendenz aushalten und austragen muss.
Der spätere Sartre nimmt die Härte seiner Position etwas
zurück.
Fichte darf mit seiner Theorie der Anerkennung der Freiheit
des Anderen noch vor Hegel als der erste Theoretiker der
Intersubjektivität gelten, die er erstmals in seinem Naturrecht
von 1796/97 ausführt. Das Verhältnis zum Anderen reflektiert
Sartre hingegen in seinem berühmten Kapitel über den Blick (Le
Regard) in seiner Schrift Das Sein und das Nichts (L’Être et le
Néant) als ein Sein für den Anderen, das ihm in der
Grundstruktur zu einer wechselseitigen Beschämung und
Objektivierung gerät, gegen die es die Transzendenz der
eigenen Subjektivität zurückzugewinnen oder zu bewahren gilt.
Die Absolutheit der Subjektivität erfährt bei beiden Denkern
eine je eigene Dignität.
Im Hinblick auf heutige Debatten um die Fraglichkeit der
Freiheit ist es von großem Interesse, diese beiden emphatischen
Denker der Freiheit, Subjektivität und Andersheit in einen
wechselseitigen Dialog zu bringen. Diese Fragen wurden in
einem Kolloquium diskutiert, zu dem Peter Kampits und Violetta
L. Waibel eingeladen hatten, das am 18. und 19. März 2011 an
der Universität Wien stattfand und aus dem die Beiträge des
vorliegenden Bandes hervorgingen.
Wie kaum anders zu erwarten, konnte auch dieses Kolloquium
den spärlichen Hinweisen auf eine Rezeption Fichtes durch
Sartre nichts Weiteres hinzufügen. Gleichwohl war es ein
anregendes und lohnendes Unternehmen, die systematischen
Parallelen dieser beiden einerseits so ungleichen, wie in
manchen ihrer Inhalte andererseits einander so nahen Autoren
einer erneuten Untersuchung zu unterziehen. In diesem
Kolloquium begegneten einander Forscherinnen und Forscher,
die vorwiegend zu Fichte oder zu Sartre gearbeitet haben, wenn
sie nicht ohnehin Experten für beide Autoren sind. Das
ermöglichte einen fruchtbaren Gedankenaustausch und ein
Lernen voneinander. Gleichwohl kann es nicht überraschen,
dass die Resultate der hier versammelten Beiträge zuweilen
kontrovers sind, und bald Fichte, bald Sartre, manchmal auch
beide als Autoren gesehen werden, die auch für uns heute noch
bedenkenswerte Ansätze zu einer Philosophie der Freiheit zu
bieten haben.
Das Problem der Freiheit ist natürgemäß eng verknüpft mit
dem des Ich und des Anderen. Wenn die Beiträge dieses Bandes
den drei Kernthemen der Freiheit, der Selbstheit und der
Andersheit zugeordnet werden, so deshalb, weil die einzelnen
Beiträge eines dieser Themen vorwiegend behandeln.
Freiheit
Mit der Frage der Freiheit beschäftigten sich im Besonderen
Daniel Breazeale, Vincent von Wroblewsky, Peter Kampits und
Tom Rockmore.
Daniel Breazeale legt mit seinem Beitrag Authenticity and
Duty. Sartre and Fichte on Reflection and Choice zunächst eine
sehr detaillierte Analyse dessen vor, was für den früheren und
späteren Sartre Wahl, sowohl ursprüngliche Wahl als auch Wahl
im Lebensvollzug, bedeutet. Zudem werden ausführlich das
Verhältnis und der Übergang vom An-sich zum Für-sich
expliziert, wodurch die Urwahl zu einer bewusst entschiedenen,
reflektierten Tat wird. Freiheit als Endzweck des Daseins ist für
Sartre zwar keine abstrakte Norm, aber dennoch wohnt ihr eine
Universalität inne, da nur authentisches Handeln eine wahre
freie Wahl darstellt, wie Breazeale herausarbeitet. Später stelle
Sartre die Wichtigkeit der Haltung zu den gewählten
Handlungen heraus, die ein Subjekt zu einem moralisch
authentischen machen oder es in Unaufrichtigkeit verharren
lassen. Im Rückgang zu Fichte zeigen sich für Breazeale
zahlreiche systematische Übereinstimmungen, die nur bei
genauer Kenntnis der Konzeptionen erkennbar sind. Bei Fichte
lassen sich ebenso ein präreflexives und reflexives geistiges
Handeln entdecken. Breazeale betont im Hinblick auf das
System der Sittenlehre die große Wichtigkeit des theoretischen
Denkens eines Subjekts, in bestimmten Situationen aus der
vollen Einsicht in den Lebenszusammenhang zu entscheiden,
ein Vollzug, der im Kontext von Fichtes Anknüpfung an Kant
mehr an die reflektierende Urteilskraft in der Kritik der
Urteilskraft gemahnt als an dessen Moralphilosophie. Nicht nur
für Sartre, auch für Fichte ist Freiheit bei aller Einsicht in ihre
Struktur ein großes, in manchem der Erklärung sich
entziehendes Mysterium.
Vincent von Wroblewsky, der einige Werke Sartres übersetzt
hat, legt mit seinem Beitrag Freiheit in Situation - ein
Paradoxon? eine Untersuchung vor, die dem Wandel des
Begriffs der Freiheit von Sartres Anfängen bis in die späte Zeit
nachspürt. Wroblewsky sucht dabei zwei gängige Vorurteile
gegen Sartres Konzeption einer absoluten und radikalen Freiheit
zu entkräften, wonach diese sich entweder in Beliebigkeit
verliere oder mit den Jahren sehr verenge. Freiheit, so zeigt
sich, ist auch für Sartre mit moralischen Werten verbunden und
verstärkt sich deutlich in den späteren Konzeptionen.
Engagement, ein Zentralbegriff für Sartre, machte keinen Sinn,
würde dieses kein Wozu kennen. Das aber ist für Sartre kein
abstraktes Ideal, sondern etwas, das sich in der Situation ergibt.
Deutlich ist, dass für Sartre das Empirisch-Historische der
Situation mit den Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der
Mensch hat normativ bewertbare Verantwortung für sein
Handeln, aber diese erwächst aus der empirischen Situation, ein
Paradoxon, das den Kern von Sartres Freiheitskonzeption
ausmacht.
Peter Kampits fragt in seinem Beitrag Wie frei sind wir
wirklich? Sartre, Fichte und die Hirnforschung sind die
Gegenstände dieser Untersuchung, die zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Die Diskussion um den vielschichtigen,
komplexen und umstrittenen Begriff der Freiheit habe
neuerdings durch die These der Hirnforschung, unsere Freiheit
sei eine Illusion, eine neue Dimension angenommen. Das bringt
die beiden markantesten philosophischen Denker der Freiheit
des 19. und 20. Jahrhunderts, Fichte und Sartre, in den Blick,
deren systematische Nähe und Differenzen herausgearbeitet
werden. Freiheit ist für Sartre immer zugleich Intentionalität und
Wahl, die die konkreten Handlungen eines Subjekts leiten.
Freiheit ist auch bei Fichte Ausdruck des handelnden Subjekts,
das mit der Tathandlung seiner ursprünglichen Setzung die
Notwendigkeit und Verbindlichkeit seines Handelns verbürgt.
Kampits endet mit einer Frage: Verurteilt zu sein, dem
neuronalen Spiel der Hirnprozesse zu folgen (Singer), oder
verurteilt zu sein zur Freiheit, deren Grundlage das Ich nie sein
kann (Sartre), oder in seinem Philosophieren davon
abzuhängen, was für ein Mensch man ist (Fichte) – münden
nicht alle drei Aussagen letztlich in weitere Herausforderungen
und in Fragen nach dem Ursprung der Freiheit des Menschen?
Tom Rockmore schlägt mit seiner Untersuchung Fichte and
Sartre on Cartesian Freedom and Rousseau’s Problem einen
großen Bogen, um auf zahlreiche Aspekte des Begriffs der
Freiheit aufmerksam zu machen und an wichtige