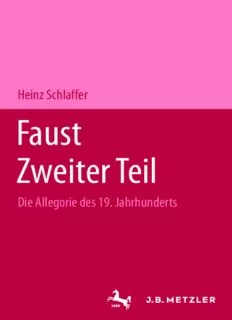Table Of ContentHeinz Schlaffer
Faust
Zweiter Teil
Die Allegorie des 19. Jahrhunderts
FAUST ZWEITERTElL
HEINZ SCHLAFFER
FAUST ZWEITER TElL
Die Allegorie
des 19. Jahrhunderts
j. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
Stuttgart
CIP-Kurztitelaufnahmeder Deutschen Bibliothek
Schlaffer,Heinz:
Faust ZweiterTeil: d. Allegoried. 19.Jh. /
Heinz Schlaffer.- Stuttgart: Metzler, 1981.
ISBN978-3-476-00462-8
ISBN978-3-476-00462-8
ISBN978-3-476-03145-7(eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-03145-7
© Springer-VerlagGmbHDeutschland
Ursprünglich erschienen bei J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
undCarlErnstPoeschel VerlagGmbHinStuttgart1981
Das Buchvon HanneloreSchlafferiiber Goethes Wilhelm Meister
und das von Heinz Schlaffer iiber Faust II sind kornplementarim
Kontrast. Fiir ihre unterschiedlichen Methoden und Ergebnisse
sind nicht gegensatzliche Vorentscheidungen der Verfasser, son
dern spezifische Anforderungen der poetischen Werke verant
wortlich.
Die Wilhelm-Meister-Philologie vertraute bislang dem zeitna
hen VordergrunddesWerkes, so daRdieIkonologieseinesmytho
logischen Hintergrunds unentdeckt blieb. Die Faust II-Philologie
hielt sich vornehmlich an den mythologisch-symbolischen Appa
rat und lieRdie historischen Bedeutungen unbedacht.
Die vorliegenden Abhandlungen kehren die Richtung der
Erkenntnis urn: Die Interpretation der Wilhelm-Meister-Romane
findet inverborgenen Bildern einen Sinn, der dieProsa desWirkli
chen iiberschreitet. Die Interpretation von Faust II entdeckt die
Allegorie als die bildliche Form der Abstraktionen, von denen
Goethe das Jahrhundert bestimmt sah.
Die unterschiedlichen Interpretationsverfahren beriicksichtigen
die historisch begriindete Wandlung von Goethes asthetischer
Konzeption. Seine Wilhelm-Meister-Romane waren in der Hoff
nung geschrieben, daRErfahrungen der biirgerlichen Moderne an
die Bilder wiederkehrender Mythen zuriickzubinden seien. Faust
II, Goethes letztes Werk, geht aus der Einsicht hervor, daR die
Anspriiche der Moderne seinen Bildervorrat iibersteigen und eine
neue asthetische Antwort verlangen. Die Mythen werden von der
Allegorie aufgebraucht. Gerade die thematische Nachbarschaft
von Wilhelm Meisters Wanderjahren und Faust II macht die
geschichtliche Notwendigkeit der poetischen Alternativen be
wuRt. H. S., H. S.
v
Fiir einige Hinweise zum Verstandnis von Faust II und fiir die
kritische Lektiire des Manuskripts danke ich Doris Kammradt,
H.S.
VI
INHALT
Einleitung. Faust IIim 19.Jahrhundert 1
I. Voraussetzungen 11
1. Goethe anSchiller,Frankfurt,16.August1797 13
2. DieKritikderAllegorieimZeitalrerGoethes 29
3. DieBestimmungderAllegorieinHegelsAsthetik 39
4. Charaktermasken und Personifikationen in der Kritik der
politischen Okonomie 49
II. AllegorienundAllegorieinFaust II 63
1. DerAufzugderAllegorien.ZurMummenschanz ......... 65
2. DieEntstehungderallegorischen Verhaltnisse,Weitliiufiger
SaalmitNebengernachern 79
3. DieGegenwartderVergangenheitderAntike.Helena 99
4. WissenundErscheinung. Laboratorium 124
5. DieFormderAllegorieinFaustII 138
6. Grenzen der Allegorie. Der Myrhos der Natur und die
ReligionderLiebe 154
7. Die Sinnlichkeit der Abstraktionen. Zur Asthetik der Alle-
gorie 166
Schlup. Abstraktion, AllegorieundRealismus 175
Exkurs.WalterBenjaminsAllegorie 186
Anmerkungen 191
Personenregister 213
VII
EINLEITUNG
FAUST II 1M 19. ]AHRHUNDERT
1862,dreifsigjahrenachAbschlufvon Goethes »Hauptgeschaft«,
erscheint Friedrich Theodor Vischers Faust. Der Tragodie Dritter
Theil, »treu im Geiste des zweiten Theils des G6theschen Faust
gedichtet von Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Mystifi
zinsky«. Ihr Motto hat die Parodie dem parodierten Werk ent
nommen: »Und allegorisch, wie die Lumpen sind, / Sie werden
nur urn desto mehr behagen.. [1] Vischers Faust hat im Himmel
zurgelinden Strafe den Auftragerhalten, als Lehrer einer »sel'gen
Knabenkolonie- GoethesFaust II zu erklaren: »Esgeht jetzt, wie
gesagt, an den Homunkel, / Gebt acht, pafst auf, der Gegenstand
ist dunkell- [2] Urn das Dunkel aufzuhellen, hat Faust »aus Kom
mentaren, wenigstens aus zehn«, die »Deutungen- abgeschrieben:
»zuerst folgt noch der Rest der ersteren, langeren Definition: Der
Homunculus isr narnlich auBerdem, daB er einerseits die trockene
Gelehrsamkeit, andrerseits die Liebe zum ideal Schonen ist,
zugleich eine auBersttiefsinnige Anspielungaufden Vulkanismus.
Indem er narnlich am Muschelwagen der Galatea-r-ec, [3] Leider
werden weitere Erklarungen durch das Gebrumm von Maikafern
verhindert, welche die himmlischen Kinder in der Schulstube
losgelassen haben. Ergebnislos bleiben auch die Auslegungsversu
che der »Gesellschaft der an Goethes Faust sich zu tot erklart
habenden Erklarer«, die - geteilt nach Stoffhubern und Sinnhu
bern - das Nachspiel bestreiten.
Vischers Parodie, die das Werk fur unverstandlich erklart, wird
1
dem Interpretationsproblern von Faust II eher gerecht als die
meisten Interpretationen, die sich unverziiglich ans Werk machen.
Provozierend wirkt die Unverstandlichkeit gerade deshalb, weil
Faust II offensichtlich Bedeutungen, wenngleich dunkle, enthalt
und nach erhellender Deutung verlangt. Vischer fiihrt dieses
Argernis szenisch vor, indem er Faust zum Ausleger seiner selbst
bestellt und ihm, nachdem er bei dieser Aufgabe versagt hat,
professionelle Deuter nachschickt: Faust II ist in solchem Mafse
der Auslegung bediirftig, die Interpreten quasi zu seinen
dramatis personae gehoren. Notwendig werden solche Ausle
gungsversuche wegen der besonderen Struktur der Bilder, die sich
dem wortlichen Verstand wie dernatiirlichen Anschauungverwei
gern. Sie zwingen daher »zum Geistesriicktritt hinter die Erschei
nung« und fiihren, zu Vischers Leidwesen, in »die Tiefen der
Abstraktion«. Die Bilder seien derart »kurios und krumrn«,
sie hinterder »sonderbaren Hiille [...]der BedeutungFiille- zwar
versprechen, aber nicht preisgeben.[4] Vischer erfindet ein
boshaftes Beispiel: nacheinander treten ein Stiefelknecht, zwei
Stiefel und zehn Hiihneraugen auf, die schliefslich allesamt von
einer grofsen »Null« verschlungen werden (womit Vischer seine
Meinung iiber den 1deengehalt jener Bilder unmifsverstandlich
kundtut).
Die Distanz zwischen sinnlicher Erscheinung und ideeller
Bedeutung, welche die Ausleger zu iiberbriicken trachten, aber
nicht zu iiberbriicken verrnogen, siehtVischerin der allegorischen
AnlagevonFaust II begriindet. »DiesesHistorium / Ist kein Brim
borium, / lst Allegorium.. [5] Bereits die fingierten Verfasserna
men und das Motto der Parodie kiindigen an, Goethes Werk
als Allegoriecharakterisiertund kritisiertwerdensoll-als Allego
rie (Allegoriowitsch), die gedeutet werden will (Deutobold),
wegen der Dunkelheit ihrer Bilder (Symbolizetti) jedoch unver
standlich (Mystifizinsky) bleibt.[6] Denn eben der augenscheinli
che Widerspruch von unsinniger Erscheinung und unsinnlicher
Bedeutung, aufdem Vischers Kritik insistiert, ist ein Kennzeichen
derAllegorie.Urnden Widerspruchaufzulosen, wirdder »Geistes
riicktritt hinter die Erscheinung- erforderlich. Die Allegorie ist
demnach eine ungesattigte Form, die der Erganzung durch den
Interpreten bedarf. Solche Bediirftigkeit verletzt jedoch die Norm
jener asthetischen Autonomie, die zumindest seit dem 18. jahr
hundert, nicht zuletzt durch das Vorbild von Goethes klassischer
2
Dichtung, allgemeine Geltung beansprucht. OafSGoethe noch im
19. Jahrhundert in eine derart iiberholte Dichtart zunickfallen
konnte, urn »Cespenster- zu erfinden, die hochstens »aus faulem
Kirchenschutte [...]allegorisch zu erklaren- sind[7]- dies mufste
Vischers Uberzeugung verstoren, dag die literaturgeschichtliche
Entwicklung zielbewufst und unumkehrbar zu einer immer sinn
falligeren Darstellung menschlicher Wirklichkeit fortschreite. Urn
eine Deutung der Allegorie in Faust II will sich Vischer auch
deshalb nicht berniihen, weiI er von vornherein eine Form fur
verfehlt halt, die in Verstandesabstraktionen aufgelost werden
kann. Wegen ihrer theoretischen Eindeutigkeit schien Vischer der
»astherischeWert<' derAllegoriegering: ihre »Helleist im Grunde
Verstandeshelle, Bewulitsein von Zweckrnaliigkeit: das letztere
freilich nur, wenn das tertium einleuchtend gewahlr ist; doch,
wenn dies nichtderFall, so wird man erstrechtin das Verstandes
gebietverwiesen, urn zu suchen, zu raten.« [8] - Gerade durchsei
ne Aversionen deckt Faust III die ungewohnliche Konstruktion
vonFaust II, seine Sonderstellungin derLiteraturdes 19.Jahrhun
derts und seine Herausforderung an die Interpreten auf: der ge
meinsame Index dieser Eigentiimlichkeiten ist die Allegorie.
Was Vischer und die meisten Kritiker im 19. Jahrhundert vor
allem an Faust II irritierte, war das Wiederaufleben der seit
langem fur tot erklarten Form der Allegorie. Sie wufsten sich
keinen anderen Rat, als Faust II fur ein totgeborenes Werk zu
erklaren. Ein 1835 abgelegtesBekenntnif5iiber den 2ten Theil von
Gothes Faust lautet: »Ein prononcirt allegorisches Gedicht
kommt mir immer mehr oder weniger vor wie der Leichenzug
irgend einer verblichenen Wahrheit, die die neun Musen mit
langen Flohren und Citronen in den Handen, auf der Bahre
tragen.«[9] Die Diskrepanz zwischen den asthetischen Prinzipien
des Werks eines bereits kanonischen Autors und der Kritik, die
dieses Werk ebenso gern kanonisiert harte wie seine fruheren,
kame es nur nicht in soleh fragwiirdiger Gestalt einher - diese
Diskrepanz fordert eine Erklarung, Nimmt man beide, Goethe
und seine Kritiker, ernst, so liegt eine doppelte Vermutung iiber
den Ursprung ihres Konflikts nahe: 1.JederAkt der unerwarteten
Wiederaufnahme geschieht bewulster als einer der traditionellen
Weiterfuhrung. Goethes ungewohnlicher Entscheidung fur die
Allegorie sind eventuell Erkenntnisse iiber den >Weltzustand, vor
aufgegangen, die der asrhetischen Produktion seiner Zeit fremd
3