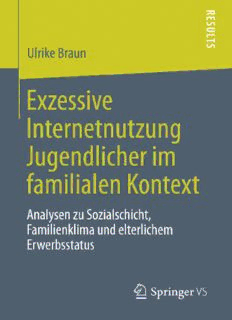Table Of ContentExzessive Internetnutzung Jugendlicher
im familialen Kontext
Springer Results richtet sich an Autoren, die ihre fachliche Expertise in konzent-
rierter Form präsentieren möchten. Externe Begutachtungsverfahren sichern die
Qualität. Die kompakte Darstellung auf maximal 120 Seiten bringt ausgezeichnete
Forschungsergebnisse „auf den Punkt“.
Springer Results ist als Teilprogramm des Bereichs Springer Research der Marken
Springer Gabler, Springer Vieweg, Springer VS und Springer Spektrum besonders
auch für die digitale Nutzung von Wissen konzipiert. Zielgruppe sind (Nach-
wuchs-)Wissenschaft ler, Fach- und Führungskräft e.
Ulrike Braun
Exzessive Internetnut-
zung Jugendlicher im
familialen Kontext
Analysen zu Sozialschicht,
Familienklima und elterlichem
Erwerbsstatus
Ulrike Braun
Universität Hamburg
Deutschland
OnlinePLUS Material zu diesem Buch fi nden Sie auf
http://www.springer-vs.de/978-3-658-04196-0
ISBN 978-3-658-04196-0 ISBN 978-3-658-04197-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-04197-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-
nalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufb ar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be-
trachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media.
www.springer-vs.de
Danksagung
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Rudolf Kammerl
bedanken; Gutachter der vorliegenden Arbeit und Leiter der dieser Untersuchung
übergeordneten Studie „EXIF – Exzessive Internetnutzung in Familien“.
Vielen Dank für die Bereitstellung des quantitativen EXIF-Datensatzes, die her-
vorragende Betreuung und Unterstützung, für die bekräftigenden Worte und die
angenehme Zusammenarbeit!
Außerdem danke ich meinem Freund Hendrik Fritsche. Für alles.
Inhalt
1. Einführung ............................................................................................... 11
2. Exzessive Computer- und Internetnutzung Jugendlicher –
Überblick über den aktuellen Forschungsstand .................................... 15
3. Zur Rolle der Familie für die jugendliche Entwicklung im Fokus der
Computer- und Internetnutzung und (medien-)erzieherischer
Aufgabenbewältigung ............................................................................. 23
3.1. Themenfokussierte Theorien und Zugänge zu familialer Sozialisation .. 26
3.2. Adoleszenz – Aushandlung neuer Strukturen ........................................... 29(cid:3)
3.2.1. Neue Entwicklungsaufgaben für die Familie ................................ 30(cid:3)
3.2.2. Der Wandel der Beziehungen – zwischen Autonomie
und Kontrolle .................................................................................... 32
3.3. Computer- und Internetnutzung in der Adoleszenz –
Bedeutung und Effekt von Erziehung und Beziehung ............................ 36(cid:3)
3.3.1.(cid:3)(cid:3) Medienbezogene Einflussfaktoren auf Basis elterlicher
Erziehung ........................................................................................... 37(cid:3)
3.3.2.(cid:3)(cid:3) Medienunabhängige familiale Einflüsse ......................................... 41(cid:3)
3.4.(cid:3)(cid:3) Die digitale Kluft als soziales Phänomen schichtspezifischer
Divergenz ........................................................................................................ 41(cid:3)
3.5.(cid:3)(cid:3) Die Bedeutung des elterlichen Erwerbsstatus für die Familie und den
jugendlichen Computer- und Internetgebrauch ........................................ 46(cid:3)
3.6.(cid:3)(cid:3) Familienklimatische Aspekte und ihre Verknüpfung zu gegebenen
Lebenslagen und -bedingungen im Hinblick auf jugendliche
Computer- und Internetnutzung ................................................................. 48(cid:3)
4. Forschungsinteresse und Zielsetzung ..................................................... 55
4.2. Fragestellungen .............................................................................................. 57(cid:3)
4.3.(cid:3)(cid:3) Hypothesen..................................................................................................... 58(cid:3)
5. Datenbasis und Forschungsmethodik ..................................................... 61
5.1.(cid:3)(cid:3) Erhebungsmethode ....................................................................................... 62(cid:3)
5.1.1.(cid:3)(cid:3) Messinstrumente ............................................................................... 62(cid:3)
5.1.1.1.(cid:3)Compulsive Internet Use Scale .......................................... 63(cid:3)
8 Inhalt
5.1.1.2.(cid:3)Herkunftsschicht-Index ...................................................... 64(cid:3)
5.1.1.3.(cid:3)Familienbögen ...................................................................... 64(cid:3)
5.1.1.4.(cid:3)Medienerziehungsqualität ................................................... 66(cid:3)
5.2.(cid:3)(cid:3) Stichprobe ....................................................................................................... 68(cid:3)
5.3.(cid:3)(cid:3) Operationalisierung ....................................................................................... 69(cid:3)
6. Ergebnisdarstellung ................................................................................. 71
6.1.(cid:3)(cid:3) Deskriptive Analysen .................................................................................... 71(cid:3)
6.1.1.(cid:3)(cid:3) Soziodemographie ............................................................................ 71(cid:3)
6.1.2.(cid:3)(cid:3) Erwerbsstatus .................................................................................... 72(cid:3)
6.1.3.(cid:3)(cid:3) Familienklimaprofile ......................................................................... 73(cid:3)
6.2.(cid:3)(cid:3) Hypothesenprüfung....................................................................................... 76(cid:3)
6.2.1.(cid:3)(cid:3) Das Risiko einer pathologischen Computer- und
Internetnutzung nach CIUS ............................................................ 76(cid:3)
6.2.2.(cid:3)(cid:3) Zusammenhänge mit der elterlichen Medienerziehung ............... 82(cid:3)
6.2.3.(cid:3)(cid:3) Unterschiede in der Internetnutzungsfrequenz der
Jugendlichen ...................................................................................... 88(cid:3)
7. Zusammenfassung und Diskussion ......................................................... 93
7.1.(cid:3)(cid:3) Ableitung pädagogischer Konsequenzen ................................................... 95(cid:3)
7.2.(cid:3)(cid:3) Übergreifende kritische Auseinandersetzung mit der Thematik ............. 97(cid:3)
7.3.(cid:3)(cid:3) Kritik an der Untersuchung und Limitationen ........................................ 101(cid:3)
7.4.(cid:3)(cid:3) Fazit und Ausblick ....................................................................................... 105(cid:3)
Literatur ....................................................................................................... 107
Anhang 1
Tabellen zu den empirischen Berechnungen ..................................................... 121(cid:3)
Bivariate Regressionsmodelle zur H: Risiko eines pathologischen
1
Internetgebrauchs .................................................................................................. 121(cid:3)
Bivariate Regressionsmodelle zur H: Moderationseffekte .............................. 122(cid:3)
2
Bivariate Regressionsmodelle zur Ha:
4
Dimensionen der Medienerziehung .................................................................... 123(cid:3)
Multivariate Regressionsmodelle zur Hb:
4
Dimensionen der Medienerziehung .................................................................... 125(cid:3)
In der Repräsentativbefragung eingesetzte Messinstrumente ......................... 127
1 Auf den Anhang kann unter www.springer.com auf der Produktseite zu diesem Buch als zusätzli-
ches Material zugegriffen werden.
Abbildungen und Tabellen
Abbildung 6-1: Schichtgebundene Erwerbsquote in der Gesamtstichprobe .............. 73
Abbildung 6-2: Schichtgebundene Verteilung der Familienklimamodelle der
FB-S der Eltern in der Gesamtstichprobe ........................................... 73
Abbildung 6-3: Schichtgebundene Verteilung der Familienklimamodelle der
FB-S der Jugendlichen in der Gesamtstichprobe ................................ 74
Abbildung 6-4: Verteilung des Erwerbsstatus innerhalb der Familienklimamodelle
der FB-S der Eltern in der Gesamtstichprobe .................................... 75
Abbildung 6-5: Verteilung des Erwerbsstatus innerhalb der Familienklimamodelle
der FB-S der Jugendlichen in der Gesamtstichprobe ......................... 75
Tabelle 5-1: Medienerzieherische Begleitung ............................................................ 67
Tabelle 5-2: Interesse am medialen Konsuminhalt des Kindes ............................. 67
Tabelle 5-3: Elterliche Medienkompetenz ................................................................. 67
Tabelle 5-4: Soziodemographie der Jugendlichen (Quotierung) in der
Gesamtstichprobe ................................................................................... 68
Tabelle 6-1: Soziodemographie der Eltern in der Gesamtstichprobe .................... 71
Tabelle 6-2: Verteilung der elterlichen Erwerbstätigkeit in der
Gesamtstichprobe ................................................................................... 72
Tabelle 6-3: Bivariates logistisches Regressionsmodell (Sozialschicht-
zugehörigkeit); Kriterium: CIUS ........................................................... 78
Tabelle 6-4: Logistisches Regressionsmodell: Moderationseffekt Sozialschicht-
zugehörigkeit und Familienklima (Jugend); Kriterium: CIUS ........... 79
Tabelle 6-5: Multivariates logistisches Regressionsmodell; Kriterium: CIUS ....... 81
Tabelle 6-6: Medienerzieherische Begleitung und pathologische
Internetnutzung ....................................................................................... 86
Tabelle 6-7: Interesse am medialen Konsuminhalt des Kindes und
pathologische Internetnutzung .............................................................. 87
Tabelle 6-8: Selbstverantwortliche Regulierung und pathologische
Internetnutzung ....................................................................................... 87
Tabelle 6-9: Medienerzieherisches Vorbild und pathologische Internetnutzung . 87
Tabelle 6-10: Elterliche Medienkompetenz und pathologische Internetnutzung .. 88
1. Einführung
Kinder und Jugendliche wachsen heute wie keine Generation vor ihnen mit einem
omnipräsenten Medienangebot auf, das beinah alle Bereiche der Lebenswelt ab-
deckt. Jugend- und Medienforscher2 haben die Bedeutsamkeit von Medien im Ju-
gendalter vielfach hervorgehoben und ihren Zuwachs an Sozialisationsmacht im
Vergleich zu anderen Instanzen wie Schule oder Familie betont (vgl. Hoff-
mann/Mikos 2010: 8). Computer und Internet haben das Leben global revolutio-
niert. Das Internet ist mit seiner Fülle an Möglichkeiten zu dem bedeutendsten und
mächtigsten Werkzeug des Menschen (vgl. Shek et al. 2013: 2776) und das Wissen
um die Nutzung und den Umgang in vielerlei Hinsicht essentiell geworden. So ist
die Onlinebewerbung um Studienplatz oder Job mittlerweile Prämisse ebenso wie
die obligatorischen EDV-Kenntnisse in Schule oder Beruf. Auch in die Zimmer der
Kinder und Jugendlichen hält das Medium Einzug, wobei diese sich zuweilen weit-
aus besser mit Computer und Internet auskennen als die Elterngeneration. Kaum
ein Jugendlicher kann sich sein Leben mehr ohne soziale Netzwerke wie facebook®
vorstellen. Die Nutzung der so genannten „Neuen Medien“ birgt jedoch auch Risi-
ken. Seit vielen Jahren läuft der kontroverse Diskurs über Internet- oder Compu-
ternutzung in Öffentlichkeit und Wissenschaft. Einerseits ist Medienkompetenz in
dieser digitalen Gesellschaft zu einer Kernkompetenz geworden, es gibt eine Viel-
zahl von Lernsoftware für alle erdenklichen Themenbereiche und jede Altersstufe,
eLearning-Plattformen und vieles mehr, sogar einigen Computerspielen wird ein
„bildungsförderndes Potential zugeschrieben“ (Kammerl 2010: 21). Andererseits
wächst die Zahl wissenschaftlicher Studien verschiedenster Disziplinen wie der psy-
chologischen, soziologischen oder medizinischen zu Internet- bzw. Computerab-
hängigkeit. Wissenschaftler sind sich zuweilen uneinig, ob man hierbei überhaupt
von einer Abhängigkeit sprechen kann, ob es sich um ein eigenständiges Krank-
heitsbild oder eine Komorbidität einer psychischen Erkrankung handelt. Es ist je-
doch von äußerster Bedeutsamkeit, den Fokus solcher Studien nicht ausschließlich
auf die Betroffenen zu legen. Vor allem bei Jugendlichen ist das Umfeld, allen voran
das familiäre, in höchstem Maße prägender Faktor; die Familie ist der erste Ort für
das Sammeln medienfokussierter Erfahrungen. Medien und ihr Umgang sind zu
2 Zum Zwecke eines besseren Leseflusses wird in der vorliegenden Arbeit das generische Maskulinum
verwendet. Die Formulierung schließt stets beide Geschlechter ein. Bei inhaltlicher Bedeutung einer
geschlechtsspezifischen Differenzierung wird dies sprachlich kenntlich gemacht.
U. Braun, Exzessive Internetnutzung Jugendlicher im familialen Kontext,
DOI 10.1007/978-3-658-04197-7_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Description:Bei der Optimierung von Beratungs- und Hilfsangeboten für exzessiven oder pathologischen Computer- und Internetgebrauch ist die Identifikation gefährdeter Personengruppen bedeutsam. Ulrike Braun bündelt empirische Befunde zu diesem Phänomen und arbeitet die Besonderheiten der Adoleszenz heraus.