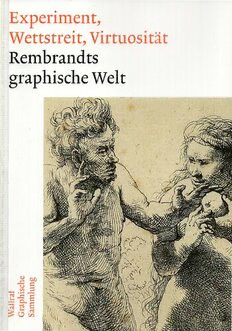Table Of ContentExperiment,
Wettstreit, Virtuosität
Rembrandts
graphische Welt
Experiment,
Wettstreit, Virtuosität
Rembrandts
graphische Welt
Wallraf
Graphische
Sammlung
Inhalt
Vorwort 6
Marcus Dekiert
Experiment, Wettstreit, Virtuosität. 10
Rembrandts graphische Welt
Anne Buschhaff
Ausgewählte Bibliographie 67
Konkordanz 70
Impressum 72
Vorwort
Rembrandt Harmensz. von Rijn starb vor 350 Jahren. In
Gedenken an den großen Niederländer des Goldenen Zeit
alters präsentiert das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation
Corboud in diesem Herbst gleich zwei Ausstellungen, die
Rembrandt als eminent vielseitigen Künstler feiern, der sowohl
als Maler und Zeichner als auch als Radierer Epochales ge
leistet hat. Den Auftakt macht unsere Graphische Sammlung,
die zum Todestag am 4. Oktober eine feine Auswahl von
rund 30 Radierungen präsentiert, die zum stolzen Besitz des
eigenen Bestands zählen. Am 1. November wird dann die
große Ausstellung Inside Rembrandt 01606-1669 eröffnet, die
in Kooperation mit der Nationalgalerie Prag entsteht und
Rembrandt in allen seinen Facetten und im Kontext seiner
Zeit präsentieren wird.
Auf dem Gebiet der Radierung realisierte Rembrandt bis dahin
Unerreichtes. Sein graphisches Schaffen verbindet technische
Innovation und Experimentierfreudigkeit mit großer Lebens
nähe der Darstellung und Gefühlstiefe der Erzählung.
Die Ausstellung im Graphischen Kabinett zeigt ausgewählte
(Selbst-)Porträts und Landschaften. Der thematische Schwer
punkt aber liegt auf der biblischen Historie, die Rembrandts
gesamtes graphisches Schaffen wesentlich bestimmt. Ins
besondere Szenen aus dem Alten Testament sind vertreten,
die Menschen regelmäßig in Momenten der Bewährung
oder der Erkenntnis zeigen. Gegenüberstellungen mit Werken
von Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, Antonio Tempesta
oder Jacques Callot führen eindrücklich vor Augen, dass
Rembrandt seine Sujets im ambitionierten künstlerischen Wett
streit mit verehrten Vorgängern und Zeitgenossen erarbeitete.
6
Die Ausstellung wird durch die Leihgabe eines Kölner Privat
besitzers bereichert, der an dieser Stelle nicht genannt zu
werden wünscht. Ihm sei sehr herzlich gedankt.
Ein besonders herzlicher Dank gilt Anne Buschhoff, die seit
März die Graphische Sammlung des Wallrafleitet und
mit der Rembrandt-Präsentation ein erstes Probestück ihrer
künftigen Arbeit gibt. Frau Buschhoff hat zuvor mehr als
ein Jahrzehnt sehr erfolgreich als Kustodin am renommierten
Kupferstichkabinett der Kunsthalle Bremen gewirkt und
dort zahlreiche Ausstellungen kuratiert.
Besonders zu danken ist zudem Heiko Aping und Hartmut
Brückner vom Büro BrücknerAping, die mit diesem Band für die
Publikationsreihe der Graphischen Sammlung ein neues,
ausgesprochen ansprechendes Gewand gestaltet haben, sowie
Petra Leineweber, die den Katalog lektoriert hat.
Gedankt sei zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Hauses, die die Ausstellung mit großer Begeisterung
vorbereitet und umgesetzt haben. Besonderer Dank gilt dabei
unseren Papierrestauratoren Melanie Lindner und Thomas
Klinke sowie unserem Graphikverwalter Dieter Bongartz, den
Ausstellungsleiterinnen Barbara Trier und Ricarda Hüpel
sowie unserem Praktikanten Gregor von Kerssenbrock-von
Krosigk.
Möge diese kleine Ausstellung für viele Besucherinnen
und Besucher der Anreiz sein, die faszinierende Welt der
wundervollen Radierungen Rembrandts zu entdecken.
Marcus Dekiert
7
Ich möchte, wenn du wieder einmal hierher kommst,
»
gerne die Stiche von Dürer hier im Museum
noch einmal alle mit Dir ansehen,
so wie wir es das letzte Mal mit denen von Rembrandt
gemacht haben.«
Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo, Amsterdam, 10. Februar 1878'
Experiment,
Wettstreit, Virtuosität.
Rembrandts
graphische Welt
Anne Buschhaff
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1 606-1669) gilt als Inbegriff
des Maler-Radierers. Die Malerei hatte er wie die Zeichnung
erlernt, nicht aber die Radierung. Weder Jacob Isaacsz. van
Swanenburgh (1571-1638), in dessen Werkstatt er zwischen
1622 und 1626 in Leiden in die Lehre ging, noch Pieter Lastman
(1583-1633), bei dem er 1626 eine halbjährige Lehrzeit in
Amsterdam anschloss, hatten in der druckgraphischen Technik
gearbeitet. Dennoch widmete sich Rembrandt der Radier
kunst ab den späten 162oer-Jahren mit wachsender Intensität
und gelangte darin binnen weniger Jahre zu einer solchen
Virtuosität, dass die insgesamt rund 314 Radierungen schon zu
Lebzeiten maßgeblich zu seiner Berühmtheit beitragen sollten.
Wenige große niederländische Künstler seiner Zeit widmeten
sich überhaupt der Radierung-Adrian van Ostade (1610-1685)
etwa oder Jacob van Ruisdael (um 1628/29-1682).
Vermutlich eroberte sich Rembrandt die Radierkunst mit Jan
Lievens (1607-1674), mit dem ihn Mitte der 162oer-Jahre
eine enge Zusammenarbeit verband.' Dabei nutzte Rembrandt
die Druckgraphik kaum zur Reproduktion der eigenen Kunst.
Während Peter Paul Rubens (1577-1640) seine Gemälde in
Antwerpen von ausgesuchten Berufsgraphikern nachstechen
ließ und die Reproduktionsgraphik zu einem florierenden
Geschäft ausbaute, schuf Rembrandt nur vier Vorlagen für Re
produktionsgraphiken, die Jan Gillisz. van Vliet (um 1610-1671)
11 um 1630 radierte.3 Weitgehend unabhängig von seiner Malerei
entwickelte Rembrandt in der Druckgraphik eigenständige
künstlerische Ideen, darin Albrecht Dürer (1471-1528) und Lucas
van Leyden (1494-1533) vergleichbar, die in Holzschnitt
und Kupferstich autonome graphische Werke entfaltet hatten.
Als Rembrandt die Radierung aufnahm, war das Tiefdruck
verfahren des Kupferstichs noch deutlich gängiger als die
Radierung, wenn auch vergleichsweise mühselig. Denn wäh
rend der Grabstichel beim Kupferstich unmittelbar durch
das Metall getrieben wird und der Materialwiderstand mit
einem gewissen Kraftaufwand überwunden werden muss,
wird die Radiernadel durch den weichen Ätzgrund geführt
beziehungsweise »gekratzt« (lat. radere), mit dem die Kupfer
platte zunächst überzogen ist. Die Strichführung kann im
Vergleich zum Kupferstich deutlich schneller, spontaner und
flüssiger erfolgen, sodass das Arbeiten mit der Radiernadel
dem Zeichnen mit dem Bleistift verwandt ist. Tatsächlich war
die Radierung schon um 1500 entwickelt, bis 1600 aber wenig
genutzt worden.4 Zwar bot sie in der Handhabung der zeichner
ischen Mittel neue Freiheiten, doch verlangte sie dem Radierer
auch besondere Fertigkeiten im anschließenden Ätzvorgang
ab, wenn es darum ging, feine tonale Abstufungen wie im
Kupferstich zu erzielen: Nachdem die Metallplatte an den be
zeichneten Stellen freigelegt ist, wird sie in ein Säure bad
gelegt, sodass sich das Linienbild in die Platte eingräbt.Je nach
gewünschter Tiefe und späterem Dunkelwert im Druck ist
kürzer oder länger zu ätzen. Anschließend wird der Ätzgrund
entfernt und die Druckfarbe-wie beim Kupferstich-mit
dem Ballen auf die erwärmte Platte aufgetragen, sodass sie sich
in den vertieften Linien sammelt. Danach werden die glatten
Partien der Platte sauber gewischt und der Druck kann auf
einem angefeuchteten Papier erfolgen. Änderungen sind durch
wiederholtes Abdecken mit Asphaltlack ohne Probleme zu
realisieren. Nicht nur durch die Dauer und das Wiederholen
des Ätzvorgangs, sondern auch durch den Plattenton und
das gekonnte Wischen der Platte können wirkungsvolle Hell
12 dunkeleffekte erzielt werden.
1 Giovanni Benedetto Castiglione
Bildnis eines Mannes mit Federbarett
4C. ( A ~Tf~.inNVS (sog. Selbstbildnis),
~fNOVllS(. f'[,
späte 164oer-Jahre
Radierung
198 x 147 mm (BI.)
Bez. o. l.: G. CASTILIONUS /
GENOVESE.FE.
Alter Bestand
Inv. Nr. 28844
TIB. 53
2 Christian Wilhelm Ernst Dietrich
Die große Krankenheilung
(frei nach Rembrandts
Hundertguldenblatt), 1763
Radierung
301/304 x 439 mm
Bez. u. 1.: Dietrich fecit 1763
Alter Bestand
Inv. Nr. 12694