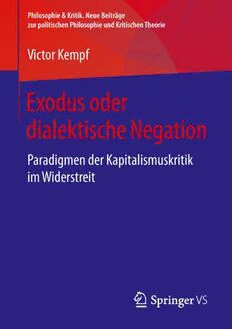Table Of ContentPhilosophie & Kritik. Neue Beiträge
zur politischen Philosophie und Kritischen Theorie
Victor Kempf
Exodus oder
dialektische Negation
Paradigmen der Kapitalismuskritik
im Widerstreit
Philosophie & Kritik. Neue Beiträge zur
politischen Philosophie und Kritischen
Theorie
Reihe herausgegeben von
J. Christ, Frankfurt am Main, Deutschland
D. Loick, Frankfurt am Main, Deutschland
T. Stahl, Groningen, Niederlande
F. Vogelmann, Bremen, Deutschland
Diese Reihe soll Beiträge versammeln, die sich von traditionellen Herangehens-
weisen in der praktischen und politischen Philosophie dadurch abheben, dass sie
sich in dreifachem Sinne als politisch engagierte Philosophie begreifen: (1) Sie
sind auf das Politische gerichtet, also auf die als selbstverständlich in Anspruch
genommenen begrifflichen Grundlagen unseres politischen Denkens und Han-
delns. Sie reduzieren politische Philosophie damit weder auf ein Nachdenken
über vorgegebene institutionelle Strukturen, noch führen sie sie auf Moralphi-
losophie zurück. Sie sind politisch engagierte Philosophie. (2) Sie verstehen
politische Philosophie als eine Reflexionsinstanz sozialer Praktiken, die selbst
Bestandteil dieser Praktiken ist. Philosophie ist demnach weder der Politik extern
noch ihrer Zeit enthoben, sondern eine – durchaus historisch informierte und
auf Emanzipation ausgerichtete– Selbstverständigung der Gegenwart über ihre
Kämpfe. Sie sind politisch engagierte Philosophie. (3) Sie bleiben dabei politisch
engagierte Philosophie: Sie verbinden Arbeit an den Begriffen mit der Auseinan-
dersetzung mit den philosophischen Traditionen und der Transformation unserer
politischen Fantasie.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/15669
Victor Kempf
Exodus oder dialektische
Negation
Paradigmen der Kapitalismuskritik
im Widerstreit
Victor Kempf
Berlin, Deutschland
Dissertation Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2017
u.d.T.: Victor Kempf: „Exodus oder dialektische Negation? Paradigmen der Kapitalis-
muskritik im Widerstreit.“ Diese Publikation geht hervor aus dem DFG-geförderten
Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main.
ISSN 2524-3683 ISSN 2524-3691 (electronic)
Philosophie & Kritik. Neue Beiträge zur politischen Philosophie und Kritischen Theorie
ISBN 978-3-658-24457-6 ISBN 978-3-658-24458-3 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24458-3
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhalt
1. Kapitalismuskritik heute: Jenseits dialektischer Negation 7
1.1 Verstummen der Kapitalismuskritik 11
1.2 Wiedererstarken der Kapitalismuskritik 15
1.3 Die bleibende Ernüchterung der „Entnormativierung“ 17
1.4 Bewegungsemphase des Operaismus 21
1.5 Exodus vs. dialektische Negation 26
1.6 Ziele, Thesen und Aufbau der Arbeit 33
2. Ausbeutung als Tausch: Anfangsgründe der radikalen
Kapitalismuskritik 41
2.1 Marx und die immanente Kritik 42
2.2 Fundamentalkritik des Äquivalententausch 48
2.3 Untiefen der radikalen Kapitalismuskritik 62
2.4 Historische Einlösung der Anfangsgründe 71
3. Vom Liberalismus zum Sozialismus: Der radikale
Reformismus der Anerkennungstheorie 75
3.1 Kampf um Anerkennung: ein emanzipatorischer Impuls? 78
3.2 Der Anspruch auf Wertschätzung 92
3.3 Egalitäre Konsequenzen der Marktfreiheit 105
3.4 Liberaler vs. kommunitaristischer Sozialismus 125
4. Exodus aus jeder Vermittlung: Der radikale Anti-Reformismus
des Operaismus 143
4.1 Aufhebung des Sozialismus 149
4.2 Die Regression des Fortschritts 172
4.3 Das postdialektische Terrain der Befreiung 197
4.4 Liebe vs. Tausch 221
5. „Remain & Revolt“: Zusammenfassung und Ausblick 257
5.1 Argumentation und systematische Ergebnisse 258
5.2 Re-Radikalisierung der immanenten Kapitalismuskritik 267
Literatur 277
1. Kapitalismuskritik heute:
Jenseits dialektischer Vermittlung
Die neuerliche Systemkrise des Kapitalismus hat einen Kontext der Empö-
rung erzeugt, in dem die Lethargie der Posthistoire (vgl. Fukuyama 1989)
durchbrochen wurde*. Zumindest zeitweilig gelangte die öffentliche Thema-
tisierung der gegenwärtigen Verwerfungen kapitalistischer Gesellschaften
über die unbestimmte Stimmungslage einen bloßen Unbehagens hinaus und
spitzte sich in konkreten Aktionen des Protests, des Widerstands und der
Verweigerung zu. Die Besetzung des Zuccotti Park an der Wall Street durch
eine bunt-gescheckte Multitude im Spätsommer 2011 kann als Höhepunkt
dieser Zuspitzung gelten. Auch wenn das politische und soziokulturelle
Spektrum, das sich dort in den Camps, Workshops und Protestmärchen
zusammenfand, äußerst heterogen war und sich ganz explizit unter keiner
Programmatik, keiner übergeordneten Forderung versammelte, ließ sich
doch innerhalb der Camps ein innerer Kern ausmachen, der genau diese
Abwesenheit eines bündigen, im Rahmen der etablierten politisch-
ökonomischen Diskurse verhandelbaren Programms, zum richtungsweisen-
den Prinzip und welthistorischen Gehalt seiner Radikalität erhob.
Nun gehören die Okkupationen von 2011 selbst schon wieder der Ver-
gangenheit an. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Motiv der Revolte ver-
schwunden ist oder sich der Drang zur handgreiflichen gesellschaftlichen
Veränderung einfach gelegt hätte. Vielmehr übersetzte und verteilte sich der
radikale Impuls dieser Tage in mannigfaltige Initiativen des gesellschaftli-
chen Alltags. Er emittierte wieder in die globale Weite des sozialen Raums,
aus der er zuvor bereits gekommen war. Die allgegenwärtige Kultur der
Commons (Helfrich/Heinrich-Böll-Stiftung [Hg.] 2012; Exner/Kratzwald
2012), die Schenkzirkel und die großstädtische Beliebtheit alternativer Land-
kommunen zeugen davon. Getragen sind diese Entwindungen aus der heu-
tigen Marktgesellschaft durch die Idee einer Auflösung der Vermittlungs-
strukturen der modernen Gesellschaft, die als kalt und inhuman empfunden
werden. Es wird somit an die Welt der Camps und der posttraditionalen
* Dies ist die überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im Winter 2017 dem
Fachbereich 08 der Goethe-Universität vorgelegt habe.
7
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
V. Kempf, Exodus oder dialektische Negation, Philosophie & Kritik.
Neue Beiträge zur politischen Philosophie und Kritischen Theorie,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24458-3_1
Gemeinschaft angeschlossen, die damals an der Wall Street gleichsam en
miniature als mediales Spektakel der Weltöffentlichkeit dargeboten wurde.
Das macht die anhaltende Aktualität von Occupy aus.
Trotz dieser gesellschaftlich verbreiteten Haltung und Praxis der beherz-
ten und ernstzunehmenden Zurückweisung kapitalistischer, überhaupt
marktwirtschaftlicher Strukturlogiken, ist es in den letzten Jahren jedoch nie
zu einer Übertragung der kapitalistischen „Systemkrise“ (Altvater 2009) in
eine politische Legitimationskrise des Kapitalismus gekommen. Wohl ist das
Selbstverständnis gegenwärtiger westlicher Demokratien durch die Rede von
einem strukturellen „Demokratiedefizit“ (vgl. Streeck 2012, 2013a; Haber-
mas 2013) zumindest vorübergehend ein wenig in Verlegenheit gekommen.
Die wesentlichen Strukturen kapitalistischer Reproduktion dagegen sind –
sog. neoliberale „Exzesse“ einmal beiseitegelassen – bis dato allerdings nicht
ins Wanken geraten. Der Fundamentalprotest, der sich mit Occupy zum Aus-
druck brachte, scheint nicht zu verfangen, scheint die Legitimationsgrundla-
ge der gegenwärtigen Ökonomie nicht anzufechten, nicht ihren eigenen
Lebensnerv und ihr genuines normatives Konstitutionsprinzip zu treffen. So
geht der Betrieb unvermindert weiter, über die zu ihm querstehende Mo-
mente geräuschlos hinweg. Das mag sicherlich zuvorderst erst einmal daran
liegen, dass die Phase der Insurrektion 2011 kurzatmig und vorübergehend
blieb und nicht die nötige Hartnäckigkeit aufgebracht wurde, um den Pro-
testzyklus mit vergleichbarer Intensität fortzusetzen und damit das politi-
sche Krisenmoment akut zu halten. Hinzu kommen diverse andere empiri-
sche Faktoren, wie eine Beruhigung der wirtschaftlichen Lage, systemkon-
forme Medienberichterstattung usw.
Es gibt neben all dem aber m.E. noch einen dahinterliegenden, inhaltli-
chen Grund, der für das Ausbleiben einer politischen Legitimationskrise
bereits im Ansatz verantwortlich ist: Obzwar in den Protesten und alternati-
ven Projekten eine radikale Infragestellung des Kapitalismus zum Ausdruck
gebracht wird, mithin also durchaus eine Krise seiner Legitimität zu ver-
zeichnen ist, bleibt dieses Krisenmoment peripher, bündelt es sich nicht zu
einer drängenden Konfliktsituation, insofern es sich hierbei um eine de-
zentrierte Legitimationskrise handelt. Die Widersacher innerhalb des Kon-
flikts prallen nicht aneinander, da sie sich in unterschiedlichen politischen
8
und kulturellen Bezugsrahmen bewegen und die Vektoren ihrer gesellschaft-
lichen Kraftausübung schief gegeneinander anlaufen, ohne sich dabei zu
verhaken. Nicht direkt die Legitimität des kapitalistischen Systems wird von
dem radikal-linken Kern der Aktivisten bestritten. Vielmehr wird der gesam-
te bürgerlich-moderne Bezugsrahmen, der den Prinzipien einer solchen Le-
gitimität ihre moralische Bedeutung und ethische Sinnhaftigkeit verleiht, als
epochale Matrix einer verfehlten Zivilisation zurückgewiesen. Es fehlt nicht
nur das deliberative Zentrum einer geteilten Öffentlichkeit, sondern darüber
hinaus bereits der gemeinsame politisch-ökonomische Geltungsgrund, auf
dessen Basis alleine die Kritik für den Adressaten kommensurabel und da-
mit folgenreich werden kann.
Die Zerstreuung eines Fokus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung
ergibt sich aus einem Ausscheren des kapitalismuskritischen Impulses aus
der Vermittlungslogik moderner Vergesellschaftung. Dieses Ausscheren
passiert nicht das erste Mal in der Geschichte der radikalen Linken. Trotz-
dem scheint sich gegenwärtig die bürgerliche Moderne endgültig erschöpft
zu haben. Zumindest auf ökonomischem Gebiet haben sich ihre Legitima-
tionsprinzipien als normative Ressourcen einer gründlichen Kritik des Kapi-
talismus vollends diskreditiert: Tausch, Leistung, Eigentum und Vertrag,
mithin das bürgerliche System der Freiheit und Gleichheit, dass durch diese
Institutionen aufgespannt werden sollte; Wohlstand, Wachstum, die aufge-
weichten Formeln sozialer Gerechtigkeit und fairen Ausgleichs, sowie die
liberale Rede von Chancen und Teilhabe – dieser gesamte normative Kos-
mos wird von vielen Okkupanten und Anhängern der Commons als patho-
logischer Zwangszusammenhang und Formalismus der Entfremdung und
Inhumanität begriffen, der wie eine äußerliche Hülle abgestreift und wegge-
worfen werden soll, damit die unmittelbare Menschlichkeit im liebevollen
Anblick des Angesichts des konkreten Anderen erneut erblühen kann.
Während dieser Ausbruch aus dem normativen Kosmos der bürgerli-
chen Moderne vielerorts als Befreiung und Wiedergewinn des schönen Le-
bens gefeiert wird, möchte ich in dieser Arbeit das Ende der bürgerlichen
Moderne als tiefgehenden Verlust eines unausgeschöpften Emanzipations-
potentials problematisieren. In der Gegenüberstellung mit einem solchen,
erst zu rekonstruierenden, unausgeschöpften Emanzipationspotential wird
9
an der Vorstellung einer affektiv gespeisten Vergemeinschaftung, an der sich
nicht wenige linke Aktivisten und Praktiker der Commons orientieren, un-
verkennbar die Gefahr einer Regression deutlich: Die Partikularität, der
emotionale Sozialbeziehungen unüberwindbar verhaftet bleiben müssen,
sowie die affektive Unmittelbarkeit, in der sich der Schrecken alter Abhän-
gigkeiten im Kleid vertrauter Annehmlichkeit perpetuiert, muss als Rückfall
hinter normative Errungenschaften der ethisch zwar kaltherzigen, moralisch
jedoch superioren bürgerlichen Moderne zur Sprache gebracht werden.
So verheißend der Ausbruch aus den unpersönlichen Vermittlungsme-
chanismen der bürgerliche Moderne einerseits auch erscheinen mag, so at-
traktiv und wohltuend sich eine ökonomische Vergesellschaftung qua „Lie-
be“ (Eisenstein 2012) auch präsentiert, die jede quantitative und gegenüber
der Besonderheit der Bedürfnisse tendenziell immer restriktive und verweh-
rende Logik von Leistung, Tausch und Eigentum hinter sich gelassen hat –
so stark hat andererseits dieser Ausbruch aus der Vermittlung auch die re-
gressive Tendenz im Medium der persönlichen Solidarität, Verpflichtung
und Hilfsbereitschaft solche Abhängigkeits-, Herrschafts- und Ausbeu-
tungsverhältnisse unter dem euphemisierenden Schleier der Liebe zu reakti-
vieren bzw. auszubauen, aus denen gerade die gescholtenen Vermittlungs-
mechanismen der bürgerlichen Moderne ihres unabgegoltenen Potentials
nach emanzipieren können.
Diese Vermittlungsmechanismen – insbesondere auch der gleiche und
freie Tausch bzw. Vertrag – bergen, so meine These, das prinzipielle Eman-
zipationspotential einer Entwindung sowohl von persönlichen als auch von
sachlich vermittelten Abhängigkeits-, Herrschafts- und Ausbeutungsbezie-
hungen, wie sie die kapitalistische Klassengesellschaft charakterisieren. Im
Gegensatz dazu trachtet der liebeskommunistische Ausbruch aus der Ver-
mittlung die sachlichen und in diesem Sinn als entfremdend wahrgenomme-
nen Heteronomien des Kapitalismus dadurch zu überwinden, dass er umso
tiefer in das wohlig-gemütliche, annehmliche, doch dabei undurchschaute
Reich persönlicher Abhängigkeiten und mithin neofeudaler Herrschaftsver-
hältnisse hineinführt, das jenseits der bürgerlichen Moderne und ihrer po-
tentiell emanzipatorischen Vermittlungsfiguren im Gewand der Verlockung
droht. Andererseits kann dieses unausgeschöpfte Emanzipationspotential
10