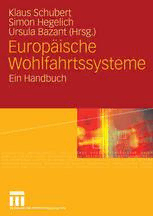Table Of ContentKlaus Schubert · Simon Hegelich · Ursula Bazant (Hrsg.)
Europäische Wohlfahrtssysteme
Klaus Schubert
Simon Hegelich
Ursula Bazant (Hrsg.)
Europäische
Wohlfahrtssysteme
Ein Handbuch
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
1.Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten
©VSVerlag für Sozialwissenschaften | GWVFachverlage GmbH,Wiesbaden 2008
Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Druck und buchbinderische Verarbeitung:Krips b.v.,Meppel
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in the Netherlands
ISBN 978-3-531-15784-9
Inhalt
Vorwort.................................................................................................................................9
I Einleitung
Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant
Europäische Wohlfahrtssysteme:
Stand der Forschung – theoretisch-methodische Überlegungen................................13
II Länderstudien
A Karin Heitzmann, August Österle
Lange Traditionen und neue Herausforderungen:
Das österreichische Wohlfahrtssystem...........................................................................47
B Bea Cantillon, Ive Marx
Auf der Suche nach einem Weg aus der ‚Wohlfahrt ohne Arbeit‘:
Das belgische Wohlfahrtssystem.....................................................................................71
CY Christina Ioannou, Anthos I. Shekeris, Christos Panayiotopoulos
Sozialpolitik im Schatten der Nationalen Frage:
Das zyprische Wohlfahrtssystem....................................................................................89
CZ Petr Fiala, Miroslav Mareš
Nach der Reform ist vor der Reform:
Das tschechische Wohlfahrtssystem.............................................................................109
D Simon Hegelich, Hendrik Meyer
Konflikt, Verhandlung, Sozialer Friede:
Das deutsche Wohlfahrtssystem...................................................................................127
DK Christoffer Green-Pedersen, Michael Baggesen Klitgaard
Im Spannungsfeld von wirtschaftlichen Sachzwängen und öffentlichem
Konservatismus: Das dänische Wohlfahrtssystem.....................................................149
E Paloma Villota Gil-Escoin, Susana Vázquez
Work in Progress:
Das spanische Wohlfahrtssystem..................................................................................169
6 Inhalt
EST Avo Trumm, Mare Ainsaar
Zwischen Marginalität und Universalismus:
Das estnische Wohlfahrtssystem...................................................................................187
F Camal Gallouj, Karim Gallouj
Auf Kurs in Richtung liberal-residualer Wohlfahrtsstaat?
Das französische Wohlfahrtssystem.............................................................................207
FIN Olli Kangas, Juho Saari
Krisenbewältigung mit Langzeitfolgen?
Der finnische Wohlfahrtsstaat.......................................................................................239
GB Lavinia Mitton
Vermarktlichung zwischen Thatcher und New Labour:
Das britische Wohlfahrtssystem....................................................................................263
GR Christos Papatheodorou
Verspätete Entwicklung der sozialen Sicherung:
Das griechische Wohlfahrtssystem...............................................................................285
H Katalin Tausz
Vom Staatssozialismus zum Wohlfahrtshybrid:
Das ungarische Wohlfahrtssystem................................................................................311
I David Natali
Rekalibrierung von Sozialprogrammen und Flexibilisierung der
Arbeitsmarktpolitik: Das italienische Wohlfahrtssystem...........................................333
IRL Anthony McCashin, Judy O‘Shea
Unter Modernisierungsdruck:
Das irische Wohlfahrtssystem........................................................................................355
L Nicole Kerschen
Entwicklungspfade von den Ursprüngen hin zu Europa:
Das luxemburgische Wohlfahrtssystem.......................................................................379
LT Jolanta Aidukaite
Die Entwicklung in der post-sowjetischen Ära:
Das litauische Wohlfahrtssystem..................................................................................403
LV Feliciana Rajevska
Vom Sozialstaat zum Wohlfahrtsmix:
Das lettische Wohlfahrtssystem nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit........423
Inhalt 7
MT Charles Pace
Linker Wein in rechten Schläuchen?
Das Wohlfahrtssystem Maltas.......................................................................................443
NL Wim van Oorschot
Von kollektiver Solidarität zur individuellen Verantwortung:
Der niederländische Wohlfahrtsstaat...........................................................................465
P José António Pereirinha, Manuela Arcanjo, Francisco Nunes
Von einem korporativen Regime zu einem europäischen Wohlfahrtsstaat:
Das portugiesische Wohlfahrtssystem..........................................................................483
PL Renata Siemie(cid:218)ska, Anna Domaradzka
Transformation mit Schwierigkeiten:
Das polnische Wohlfahrtssystem..................................................................................503
S Sven O. E. Hort
Sklerose oder ständig in Bewegung?
Das schwedische Wohlfahrtssystem.............................................................................525
SK Hendrik Meyer, Olaf Wientzek
Neoliberales Schreckgespenst oder Vorbild Mittelosteuropas?
Das slowakische Wohlfahrtssystem..............................................................................549
SLO Zinka Kolari(cid:178), Anja Kopa(cid:178), Tatjana Rakar
Schrittweise Reformierung statt ‚Schocktherapie‘:
Das slowenische Wohlfahrtssystem..............................................................................569
EU Wolfram Lamping
Auf dem Weg zu einem postnationalen Sozialstaat?
Die Sozialpolitik der Europäischen Union...................................................................595
III Vergleichende Analysen
Ursula Bazant, Klaus Schubert
Europäische Wohlfahrtssysteme:
Vielfalt jenseits bestehender Kategorien.......................................................................623
Simon Hegelich, Klaus Schubert
Europäische Wohlfahrtssysteme:
Politisch limitierter Pluralismus als europäisches Spezifikum..................................647
IV Anhang........................................................................................................................661
Autorenverzeichnis.........................................................................................................701
Vorwort
Dieses Buch fokussiert auf die Vielfalt europäischer Wohlfahrtssysteme. Es zollt der verglei-
chenden Wohlfahrtsforschung großen Respekt, argumentiert aber, dass gravierende politi-
sche, soziale und ökonomische Veränderungen es notwendig machen, gängige Kategorien
und Typologien zu überdenken. Nicht nur das, die Herausgeber sind der Meinung, dass es
aktuell ratsam ist – bildlich gesprochen – einen Schritt zurück zu treten und sich der empiri-
schen Basis unseres Gegenstandes neu zu versichern. Erst der ‚präkomparative‘ Zugriff lässt
uns wieder näher an das reale Phänomen und auch die neueren Entwicklungen in der Sozi-
al- und Wohlfahrtspolitik heranrücken. Dieser Schritt eröffnet, wie aus den Studien der EU-
25 Staaten eindrucksvoll deutlich wird, eine Vielfalt nationaler Systeme der Wohlfahrtspro-
duktion, -distribution und -konsumption.
Die 25 Länderstudien sind nach einer weitgehend einheitlichen Gliederung verfasst
und variieren vornehmlich hinsichtlich länderspezifischer Details: Nach einer kurzen histo-
rischen Einleitung wird der erreichte Status Quo beschrieben und analysiert: Welche Wohl-
fahrtsleistungen gibt es? In welcher Form stehen sie zur Verfügung? An wen richten sich
diese Leistungen? Nach welchen Kriterien werden sie verteilt? Wer kommt für die anfallen-
den Kosten auf? Die Analyse richtet sich auf Fragen der Verteilung, die Vor- und Nachteile,
die Leistungen und Defizite der jeweiligen Wohlfahrtssysteme. Ein kurzer Ausblick auf
aktuelle Entwicklungen, Fragen und Probleme rundet die Einzelstudien ab. Diese ergän-
zend werden in einem zusätzlichen Beitrag die Spielräume und Grenzen einer europäischen
Sozialpolitik erörtert.
Die Herausgeber schließen den Band einerseits mit einer ersten Aufarbeitung der
„Vielfalt jenseits bekannter Kategorien“ und andererseits mit der politisch-politik-
wissenschaftlichen Behauptung eines für Europa spezifischen „politisch limitierten Plura-
lismus“.
Wer jemals größere Arbeiten wie die vorliegende durchgeführt hat, kann nachvollzie-
hen, dass die Herausgeber einer großen Anzahl von Kollegen und Kolleginnen zu Dank für
Rat, Tat und Kritik verpflichtet sind. Dieser richtet sich insbesondere auch an die Autoren
und Autorinnen aus den EU-25 Staaten für ihre Kooperationsbereitschaft und Ermunterung
dieses Projekt umzusetzen, sowie in vielen Fällen für die Unterstützung und Geduld. Unser
Dank geht weiterhin an die Übersetzer und Übersetzerinnen der vornehmlich englischen
Originaltexte. Dies sind insbesondere Sonja Blum (die unser Projekt in vielen weiteren As-
pekten umsichtig unterstützt hat), Cornelia Fraune, Julia Gieseler, Tabea Bergold, Jochen
Dehling und Hendrik Meyer (ebenfalls ein verlässlicher ‚trouble shooter‘). Ganz besonderer
Dank gehört Cathryn Backhaus für ihren Einsatz bei allen Fragen der z.T. langwierigen
Korrespondenz und Organisation und für ihre zahllosen Hilfen bei den Übersetzungen – es
ist aber vor allem ihre immer freundliche, ausgleichende und umsichtige Art, die das Klima
in unserem ‚Laden‘ immer wieder positiv beeinflusst und so Arbeiten richtig Spaß macht.
Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant Münster im Herbst 2007
I Einleitung
Europäische Wohlfahrtssysteme:
Stand der Forschung –
theoretisch-methodische Überlegungen
Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant
Von außen betrachtet, im Vergleich der Weltregionen, ist das zentrale Merkmal der Europäi-
schen Union sicher das hohe Niveau an Wohlfahrts- und Sozialleistungen. Von innen gese-
hen ist offensichtlich die Pluralität, ja das hohe Maß an Differenzierung und Varianz zwi-
schen den Mitgliedstaaten das zentrale Charakteristikum. Diese Besonderheit – Pluralität
und Varianz – trifft insbesondere auch auf die Wohlfahrtssysteme in den Staaten der EU zu.
Das vergleichsweise hohe materielle und finanzielle Leistungsniveau, der z.T. die gesamte
Bevölkerung umfassende Kreis unmittelbarer und mittelbarer Nutznießer und die damit
verbundenen nationalen, innenpolitischen Eigenheiten erklären, dass der Wohlfahrts- und
Sozialpolitik in der politischen Praxis aller Staaten der EU eine besondere Bedeutung zu-
kommt.
Gleiches gilt für die politikwissenschaftliche Forschung und es war gerade die verglei-
chende Wohlfahrtsstaats-Forschung, die hier besondere Pionierarbeit geleistet und wertvol-
le Erkenntnisse hervorgebracht hat. Dabei ist es nicht erstaunlich, dass die empirisch zu
beobachtende Vielfalt, auch weit über den europäischen Rahmen hinaus, bereits früh Versu-
che der theoretischen Systematisierung und Kategorisierung hervorbrachte. Eine besonders
herausragende und bis heute prägende Arbeit teilt die wichtigsten kapitalistischen Ökono-
mien in gerade einmal drei Wohlfahrtsregime ein (Esping-Andersen 1990). Die anhaltende
und sich in letzter Zeit häufende Kritik an dieser Arbeit verweist allerdings auch auf die
Grenzen einer zu stark reduzierenden Typenbildung und Kategorisierung.
Angesichts der – zumindest für die europäische Welt – hohen nationalen Bedeutung
der Wohlfahrts- und Sozialpolitik ist diese theoretische, abstraktions- und typisierungsbe-
dingte politikwissenschaftliche Distanz zum eigentlichen Gegenstand äußerst bemerkens-
wert. Ebenso erstaunlich ist, dass nach Einführung bestimmter Kategorien bzw. Wohlfahrts-
staats-, Regime- oder Problem-Typen gerade in der vergleichenden Forschung die Anzahl
der untersuchten oder zur Beweisführung herangezogenen Länder immer recht überschau-
bar blieb. Dies hat zur Folge, dass trotz der insgesamt sehr lebendigen und breiten Wohl-
fahrtsstaatsforschung bisher der Versuch unterblieb, die Vielfalt der europäischen Wohl-
fahrtssysteme wenigstens deskriptiv aufzunehmen. Forschungslogisch ist dies interessant,
weil selbst gute theoretische Verallgemeinerungen dazu führen, den Bezug zu den empiri-
schen Gegebenheiten einzuschränken. Empirisch ist dies interessant, weil alle diese Systeme
in den letzten Jahren einem hohen Reform- und Veränderungsdruck ausgesetzt waren.
14 Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant
Hinzu kommt, dass sich das Bild der europäischen Wohlfahrtssysteme1 durch (a) die unter
dem Schlagwort Globalisierung zusammengefassten Prozesse, (b) durch die fortschreitende
Vertiefung der Europäischen Union, (c) durch die Erweiterung der EU und (4) durch unter-
schiedliche nationale Entwicklungen stark verändert hat. Will man die europäische Perspek-
tive im Rahmen vergleichender Forschung, als Referenz für nationale Untersuchungen oder
als eigenständigen Forschungsgegenstand beibehalten, ist es ratsam, einen aktuellen Über-
blick über den Stand der europäischen Wohlfahrtssysteme zu Grunde zu legen. Hierzu soll
der vorliegende Band beitragen. Zum ersten Mal werden alle Wohlfahrtssysteme der EU-25
anhand derselben Kategorien in ihrer Entwicklung und hinsichtlich ihrer aktuellen Proble-
me analysiert. Dazu haben über 30 Experten aus allen Ländern der EU zusammengearbeitet.
Das Ergebnis ist ein erster Überblick über die Gesamtheit der Wohlfahrtssysteme in Europa,
sozusagen ein Luftbild der europäischen Wohlfahrtslandschaften. Die Auswertung dieser
Aufnahmen ist noch lange nicht abgeschlossen, da die einzelnen Ausschnitte erst durch
vergleichende Arbeiten in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden müssen. In diesem
Sinne kann man den vorliegenden Band als ‚präkomparatistisch‘ bezeichnen. Denn unserer
Auffassung nach bedarf insbesondere die vergleichende Wohlfahrtsforschung zunächst
einer Versicherung ihrer empirischen Grundlage. Unsere These ist, dass die kurz erwähnten
Entwicklungen das theoretische Fundament der Wohlfahrtsforschung in Teilen unterhöhlt
haben. Da sich aus dieser These die strukturellen Leitlinien der Analyse der einzelnen Wohl-
fahrtssysteme ergeben haben, soll sie im Folgenden auf theoretischer Ebene näher ausge-
führt werden. Im Anschluss an die einzelnen Länderbeiträge ist dann zu zeigen, ob und ggf.
in welchem Maße die empirischen Befunde diesen Vorbehalt untermauern.
1 Stand der Forschung2
Die vergleichende europäische Wohlfahrtsstaatsforschung der letzten Jahre lässt sich grob
in drei Hauptlinien unterteilen, die, freilich mit starken Überschneidungen, Sprüngen und
Redundanzen, auch eine holzschnittartige Chronologie der theoretischen Entwicklung die-
ser Disziplin ergeben: Die Entwicklung von Kategorien und Clustern, die Analyse der Re-
duzierung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen (retrenchment) und die Frage nach Konvergenz
und/oder Pfadabhängigkeit zwischen den Wohlfahrtsstaaten.
1.1 Kategorisierung und Clusterbildung
Bereits der Begriff ‚Wohlfahrtsstaat‘ kann als „komparativer Kunstgriff“ (Higgins 1981)
verstanden werden. Ganz bewusst werden hier höchst unterschiedliche institutionelle Ar-
rangements begrifflich gleichgesetzt, ohne dass es eine geeinte Vorstellung gibt, was der
‚Wohlfahrtsstaat' ist. Im weitesten Sinn bezeichnet der Begriff ‚Wohlfahrtsstaat‘ einen be-
1In Anlehnung an die übliche Benennung im englischsprachigen Raum verwenden wir den Begriff 'Wohlfahrt' und
'Wohlfahrtssysteme' in einem weiten Sinne (vgl. Kapitel 2 dieses Beitrages). Der Begriff 'Sozialpolitik' erscheint uns
aufgrund der im deutschen Sprachraum liegenden Fokussierung auf die Sozialversicherungen im europäischen Kon-
text zu eng. Dieses Problem wird im Beitrag zu Deutschland ausführlich aufgegriffen.
2 Wir danken Hendrik Meyer für Vorarbeiten zu diesem Abschnitt.