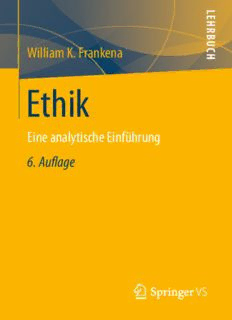Table Of ContentWilliam K. Frankena
Ethik
Eine analytische Einführung
6. Auflage
Ethik
William K. Frankena
Ethik
Eine analytische Einführung
6. Auflage
Herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster
William K. Frankena
Ann Arbor, USA
Die Originalausgabe ist erschienen unter dem Titel „Ethics“ in der „Foundations of
Philosophy“-Series ©1963 by Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J.
ISBN 978-3-658-10747-5 ISBN 978-3-658-10748-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-10748-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
1.-5. Aufl.: © Deutscher Taschenbuchverlag München (DTV) 1972, 1975, 1981, 1986, 1994
6. Aufl.: © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um eine Neuausgabe des von mir
herausgegebenen und übersetzten Buches William K. Frankena: Analytische
Ethik. Eine Einführung (dtv 51994). Ich darf dazu sagen, dass ich mein späteres
berufliches Interesse an der Moralphilosophie vor allem der Tatsache verdan-
ke, dass ich, als ich mich 1962 zum Jurastudium in den USA aufhielt, an der
University of Michigan in Ann Arbor jene moralphilosophischen Vorlesungen
Professor Frankenas besuchen konnte, die dem 1963 in der Reihe „Foundations
of Philosophy“ erschienenen amerikanischen Originaltext des Buches inhaltlich
entsprachen. Meine Übersetzung bei dtv erschien erstmals 1972.
Das Buch zeichnet sich meines Erachtens auch heute noch gegenüber gängigen
Einführungen in die Ethik dadurch aus, dass es eine sachliche Information über
die Kernthesen ethischer Klassiker mit einer gleichzeitig kritischen Erörterung
dieser Kernthesen auf eine leicht verständliche und sehr klare Weise verbindet.
Was den Aufbau des Buches und seine Themenbereiche angeht, so spricht das
Inhaltsverzeichnis des Buches für sich. Auf eine sehr wichtige, von Frankena
thematisierte Unterscheidung im Bereich der Ethik sei an dieser Stelle jedoch
schon ausdrücklich hingewiesen. Ich meine die Unterscheidung zwischen der
normativen Ethik und der sogenannten Metaethik.
Während es in der normativen Ethik darum geht, welche moralischen
Normen und Prinzipien die Menschen vernünftigerweise für ihre Lebenspraxis
akzeptieren und befolgen sollten, geht es in der Metaethik um die philosophi-
sche Grundfrage, auf welche Weise – mittels welcher Methode – die gesuchten
Moralnormen sich, falls überhaupt, für jedermann rational begründen lassen.
Von Relevanz ist in diesem Zusammenhang ebenfalls die Frage, welche genaue
Bedeutung wir in unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch mit Begriffen wie
„Moral“ und „Moralbegründung“ verbinden.
Es entspricht dem einführenden Charakter des Buches, dass Frankena der
normativen Ethik und ihren unterschiedlichen Theorien den größten Raum
V
VI Vorwort
gibt (in den Kapiteln 1-5), das Thema der Metaethik dagegen relativ kurz
behandelt (in Kapitel 6). Auf diese Weise wird besonders dem Anfänger die
Möglichkeit gegeben, die eigentliche Begründungsfrage der Ethik erst in Angriff
zu nehmen, nachdem er für die Lebenswirklichkeit schon Moralprinzipien
gefunden hat, die ihn nach sorgfältiger Abwägung der möglichen Alternativen
überzeugen können.
Norbert Hoerster
Inhalt
Vorwort .............................................................. V
1 Moral und Moralphilosophie ....................................... 1
Ein Beispiel ethischen Philosophierens (Sokrates) ...................... 1
Das Wesen der Ethik oder Moralphilosophie .......................... 4
Das Wesen der Moral .............................................. 6
Aspekte der Moral ................................................. 9
Arten normativer Urteile .......................................... 10
Programm für den Rest des Buches ................................. 11
2 Egoistische und deontologische Theorien ........................... 13
Die wesentliche Frage ............................................. 13
Die Wichtigkeit von Faktenkenntnis und begrifflicher Klarheit ......... 13
Die herrschenden Normen als Verhaltensmaßstab .................... 14
Teleologische Theorien ............................................ 15
Deontologische Theorien .......................................... 18
Der ethische Egoismus ............................................ 19
Der psychologische Egoismus ...................................... 22
Handlungsdeontologische Theorien ................................. 24
Regeldeontologische Theorien ...................................... 27
Die Theorie Kants ................................................. 30
3 Utilitarismus und Gerechtigkeit ................................... 35
Der Utilitarismus ................................................. 35
Zwei Formen des Utilitarismus ...................................... 36
Der Handlungsutilitarismus ....................................... 38
Der Regelutilitarismus ............................................. 39
Ein Lösungsvorschlag ............................................. 42
VII
VIII Inhalt
Zwei Fragen ...................................................... 42
Das Prinzip des Wohlwollens ....................................... 44
Das Prinzip der Gerechtigkeit: Gleichheit ............................ 46
Zusammenfassung unserer Theorie der Verpflichtung ................. 50
Die Ethik der Liebe ............................................... 50
Einige weitere Probleme ........................................... 54
4 Moralischer Wert und Verantwortlichkeit .......................... 57
Moralische und außermoralische Bedeutungen von „gut“ .............. 57
Moral und die Ausbildung des Charakters ........................... 59
Theorien moralischer Werte: Welche Charaktereigenschaften sollen
wir ausbilden ? ................................................... 60
Sein und Handeln: Moral der Eigenschaften oder der Prinzipien ? ...... 63
Sittliche Ideale .................................................... 65
Zwei Fragen ...................................................... 65
Moralische Verantwortlichkeit ..................................... 66
Willensfreiheit und Verantwortlichkeit .............................. 68
5 Eigenständige Werte und das gute Leben ........................... 75
Vorbemerkungen ................................................. 75
„Gut“ und seine Bedeutungen ...................................... 76
Theorien über das in sich Gute: Der Hedonismus ..................... 79
Für und wider den Hedonismus – Argument I ........................ 82
Für und wider den Hedonismus – Argument II ....................... 84
Einige Folgerungen ............................................... 86
Das gute Leben ................................................... 88
6 Sinn und Rechtfertigung .......................................... 91
Die Metaethik und ihre Fragen ..................................... 91
Theorien der Rechtfertigung ....................................... 92
Definitionstheorien naturalistischer und metaphysischer Art .......... 94
Der Intuitionismus ................................................ 99
Nonkognitivistische oder nondeskriptivistische Theorien ............. 102
Der Relativismus ................................................ 107
Eine Theorie der Rechtfertigung ................................... 109
Warum moralisch sein? .......................................... 112
Literatur ........................................................... 115
Moral und Moralphilosophie 1
1 Moral und Moralphilosophie
Nehmen wir an, Sie haben sich Ihr ganzes Leben lang bemüht, ein guter Mensch
zu sein, Ihre Pflicht nach bestem Wissen zu erfüllen und an das Wohl Ihrer Mit-
menschen zu denken. Angenommen auch, viele Ihrer Mitmenschen sind gegen Sie,
Ihr Tun missfällt ihnen, sie sehen in Ihnen gar eine Gefahr für die Gesellschaft,
ohne jedoch beweisen zu können, dass Sie es sind. Nehmen wir ferner an, Sie
werden angeklagt, vor Gericht gestellt und von einem Geschworenengericht von
Ihresgleichen zum Tode verurteilt, und zwar in einer Weise, die Ihnen mit Recht
ungerecht erscheint. Angenommen schließlich, Ihre Freunde haben, während Sie
in der Haft auf die Urteilsvollstreckung warten, alles vorbereitet, damit Sie fliehen
und mit Ihrer Familie ins Exil gehen können. Ihre Freunde machen geltend, dass
sie die nötigen Bestechungsgelder aufbringen können und sich durch die Beihilfe
zu Ihrer Flucht keiner Gefahr aussetzen; dass Sie das Leben noch länger genießen
können, wenn Sie fliehen; dass es für Ihre Frau und für Ihre Kinder besser wäre;
dass Ihre Freunde Sie weiterhin besuchen können, und dass man im allgemeinen
für Ihre Flucht sein wird. Würden Sie die Gelegenheit ergreifen?
Ein Beispiel ethischen Philosophierens (Sokrates)
Ein Beispiel ethischen Philosophierens (Sokrates)
In dieser Lage befindet sich Sokrates, der Vater der Moralphilosophie, zu Beginn
von Platons Dialog „Kriton“. Dieser Dialog gibt uns Antwort auf unsere Frage und
berichtet ausführlich, welche Überlegungen Sokrates zu dieser Antwort kommen
lassen; er eignet sich daher gut als Ausgangspunkt unserer Untersuchung. Sokrates
macht zunächst einige Bemerkungen über das geeignete Verfahren zur Behand-
lung der Frage. (i) Wir dürfen uns bei unserer Entscheidung nicht von Gefühlen
beeinflussen lassen, wir müssen vielmehr die Frage untersuchen und uns allein von
Argumenten leiten lassen. Wir müssen versuchen, die reinen Fakten zu ermitteln
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 1
W. K. Frankena, Ethik, DOI 10.1007/978-3-658-10748-2_1
2 1 Moral und Moralphilosophie
und einen klaren Kopf zu behalten. Fragen wie diese kann und soll die Vernunft
entscheiden. (2) Wir können uns in solchen Fragen nicht auf das berufen, was Leute
im allgemeinen darüber denken; sie können sich irren. Wir müssen versuchen, eine
Antwort zu finden, die wir selbst als richtig ansehen können. Wir dürfen uns das
Denken nicht von anderen abnehmen lassen. (3) Wir sollten nie tun, was mora-
lisch falsch ist. Nur die Frage, ob unser Verhalten richtig oder falsch ist, müssen
wir beantworten, nicht aber, was mit uns geschehen wird, was die Leute von uns
denken werden oder mit welchen Gefühlen wir dem Vorgefallenen gegenüberstehen.
Hiernach gibt Sokrates im Wesentlichen drei Argumente dafür, dass er nicht
durch seine Flucht die Gesetze brechen sollte. (1) Wir sollten nie jemanden schä-
digen. Sokrates’ Flucht würde den Staat schädigen, denn sie wäre eine Verletzung
und eine Missachtung der Staatsgesetze. (2) Lebt man auf Dauer in einem Staat,
den man verlassen könnte, so erklärt man sich stillschweigend einverstanden, den
Gesetzen dieses Staates zu gehorchen; würde Sokrates fliehen, so bräche er demnach
eine Abmachung, und so etwas sollte man nicht tun. (3) Die Gesellschaft und der
Staat, denen man angehört, haben praktisch die Funktion von Eltern oder Lehrern,
und seinen Eltern und Lehrern sollte man gehorchen.
In jedem dieser Argumente beruft sich Sokrates auf eine allgemeine moralische
Regel, die er und sein Freund Kriton nach reiflicher Überlegung als gültig aner-
kennen: (1) Wir sollten nie jemanden schädigen, (2) wir sollten unsere Versprechen
halten und (3) wir sollten unseren Eltern und Lehrern Gehorsam und Respekt
erweisen. In allen drei Fällen zieht er noch eine weitere Prämisse heran, die eine
Tatsachenbehauptung ist und die Regel auf den gegebenen Fall anwendet: (1) Wenn
ich fliehe, füge ich der Gesellschaft Schaden zu, (2) wenn ich fliehe, breche ich ein
Versprechen, und (3) wenn ich fliehe, erweise ich mich ungehorsam gegenüber meinen
Eltern und Lehrern. Hieraus schließt er auf das, was er in seiner besonderen Lage
tun sollte. Wir haben hier ein Musterbeispiel ethischer Argumentation vor uns.
Sokrates ist in diesem Fall der Meinung, dass seine drei Prinzipien alle zu
demselben Schluss führen. Dies trifft aber nicht immer zu, wenn zwei oder mehr
Regeln auf denselben Fall angewandt werden. Tatsächlich entstehen die meisten
moralischen Probleme in Situationen, in denen ein „Widerstreit der Pflichten“ vor-
liegt, d. h. wo ein moralisches Prinzip in die eine Richtung weist und ein anderes
in eine andere Richtung. In seiner „Apologie“ lässt Platon Sokrates sagen, dass er
nicht gehorchen werde, wenn der Staat sein Leben unter der Bedingung schont,
dass er seine bisherige Weise zu lehren aufgibt, denn (4) die Pflicht zu lehren sei
ihm vom Gott Apollon auferlegt worden, und (5) sein Lehren sei zum wahren
Wohl des Staates notwendig. Damit wäre er in einen Pflichtenkonflikt verwickelt.
Denn einerseits hat er die Pflicht, dem Staat zu gehorchen, andererseits aber die
beiden Pflichten (4) und (5), und diese haben nach seinem Urteil den Vorrang vor
Description:W. K. Frankenas kleine „Ethik“ ist aus gutem Grund ein moderner Klassiker unter den philosophischen Lehrbüchern. Das Buch bietet einerseits eine sehr gut verständliche und knappe Einführung in alle wichtigen Themen der Ethik, in ihre Grundbegriffe und in die wichtigsten theoretischen Ansätze