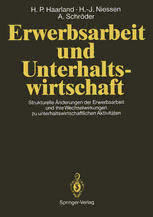Table Of ContentH. P. Haarland . H.-J. Niessen
A. Schroder
Erwerbsarbeit und
U nterhaltswirtschaft
Strukturelle Anderungen der Erwerbsarbeit und
ihre Wechselwirkungen zu unterhaltswirtschaft
lichen AktiviHiten
Mit 48 Abbildungen
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg N ew York
London Paris Tokyo
Hong Kong Barcelona
Prof. Dr. Hans Peter Haarland
Prof. Dr. Hans-Joachim Niessen
Dipl.- Soz.wiss. Antonius Schroder
Forschungsstelle fUr Empirische Sozialokonomik
(Prof. Dr. O. Schmolders) E.Y.
KlosterstraJ3e 1
D-5000 Koln 41 (Lindenthal), FRO
Gefordert mit Mitteln der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn
ISBN-13: 978-3-642-75916-1 e-ISBN-13: 978-3-642-75915-4
DOl: 10.1007/978-3-642-75915-4
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der
Ubersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendungen, der Mikroverfilmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der Spei
cherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehal
ten. Eine Vervielfaltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in
den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland Yom 9. September 1965 in der Fassung Yom 24. Juni 1985 zulassig. Sie ist grundsatz
lich vergiitungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungert des Urheber
rechtsgesetzes.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1990
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1990
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen im
Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher
von jederrnann benutzt werden diirften.
2142/7130-543210
Wir danken der Konrad-Adenauer-Stiftung (Bonn) fUr die finanzielle
Unterstiitzung der vorliegenden Stu die und ihrer Veraffentlichung. Unser
besonderer Dank gilt den Mitgliedern des forschungsbegleitenden Ar
beitskreises "Erwerbsarbeit und Schattenwirtschaft" fiir ihre Mitarbeit
und ihre inhaltlichen Anregungen:
Dr. Reiner Baumeister
Politische Akademie der Konrad - Adenauer-Stiftung
Dr. DeUef Grieswelle
Politische Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung
Dr. Charlotte Hahn
Direktorin des Bundesinstituts fiir Bevalkerungsforschung
Gerhard Schulte
Ministerialrat im Bundeskanzleramt
Helmut Stahl
Ministerialdirektor im Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung
(Grundsatz- und Planungsabteilung)
Heinrich Sudmann
Regierungsdirektor im Bundesministerium fiir Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit (Referatsleiter "Allg. und Grundsatzfragen der Fami
lienpolitik")
Klaus Weigelt
Politische Akademie der Konrad - Adenauer-Stiftung (Akademieleiter)
Paul B. Wink
Konrad - Adenauer-Stiftung (Verwaltungsd irektor)
Richard Zimmer
Ministerialdirigent im Bundesministerium filr Arbeit und Sozialordnung
(Leiter der Unterabteilung "Gesellschafts-, wirtschafts und finanz-
politische Fragen der Sozialpolitik)
Inhaltsverzeichnis:
Seite
I. Theoretischer Hintergrund
1. Problemstellung ................................................................................ 1
2. Gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Veran-
derungsprozesse im Erwerbs- und Unterhaltssektor ........................ 2
2.1. Veranderungen im Unterhaltssektor (Haushalt und Fa-
milie) ............................................................................................ 4
2.1.1. Soziodemographische Veranderungen .......................................... 4
2.1.2. Veranderungen im Zeit budget .................................................. 11
2.1.3. Okonomische Veranderungen .................................................... 14
2.1.3.1. Erwerbseinkommensentwicklung ............................................ 14
2.1.3.2. Konsumstrukturentwicklung .................................................. 15
2.1.3.3. Vermogensentwicklung .......................................................... 16
2.2. Veranderungen im Erwerbssektor ................................................ 17
2.2.1 Quan ti ta ti ve Veranderungen ................................................... 17
2.2.1.1. Kontinuierliche Verkiirzung der Erwerbsarbeitszeit
(Wochen-, Jahres-, Lebensarbeitszeit) ................................ 17
2.2.1. 2. Flexibilisierung der Erwerbsarbeitszeit ............................... 17
2.2.1.3. Riickgang der Erwerbstatigen durch Modernisie-
rungs- und Rationalisierungstendenzen ............................... 18
2.2.2. Qualitative Veriinderungen ...................................................... 19
2.2.2.1. Veranderung der Arbeitsinhalte durch neue Pro-
duktions- und Kommunikationstechnologien ........................ 19
2.2.2.2. Qualifizierungspolarisation ................................................... 19
2.2.2.3. Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft ................................ 20
2.2.2.4. Neue Wertvorstellungen ....................................................... 21
2.3. Reaktionen der privaten Haushalte auf die Verande-
rungen ........................................................................................ 23
VIII
Seite
3. Theoretischer Rahmen der Untersuchung ....................................... 24
3.1. Die ZeitalJokationsentscheidung privater Haushalte -
Erwerbszeit und Unterhaltszeit in der okonomischen
Theorie ....................................................................................... 24
3.1.1. Zeit in der vorindustriellen alteuropaischen Epoche .............. 24
3.1. 2. Zeit in der neuzeitlichen Epoche der entwickelten
Marktwirtschaft ....................................................................... 24
3.1. 3. Die okonomische Theorie der Zeitallokation privater
Haushalte ................................................................................ 25
3.1. 4. Anwendungsmoglichkeiten der Theorie der Zeitalloka-
tion ......................................................................................... 29
3.1. 5. Kritik an der rationalokonomischen Theorie der Zeit-
allokation ................................................................................ 30
3.2. Umrisse einer sozial wissenschaftlichen Analyse des
Entwicklungszusammenhangs von Erwerbs- und Unter-
haltssystem ................................................................................. 30
3.2.1. Die Dominanz des Unterhaltssystems in der vorindu-
striell-alteuropaischen Epoche ............................................... 32
3.2.2. Die Ausdifferenzierung des modernen marktwirt-
schaftlichen Erwerbs- und Unterhaltssystems ........................ 33
3.2.3. Die "postmoderne" Situation von Haushalt und Fami-
lie ........................................................................................... 38
II. Empirische Erhebung
4. Methodische Umsetzung .................................................................. 43
4.1. Analyserahmen ............................................................................ 43
4.1.1. Analytisches Vorgehen ............................................................ 43
4.1. 2. Untersuchungsdimensionen der empirischen Erhe-
bung ........................................................................................ 47
4.1.3. Entwicklung von Individual-, Haushalts- und Le-
benszyklustypologien ............................................................... 57
IX
Seite
4.2. Durchfiihrung der empirischen Befragung ("Feldphase") ............. 69
4.2.1. Erhebungsmethode ................................................................... 69
4.2.2. Grundgesamtheit und Stichprobenziehung ................................ 61
4.2.3. Befragungsstatistik ................................................................. 62
5. Empirische Ergebnisse .................................................................... 67
5.1. Hintergrundanalyse Erwerbssektor .............................................. 67
5.1.1. Objektive Eingebundenheit der Haushalte in den Er-
werbssektor ............................................................................. 67
5.1.2. Subjektive Erwerbssektororientierung (erwerbssektor-
bezogene Praferenzen) ............................................................. 76
5.1. 3. Eingebundenheit in den Erwerbssektor (Zusammen-
fassung) .................................................................................. 90
5.2. Hintergrundanalyse Unterhaltssektor .......................................... 93
5.2.1. Objektive Eingebundenheit der Haushalte in den Un-
terhaltssektor (Haushaltsanalyse) ........................................... 93
5.2.1.1. Materielle Haushaltsressourcen ............................................ 96
5.2.1.2. ImmaterieUe Haushaltsressourcen ("Humankapi-
tal") ................................................................................... 101
5.2.1.3. Haushaltsorganisation ........................................................ 106
5.2.1.4. Soziale Vernetzung ............................................................. III
5.2.2. Subjektive Eingebundenheit der Haushalte in den
Unterhaltssektor (Unterhaltspraferenzen) ............................. 120
5.2.2.1. Verhaltnis von Erwerbs- und Unterhaltsorientie-
rungen ............................................................................... 121
5.2.2.2. Unterhaltsorientierungen .................................................. 123
5.2.3. Eingebundenheit in den Unterhaltssektor (Zusammen-
fassung) ................................................................................ 134
x
Seite
5.3. Zeitbudgetanalyse ................................................................... 138
5.3.1. Zeitpriiferenzen (offenes Zeitsystem) .................................... 139
5.3.2. Derzeitige und gewiinschte Zeitallokation (geschlos-
senes Zeitsystem) .................................................................. 145
5.3.3. Zeitbudgetallokation (Zusammenfassung) ............................... 167
5.4. Auswirkungen des Erwerbssektors auf den Unterhalts-
sektor ....................................................................................... 170
5.4.1. Okonomisch bedingte Auswirkungen ...................................... 170
5.4.2. Priiferenzbedingte Auswirkungen ........................................... 173
5.4.3. Auswirkungen auf die Zeitallokation .................................... 175
5.4.3.1. Okonomischer Hintergrund und Zeitbudget. ........................ 175
5.4.3.2. Auswirkungen erwerbssektorbedingter Einstellungen
auf das Zeitbudget ............................................................ 181
5.4.4. Erwerbssektorbedingte Einfliisse auf den Unterhalts-
sektor (Zusammenfassung) ..................................................... 184
5.5. Individualtypologie ................................................................... 187
5.5.1. Einstellungsbezogene Typisierung ......................................... 187
5.5.2. Zeitbudgetbezogene Typisierung ............................................ 189
5.5.2.1. Zeitpriiferenzen (offenes Zeitsystem) ................................. 189
5.5.2.2. Gewiinschte Zeitbudgetallokation (geschlossenes
Zeitsystem) ........................................................................ 190
5.5.2.3. Derzeitige Zeitbudgetal1okation .......................................... 193
5.5.3. Zusammenfassung ................................................................... 194
6. Zusammenfassung und Schlul3folgerungen ..................................... 197
6.1. Individual-. Haushalts- und Lebenszyklustypisierung ............. 197
6.1.1. Haushalts- und Lebenszyklustypen ....................................... 197
6.1.2. Individualtypen ..................................................................... 208
6.2. Die Interdependenz von Erwerbs- und Unterhaltssek-
tor ............................................................................................ 209
6.2.1. Zentrale Ergebnisse ............................................................... 209
6.2.2. Schlu/3folgerungen fUr das Verhiiltnis von Erwerbs-
und Un terhal tssektor ............................................................ 215
XI
Seite
III. Politische Implikationen
7. Politische Implikationen ............................................................... 221
7.1. Unterhaltswirtschaftliche Konsequenzen ................................... 221
7.1.1. Aufwertung der Unterhaltswirtschaft .................................... 224
7.1.1.1. Grundleistungen als Voraussetzung der Aufwer-
tung ................................................................................... 226
7.1.1. 2. Steuerungsprobleme als Grenzen der Aufwertung .............. 227
7.1.1.3. Bedarfswirtschaftliche Ergiinzung der Sozialpoli-
tik ...................................................................................... 230
7.1.1.4. Lebensphasen - und bevolkerungsgruppenspezifische
Zeitumschichtungen ............................................................ 233
7.1.2. F6rderung der Unterhaltswirtschaft (Zusammenfas-
sung) ..................................................................................... 236
7.2. Familienpolitische Konsequenzen .............................................. 238
7.2.1. Der Zustand der Familie heute ............................................. 238
7.2.2. Ansatzpunkte fUr familienpolitische Ma[3nahmen ................... 242
7.2.3. Familienpolitischer Handl ungsbedarf ..................................... 247
7.2.3.1. "Neue" Familienpolitik ....................................................... 247
7.2.3.2. Familienpolitik und Erwerbssystem .................................... 248
7.2.4. Zusammenfassung ................................................................... 252
Anhang
A.1. Literaturverzeichnis ................................................................. 255
A. 2. Einstellungsvorgaben zur Berufstiitigkeit ................................. 270
- 1 -
1. Problemstellung
Das besondere wissenschaftliche sowie wirtschafts-, sozial- und fa
milienpolitische Interesse an einer empirisch orientierten Analyse der
sozialokonomischen Wechselbeziehungen zwischen dem formellen erwerbs
wirtschaftlichen Sektor von Arbeit, Beruf, Produktion und dem unter
haltswirtschaftlichen Sektor von Konsum, Unterhaltsproduktion, Erzie
hung, Freizeit im Haushalt und in der Familie grlindet sich darauf, da!)
sich in den letzten zehn bis zwaJlzig Jahren grundlegende Veranderun
gen in beiden zentralen Sektoren unserer Volkswirtschaft angebahnt und
vollzogen haben, die zu - auch gesamtgesellschaftlich relevanten -
neuen Formen des Verhaltnisses von Erwerbssektor und Unterhaltssektor
fiihren werden. Die tradition ellen Strukturen gesellschaftlicher Arbeits
teilung und Rollenzuweisung losen sich auf: paradigmatisch etwa das
liber lange Zeit fast ausschliel3lich dominierende Modell des lebenslang
erwerbstatigen Ehemannes, der mit seinem Erwerbseinkommen allein die
marktabhangige Unterhaltssicherung gewahrleistet, und der ebenso le
benslang in Familie und Haushalt unterhalts- und hauswirtschaftlichta
tigen Ehefrau, die liberwiegend allein fUr Unterhaltsarbeit und Haus
haltsproduktion zustandig ist.
Wir befinden uns zur Zeit mitten in diesen okonomischen, sozialen
und demographischen Veranderungsprozessen, die gleichsam den Horizont
fUr neue Formen und Strukturen im Miteinander, Nebeneinander und
Gegeneinander von Erwerbs- und Unterhaltssektor definieren. Diese
Veranderungen mu!) eine sozialwissenschaftlich-okonomische Theoriebil
dung liber Haushalt, Familie, Erwerbssystem, Arbeitsmarkt usw., jeden
falls sofern sie mit dem AnsprlJch empirischer Erfahrungswissenschaft
auft ritt, ebenso zur Kenntnis nehmen wie die von diesen Veranderungen
betroffenen Bereiche der Politik. Viele Politikfelder, von der Wirt
schafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial-, Bevolkerungs-, Rentenpolitik bis zur
Familienpolitik, sind angesprochen. Letzterc soll hier im Hinblick auf
mogliche familienpolitische Konsequenzen der Analyse im Mittelpunkt
stehen.
Die wichtigsten Veranderungen im Erwerbs- und UHterhal1.ssektor
sollen hier nicht im einzelnen nach moglichen Erklarungsmodellen oder
-theorien erort.ert werden, sondern jeweils nur in ihrer empirischen
Faktizitat systematisiert werden, da sie lediglich den gesamtwirtschaft
lichen und gesamtgesellschaftlichen Hintergrund filr die empirische
Analyse der Beziehungen zwischen Erwerbs- und Unterhaltssektor bil
den. Es reicht daher fUr diesen lJntersuchungszweck, die verschiedenen
Veranderungen mit Verweis auf statistische Quellen in synoptischer
Form zusammcnzufassen.