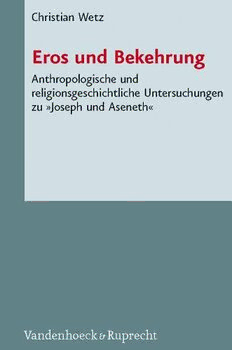Table Of ContentNovum Testamentum et Orbis Antiquus /
Studien zur Umwelt des Neuen Testaments
In Verbindung mit der Stiftung »Bibel und Orient«
der Universität Fribourg/Schweiz
herausgegeben von Max Küchler (Fribourg), Peter Lampe,
Gerd Theißen (Heidelberg) und Jürgen Zangenberg (Leiden)
Band 87
Vandenhoeck & Ruprecht
Christian Wetz
Eros und Bekehrung
Anthropologische und religionsgeschichtliche
Untersuchungen zu »Joseph und Aseneth«
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 27 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-525-54007-7
© 2010, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen.
www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der
vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG:
Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des
Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer
entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke.
Printed in Germany.
Druck und Bindung: b Hubert & Co, Göttingen.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt
Inhalt
Inhalt
Vorwort.........................................................................................................9
Vorbemerkungen.........................................................................................11
1. Zur Einleitung.........................................................................................13
2. Forschungsgeschichtliche Schlaglichter seit Sänger...............................21
2.1 Dieter Sänger
Antikes Judentum und die Mysterien.............................................22
2.2 Angela Standhartinger
Das Frauenbild im Judentum der hellenistischen Zeit....................24
2.3 Randall D. Chesnutt
From Death to Life..........................................................................26
2.4 Gideon Bohak
Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis.............28
2.5 Ross Shepard Kraemer
When Aseneth met Joseph..............................................................31
2.6 Edith McEwan Humphrey
The Ladies and the Cities................................................................33
2.7 Conrad Rees Douglas
Liminality and Conversion in Joseph and Aseneth........................35
2.8 George J. Brooke
Joseph, Aseneth, and Lévi-Strauss.................................................39
2.9 Ertrag...............................................................................................40
3. Zur Textgestalt von JosAs.......................................................................43
3.1 Vorbemerkungen.............................................................................43
3.2 Zur Einteilung in Handschriftenfamilien bis zum Jahre 2003........45
3.3 Zu Burchards neuer Einteilung der Handschriftenfamilien............47
3.4 Zur Geschichte der Ausgaben.........................................................48
3.5 Ertrag. Zur Begründung der Langtextpriorität................................50
6 Inhalt
4. Methodische Grundlegungen..................................................................54
4.1 Begriffsklärungen............................................................................54
4.1.1 Ritus und Ritual............................................................................54
4.1.1.1 Die Begriffe bei verschiedenen Autoren...................................54
4.1.1.2 Kumulative Definition nach Ronald Grimes............................55
4.1.2 Initiation als Bruch im biographischen Kontinuum.....................58
4.2 Arnold van Genneps »rites de passage«.........................................60
4.3 »Betwixt and Between«. Victor Turners Konzepte
der Liminalität und der Communitas..............................................62
4.4 Ritual und Biologie.
Von proximaten und ultimaten Lösungsansätzen...........................68
4.5 Bruce Lincoln. Die weibliche Form der Übergangsriten:
enclosure, magnification, emergence..............................................73
(1) Zur Typologie weiblicher Initiationsrituale..............................75
(a) körperliche Verwandlung..........................................................75
(b) Identifikation mit einer Göttin oder mythischen Heldin...........75
(c) kosmische Reise........................................................................76
(d) Spiel von Gegensätzen..............................................................76
(2) Morphologie weiblicher Initiationsriten...................................76
(3) Teleologie weiblicher Initiationsrituale....................................79
4.5.1 Zur Ambivalenz weiblicher Initiationsrituale........................79
4.5.2 Kritik und Ertrag....................................................................80
4.6 Walter Burkerts Konzept der Mädchentragödie.............................82
4.6.1 Ein Beispiel: Amor und Psyche.............................................83
4.6.2 Die Mädchentragödie als Abbild der drei drama-
tischen Stationen der Wandlung einer Frau..............................85
4.6.3 Weibliche Pubertätsriten als Abbild der drei
dramatischen Stationen der Frauwerdung................................85
4.7 Überlegungen zur Verbindung von anthropologischem
und religionsgeschichtlichem Zugang............................................89
4.8 Semantisch-symbolische Anreicherung
von Wörtern und Motiven...............................................................90
4.9 Ritualität und Textualität................................................................91
Exkurs I. Biologie, Ritus und Hermeneutik.
Die existentiale Dimension von Ritualität..............................100
4.10 Konsequenzen für die Untersuchung von JosAs........................102
Inhalt 7
5. Untersuchung der Wandlung Aseneths.................................................104
5.1 Analyse von JosAs 1,1–21,9 Literarische Repräsentanz von
van Genneps Drei-Stufen-Schema................................................104
5.1.1 Die vier Kleiderwechsel.......................................................105
5.1.1.1 Der Kontext des ersten Kleiderwechsels
(JosAs 3,5f)..................................................................108
5.1.1.2 Der Kontext des zweiten Kleiderwechsels
(JosAs 10,10–14).........................................................120
5.1.1.3 Der Kontext des dritten Kleiderwechsels
(JosAs 14,14f)..............................................................122
5.1.1.4 Der Kontext des vierten Kleiderwechsels
(JosAs 18,5f)................................................................124
5.2 Literarische Repräsentanz der Kennzeichen
des Liminalen in der Wandlung Aseneths....................................126
5.3 Zwischenergebnis..........................................................................131
Exkurs II. Einige Anmerkungen zu Sängers Falsifikation eines
mysterientheologischen Hintergrundes und
seiner Rekonstruktion eines Proselytenaufnahmeformulars...132
5.4 Literarische Repräsentanz von Aspekten
weiblicher Initiationsrituale nach Bruce Lincoln..........................136
Zur Lincolnschen Typologie weiblicher Initiationsrituale...........136
Zur Lincolnschen Morphologie weiblicher Initiationsrituale.......137
Zur Lincolnschen Teleologie weiblicher Initiationsrituale...........141
Exkurs III. Burchards Vergleich des Märchens
von Amor und Psyche mit JosAs............................................143
5.5 Die Wandlung Aseneths als Mädchentragödie gelesen................148
5.5.1 Kritik an Burkerts Konzept der Mädchentragödie
und Konsequenzen für das Verständnis
der Wandlung Aseneths.......................................................152
Exkurs IV. Eine kurze Apologie...................................................155
5.5.2 Theologische und anthropologische/
gynaikologische Implikationen............................................158
6. Religionsgeschichtliche Orientierung...................................................168
6.1 Religionsgeschichtliche Rückverfolgung der Biene
als kultisches, rituelles und religiöses Motiv................................168
6.1.2 Die Bienen der antiken Göttinnen und die Große Göttin....170
6.1.3 Wabenbau auf den Mündern
späterhin prominenter Persönlichkeiten...............................180
6.1.4 Ertrag....................................................................................184
8 Inhalt
6.2 Religionsgeschichtliche Rückverfolgung
des doppelten Gürtels der Jungfrauschaft.....................................187
6.2.1 Etymologisches....................................................................188
6.2.2 Wörter für »Gürtel« im Griechischen..................................189
6.2.3 Ethnographisches und Mythologisches...............................192
6.2.4 Aseneths (cid:100)(cid:158) (cid:99)(cid:116)(cid:159)(cid:105)(cid:100) (cid:100)(cid:158) (cid:98)(cid:102)(cid:47)(cid:104)(cid:100)(cid:126) (cid:111)(cid:100)(cid:126)(cid:153) (cid:47)(cid:95)(cid:108)(cid:101)(cid:161)(cid:105)(cid:102)(cid:159)(cid:95)(cid:153).......................194
6.2.4.1 Darstellungen doppelter Gürtel
im frühen Mittelmeerraum...................................................200
6.2.4.2 Die religionsgeschichtliche Herkunft
des Sautoir der Aphrodite.....................................................204
6.2.5 Ertrag....................................................................................215
7. Schluss?.................................................................................................220
Forschungsdesiderata..........................................................................225
8. Literaturverzeichnis...............................................................................229
8.1 Quellen..........................................................................................229
8.1.1 Bibelausgaben......................................................................229
8.1.2 JosAs-Ausgaben...................................................................229
8.1.3 Jüdische Texte......................................................................230
8.1.4 Christliche Texte außerhalb des Neuen Testament
einschließlich Kirchenväter..................................................230
8.1.5 Pagane griechische und lateinische Texte...........................231
8.1.6 Weitere Quellen...................................................................232
8.2 Hilfsmittel.....................................................................................233
8.2.1 Wörterbücher und Grammatiken.........................................233
8.2.2 Elektronische Hilsmittel......................................................233
8.3 Sekundärliteratur...........................................................................233
Abbildungsnachweise...............................................................................249
Register......................................................................................................250
Vorwort
Die vorliegende Untersuchung ist die leicht veränderte Fassung einer Ar-
beit, die im Sommersemester 2008 an der Theologischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Inauguraldissertation einge-
reicht wurde. Sie wäre nicht zustande gekommen ohne die Unterstützung
und das Wohlwollen einer ganzen Reihe von Personen. Die in diesem Zu-
sammenhang bedeutendsten sollen an dieser Stelle namentlich aufgeführt
werden.
Mein Dank gilt zuvorderst Prof. Dieter Sänger (Universität Kiel), dem
geistigen Vater, langjährigen Weggefährten und Betreuer der Arbeit. Ohne
seinen Rat, ohne seinen Zuspruch, ohne seine ermunternden Worte und
ohne seine Offenheit für ungewohnte Zugänge zu antiken Texten wäre die
Arbeit wohl nie zustande gekommen. Zum zweiten gilt mein Dank meinem
langjährigen Vorgesetzten, Prof. Lukas Bormann (Universität Bayreuth,
jetzt Erlangen), für seine Nachsicht und Geduld und die gezielte Entlastung
von Lehrstuhltätigkeiten. Zu danken habe ich auch der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (EKHN), die mein Projekt großzügig und ge-
wohnt unbürokratisch mit einem Lutherstipendium förderte. An dieser
Stelle soll auch mein Lehrer in Biophilosophie erwähnt werden, dessen
Vorlesungen und intensive Gesprächskreise mein Denken nachhaltig beein-
flusst haben: Prof. Eckart Voland (Zentrum für Philosophie und Grundlagen
der Wissenschaft der Universität Gießen). Der EKHN ebenso wie dem
Förderverein der Kieler Theologischen Fakultät Societas Theologicum Or-
dinem Adiuvantium (S.T.O.A.) ist für Druckkostenzuschüsse zu danken.
Den Herausgebern der Reihe NTOA/StUNT – namentlich Max Küchler,
Peter Lampe, Gerd Theißen und Jürgen Zangenberg – danke ich für die
freundliche Aufnahme des Opus, dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht –
namentlich Christoph Spill – für die hervorragende Betreuung. Gerd Thei-
ßen sei darüber hinaus für den geistreichen und verkaufsförderlichen Titel
der Arbeit gedankt.
Wem ebenfalls ausdrücklich Dank zu schulden ist, ist mein Bayreuther
Kollegenkreis. Die Gespräche der mittäglichen Mensarunde zeitigten zwei-
erlei: willkommene Zerstreuung und der Arbeit zuträgliche Fachdiskurse,
insonderheit mit den Vertretern der Ethnologie und der konfessionslosen
Zunft der Religionswissenschaft.