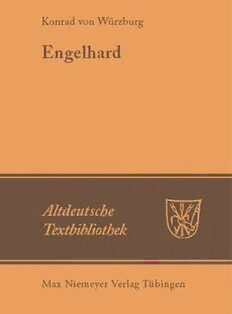Table Of ContentA L T D E U T S C HE Τ Ε Χ Τ ΒI ΒLIΟΤΗ Ε Κ
Begründet von Hermann Paul
Fortgeführt von Georg Baesecke und Hugo Kuhn
Herausgegeben von Burghart Waehinger
Nr. 17
Konrad von Würzburg
Engelhard
Herausgegeben
von
Ingo Reiffenstein
3., neubearbeitete
Auflage der
Ausgabe von Paul Gereke
MAX NIEMEYER VERLAG
TÜBINGEN 1982
1. Anflöge 1912, hrsg. von Paul Gereke
2. Auflage 19β,1, bea rb. von Ingo Reiffensteiii
INHALT
Einleitung V
1. Überlieferung und Edition V
2. Amicus und Amelius XII
3. Engelhard: Zu Entstehung, Interpretation und Nach-
wirkung XVI
Bibliographie XXV
Abbildungen aus dem Druck 1573 XXVIII
Text (Parallelabdruck des Druckes S. 2-6) 1
Anhang:, Amicus und Amelius' in mhd. Übersetzung 241
Hugo Kuhn
zum Gedenken
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Konrad (von Würzburg):
Engelhard / Konrad von Würzburg. Hrsg. von Ingo Reiffenstein. -
3., neeuubbeeaarrbb.. AAuuffll.. dd.. AAuussgg.. vvoonn PPaauull GGeerreekkee.. -- TTüübbiinnggeenn :: NNiieemmeeyyeerr,, 11 982.
((AAllttddeeuuttsscchhee TTeexxttbbiibblliiootthheekk ;; NNrr.. 1177))
NNEE:: RReeiiffffeennsstteeiinn,, IInnggoo [[HHrrssgg..]];; GGTT
Geb. Ausgaibbee IISSBBNN 33--448844--2211111177--22 KKaarrtt.. AAuussggaabbee IISSBBNN 33--118844--2200111177--77 IISSSSN h 0342-6661
© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1982
Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany
Druck: Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Kempten/Allgäu
EINLEITUNG
1. Überlieferung und Edition
Der , Engelhard' Konrads von Würzburg ist uns nur
durch einen 1573 in Frankfurt am Main bei Kilian Han1)
erschienenen Druck überliefert. Dieser Druck ist in fol-
genden vier Exemplaren erhalten:
1. Wolfenbüttel Wf 166 Poet, (von Lessing entdeckt,
Textgrundlage Haupts und aller späteren Heraus-
geber);
2. Wolfenbüttel Wf 163.2 Poet, (früher Cim: 96).
3. Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Yg 2861
(bis 1909 in der Kirchen-Ministerial-Bibliothek zu
Celle).
4. Göttingen, Universitätsbibliothek 8° Poet. Germ. I,
97712).
') Über die Frankfurter Familie Gülfferich, Han und Erben
vgl. E. H. G. Klöss, Der Frankfurter Drucker-Verleger Weigand
Han und seine Erben, Arch. f. Gesch. d. Buchwesens 2, 1960,
309-374, über Kilian Han 337f.; im Zentrum der Produktion
1540-1581 steht volkstümliche Literatur, insbesondere Volksbü-
cher, vielfach versehen mit Holzschnitten (347ff. ein Verzeichnis
aller Titel, Nr. 303 Engelhard).
') Die Überlieferung zusammengestellt von C. W. Edwards
(1972) 145, dem die Entdeckung des zweiten Wolfenbütteler Ex-
emplaires zu verdanken ist. Aus dem ersten Wolfenbütteler Ex-
emplar hatte bereits Lessings Freund J. J. Eschenburg in Boies
Deutschem Museum 1776, I, 131 ff. die ersten Proben des .Engel-
hard' mitgeteilt; vgl. G. A. H. Wolff, AfdA 19, 1893, 150.
VI
Das Buch trägt den Titel: Ein schöne Historia von Engel-
hart auß Burgunt / Hertzog Dietherichen von Brabant
/ seinem Gesellen / und Engeldrut / deß Kbnigs Tochter
auß Dennmarck / wie es jhnen ergangen / und was jam-
mers und not sie erlitten / Gantz lustig und kurtzweilig zu
läsen. Vormals nie im Druck außgangen. Gedruckt zu
Franckfurt am Mayn / M.D.LXXIII. Es enthält 132 Blät-
ter in Kleinoktav und ist mit 57 Holzschnitten ge-
schmückt, die zum größten Teil aus anderen Drucken
(Volksbücher von .Melusine', ,Fortunatus' u.a.) stam-
men3). Dem Drucker muß eine gute, lückenlose Hand-
schrift wohl noch des 13. oder 14. Jahrhunderts vorgele-
gen haben4). Die Druckfassung ist charakterisiert durch
sehr mangelhaftes Verständnis des mittelhochdeutschen
Textes und eine entsprechend mechanische, an zahllosen
Stellen aber bis zur völligen Sinnlosigkeit entstellte Wie-
dergabe ihrer Vorlage. Ziemlich konsequent ist die Erset-
zung einiger veralteter Wörter wie minne, s aside durch
Liebe, Glück (vielleicht noch weiterer wie tougen(lich)
durch heimelich) vorgenommen worden (allerdings auch
nicht ohne Fehler wie z. B. für sselde 2038. 4428. 6094
Seele, 2073 Sachen, 479 Scheitelen (?), z.T. mit durch die
Wortersetzung bedingten unsinnigen Reimveränderun-
gen wie z. B. Liebe : vben u. ä. 978. 986. 1151. 1793. 3242).
Die Rekonstruktion eines mittelhochdeutschen, am Stil
Konrads von Würzburg orientierten Textes durch den
Erstherausgeber Moriz Haupt (1844)5) bleibt auch heute
eine erstaunliche Leistung der Textkritik des 19. Jahr-
hunderts, ermöglicht durch gründliche Kenntnis von Kon-
rads Sprache und Stil, durch souveräne Handhabung der
angesichts der Überlieferung unumgänglichen Konjektur-
alkritik und durch ein ungebrochenes Vertrauen in die
Leistungsfähigkeit der gehandhabten Methoden; ermög-
3) Vgl. Haupts Ausgabe (1890) Vf.
4) E. Schröder (1912) 21.
δ) Leipzig 1844. 2. Auflage durch E. Joseph 1890 (nach dieser
Ausgabe alle Zitate).
VII
licht allerdings auch gerade durch die verständnislose und
daher notwendig mechanische Art der Textadaptierung
durch den Frankfurter Drucker des 16. Jahrhunderts
(eine echte Bearbeitung hätte die Wiedergewinnung eines
alten Textes zweifellos wesentlich erschwert). Neben und
nach M. Haupt haben sich verschiedene Gelehrte um
Textbesserungen im einzelnen bemüht, u.a. K. Lach-
mann, W. Wackernagel, K. Bartsch, später besonders E.
Joseph, der Bearbeiter der 2. Auflage von Haupts ,Engel-
hard'-Ausgabe (1890), E. Schröder, P. Gereke in der 1.
Auflage dieser Ausgabe (1912) und zuletzt (1939!) A.
Leitzmann6). Besserungsmöglichkeiten im einzelnen än-
dern nichts daran, daß niemand, der sich textkritisch um
den , Engelhard' bemüht, an Haupts Leistung vorbeige-
hen kann. Wenn wir angesichts der Überlieferungslage
nicht überhaupt auf einen mhd. Text des Engelhard ver-
zichten wollen, wird Haupts Text neben dem alten Druck
auch in Zukunft die Grundlage jeder ,Engelhard'-Philolo-
gie bleiben')·
E. Schröder hat in seinen , Studien zu Konrad von
Würzburg' Haupt vorgeworfen, er hätte sich in „unrichti-
gem Konservativismus" zu eng an den alten Druck ange-
lehnt8) und ganz richtig gefordert, Grundlage der Arbeit
am Text müsse zuvor Klarheit über das Verfahren sein,
das der Drucker bei der Umsetzung seiner Vorlage ange-
wandt habe. Aber darum hatte sich natürlich auch Haupt
bemüht, und Schröder ist zwar in einer Reihe von Einzel-
6) Vgl. die Literaturnachweise 2. Textkritik.
') Noch 1840 hatte W. Grimm an K. A. Hahn geschrieben:
„Engelhard habe ich von Wolfenbüttel hier gehabt und mit ver-
gnügen gelesen; es ist eine von den beßern arbeiten Konrads,
aber ich bezweifle daß es Ihnen gelingt aus diesem text das ge-
dieht ins reine zu bringen, stückweise mag es wol angehen." Aus
dem briefl. Nachlaß von K. A. Hahn, Germ. 31,1886, 373. Seit 40
Jahren ist das (freilich problematische) Bemühen um die Textge-
stalt des .Engelhard' zum Stillstand gekommen - im Gegensatz
zu dem interpretatorischen Interesse, das Konrads Dichtung ge-
genwärtig findet.
9) E. Schröder (1912) 21.
Vili
heiten, kaum aber prinzipiell über Haupt hinausgelangt9).
Daß Haupts „Konservativismus" richtig war, bestätigten
E. Joseph und vor allem A. Leitzmann, indem sie für nicht
wenige Textstellen gerade durch engere Anlehnung an
den alten Druck bessere Lesungen fanden. Auch die für
diese Neubearbeitung vorgenommene sorgfältige Revi-
sion erwies im ganzen die gleichzeitig sichere wie behutsa-
me Hand Haupts bei der Erstellung seines Textes.
P. Gerekes Ausgabe (1912) berücksichtigte sorgfältig
die bis dahin erschienenen Beiträge zur Textkritik des
,Engelhard' und steuerte eine Reihe eigener Textbesse-
rungen bei10). Ein entschiedener Mißgriff war jedoch sein
Versuch, die Metrik im, Engelhard' nach den Ergebnissen
H. Laudans zur Chronologie der Werke Konrads11) auszu-
richten. Er tat dies, indem er „in mehreren hundert ver-
sen den fehlenden auftakt wiederhergestellt [hat], um der
dichtung auch in dieser hinsieht ihre stelle in der chronolo-
gischen reihenfolge zu sichern"12). Gewiß hat der alte
Druck den Text seiner Vorlage vielfach grob entstellt und
oft auch eine dem Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts
ungewöhnliche Wortfolge verändert, sicher auch gele-
9) Schröder empfahl die weitgehende Ersetzung von heime-
lieh durch tougen(lich), in geringerem Ausmaß auch von groß,
klein durch michel, lützel, gelegentlich von biß durch unz. Gere-
ke hat an mehreren Stellen heimelich durch tougenlich, ersetzt,
ist Schröder bei der Einsetzung von michel, lützel, unz jedoch
ganz zu recht nur vereinzelt gefolgt. Leitzmann hat an mehreren
Stellen ältere Präfixkomposita an Stelle moderner Formen vor-
geschlagen, worin ich ihm weitgehend gefolgt bin (z. B. gedienen
st. verdienen, gegern st. be-, belangen st. ver- u.a.), ferner teil-
weise Ersetzung von gar durch vil.
10) Die Begründungen gibt Gereke (1912) 213ff., 437ff.
n) Die Chronologie der Werke des K. v. W., Diss. Göttingen
1906; Der Auftakt bei K. v. W., ZfdA 48, 1906, 533ff.
12) In der 1. Aufl. dieser Ausgabe V; Anm. 2 gibt G. an, er
hätte die Zahl der auftaktlosen Verse von 1393 bei Haupt auf 973
gesenkt (21,4%:15%). - Der „heiklen Natur" seines Unterneh-
mens war sich G. allerdings bewußt, vgl. Gereke (1912) 438; aber
er meint, „eher zu wenig als zu viel getan zu haben".
IX
gentlich ein Wort ausfallen lassen13). Aber daß an mehre-
ren hundert Stellen verstärkendes vil, Adverbien wie nû,
dà, dô, hie, aufnehmende Demonstrativpronomina, Arti-
kel und sonstige Kleinwörter getilgt worden sein sollen,
ist so unerweislich wie unwahrscheinlich. So jedenfalls
durfte Schröders ohnehin bedenkliche Kritik eines „un-
richtigen Konservativismus" nicht verstanden werden.
Die prinzipielle Kritik H. de Boors an den von Laudan
verwendeten Kriterien für die Erstellung seiner Chrono-
logie hat Gerekes Verfahren im übrigen auch diese Be-
gründung entzogen14).
Bei der Neubearbeitung von Gerekes Ausgabe (= 2.
Auflage 1963) habe ich die von Gereke eingefügten Füll-
wörter zum größten Teil wieder getilgt, in dieser 3. Aufla-
ge in etwa 40 weiteren Fällen1"). Man würde ohne Scha-
13) Vgl. E. Joseph in Haupts Ausgabe (1890), Anmerkungen
zu V. 2606, 5266.
") H. de Boor (1967).
lD) Um den Lesartenapparat zu entlasten, stelle ich hier dieje-
nigen von Gerekes Einschüben zusammen, die ich wieder gestri-
chen habe; im Lesartenapparat ist in den folgenden Fällen die
Änderung von Gerekes Text nicht mehr verzeichnet. Einige wei-
tere Fälle {hin, ie, seht u.a.) sind nicht in dieses Verzeichnis
aufgenommen, sondern sind bei den Lesarten vermerkt, so auch
einige der folgenden Adverbien, wenn an der betreffenden Stelle
sonstige Textänderungen verzeichnet sind, vil: 389. 557. 601.
661. 721. 873. 893. 911. 981. 997. 1037. 1458. 1548. 1737. 1769.
1834. 1853. 1859. 2139. 2170. 2225. 2382. 2425. 2497. 2559. 2625.
2661. 2719. 2737. 2858. 2871. 2968. 3031. 3083. 3279. 3302. 3369.
3625. 3755. 3794. 3934. 4033. 4133. 4161. 4564. 4598. 4833. 4896.
4907. 5057. 5161. 5171. 5808. 5897. 6003. 6019. 6143. 6159. 6205.
6231. 6437. 6464. 6504. - nû: 305. 678. 1324. 3320. 3425. 3667.
3766. 3778. 3855. 4167. 4190. 4212. 4264. 4395. 4657. 5461. 5507.
6283. - dô: 1151. 1600. 1942. 2487. 3474. 3689. 3972. 4153. 4544.
5692. 5744. 5961. - dà: 1312. 2542. 2993. 4070. 4799. 4999. 5044.
5576. 5691. 6435. - hie: 1485. 3813. 3825. 4012. 4093. 4960. 5455.
- wiederaufnehmendes Demonstrativpron. (Artikel, immer am
Anfang der Verszeile) der: 829. 839. 1774. 2173. 4581. 5071. 5117.
5145; diu: 495. 1105. 1334. 2469. 3121. 4099. 5249; daz: 757. 953.
1253. 1815. 1849. 5001. 5297; den: 95. 4251; die: 1609. 1615. 2045.
χ
den diese „Textbesserungen" Gerekes samt und sonders
streichen können. Die photomechanische Reproduktion
des Textes setzte allerdings der Freiheit in der Textge-
staltung gewisse Grenzen. Gefolgt bin ich hingegen in vie-
len Fällen den wohlbegründeten Vorschlägen A. Leitz-
manns16). Ob man dem Druck über das Geleistete hinaus
noch wesentlich Neues, Besseres (und nicht nur Einzel-
besserungen) abgewinnen kann, ist mir zweifelhaft. Er-
wägenswert schienen mir einige formale Vereinheitli-
chungen. Vor allem ist das Durcheinander in der Verwen-
dung von -(e)t und -(e)nt für die 2. PI. Ind. Präs. (ir spre-
chet / -ent, hat / hânt usw.) unbefriedigend. Die Hand-
schrift hatte sicher die alemannische Form -ent, die der
Drucker unsystematisch durch -et ersetzt hat (vgl. die
fehlerhafte Ersetzung von gedenkent 3. PI. durch gedenk-
ket 1356). Konrads Reimgebrauch im , Engelhard' legt al-
lerdings nahe, -(e)t zu verallgemeinern: (ir) sit : lit 719 f.
2905f., zît : (ir) sit 3729f. 3885f., unschult : ir suit 4179f.,
(ir) geruochet : er suochet 4259 f. Dem steht lediglich,
wenn ich recht sehe, stuont : (ir) tuont 2105 f. gegenüber
(die Reime von Formen mit 2. PI. Präs. untereinander
beweisen natürlich nichts: 707f. 1361 f. 2909f. 4263f.).
Auch dieser Beleg für -nt könnte durch eine kleine und
durchaus sinnvolle Konjektur beseitigt werden: 2106 swaz
aber si mir dar umbe tuont11).
2208. 2657. 3137. 4610. 4731. 5086. 5119. - s6 (sô daz statt überlie-
fertem daz): 158. 1114. 3014. 3687. 3950. 4567. 4895. - alsam
(statt als): 238. 2269. 3977. 4660. 5304. 5307. - al (auch in also,
alhie usw., außer 860 am Versanfang): 426. 860. 988. 1202. 1339.
4028. - und (immer am Versanfang): 712. 1178. 1318. 2266. 4412.
4513. - wan (immer am Versanfang): 994. 1550. 1914. 2338. 2962.
16) A. Leitzmann (1939) 414 ff.
17) In der 2. Auflage dieser Ausgabe VIII f. hatte ich für Ver-
allgemeinerung von -(e)nt plädiert. - Die in den Ausgaben von
Gereke und E. Schröder vorgenommene Verallgemeinerung von
-(e)nt in den Legenden und Verserzählungen findet übrigens
auch nur schwache und ungleichmäßige Unterstützung durch
Reimbelege. Der .Silvester' und ,Der Welt Lohn' haben nur -t-