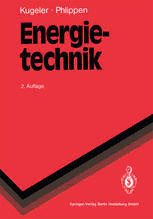Table Of ContentSpringer-Lehrbuch
Kurt Kugeler · Peter-W Phlippen
Energietee
Technische, ökonomische und
ökologische Grundlagen
Zweite Auflage mit 334 Abbildungen
Springer-V erlag Berlin Heidelberg GmbH
UniversWits-Professor Dr.-Ing. Kurt Kugeler
Rheinisch-Westfiilische Technische Hochschule Aachen
Lehrstuhl ftir Reaktorsicherheit und -technik
EilfschomsteinstraBe 18, 52062 Aachen
Direktor am Institut fUr Sicherheitsforschung und Reaktortechnik
des Forschungszentrums Jtilich GmbH
Postfach 19 13,52428 Jiilich
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Peter-W Phlippen
Forschungszentrum Jtilich GmbH
Institut ftir Sicherheitsforschung und Reaktortechnik
Postfach 19 13,52428 Jtilich
ISBN 978-3-540-55871-2
Cip-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Kugeler, Kurt: Energietechnik: technische, iikonomische und iikologische Grundlagen I
Kurt Kugeler; Peter-W. Phlippen. -2. Aufl.-
(Springer-Lehrbuch)
ISBN 978-3-540-55871-2 ISBN 978-3-662-07029-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-07029-1
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der Obersetzung,
des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikro
verfilmung oderVervielfliltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfiiltigung dieses Werkes oder von
Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung
zuHissig. Sie ist grundslitzlich vergiitungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1990 and 1993
Urspriinglich erschienen bei Springer-V erlag Berlin Heidelberg New York 1993
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und
Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wliren und daher von jedermann benutzt werden diirften.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.B. DIN, VDI, VDE)
Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewlihr fiir die Richtigkeit,
Vollstiindigkeit oder Aktualitlit iibernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls fiir die eigenen Arbeiten die
vollstăndigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils giiltigen Fassung hinzuzuziehen.
Satz: Reproduktionsfertige Vorlage der Autoren
60/3020 -5 4 3 2 1 O - Gedruckt auf sliurefreiem Papier
Vorwort
Dieses Buch ist aus Vorlesungen über Energietechnik und Energiewirtschaft ent
standen, die der erstgenannte Verfasser in den vergangenen zehn Jahren an der
Universität-Gesamthochschule-Duisburg gehalten hat. Hörer waren in der Regel
Studenten des allgemeinen Maschinenbaus, für die eine Vorlesung über Energie
wirtschaft nach dem Vordiplom an der genannten Hochschule verpflichtend ist.
Als Zielsetzung sowohl bei der Durchführung der Vorlesung als auch bei der
Abfassung dieses Buchs standen drei wesentliche Aspekte i_m Vordergrund: Es
sollen zum ersten grundlegende Kenntnisse über Fakten und Zusammenhänge in
der Energiewirtschaft vermittelt werden. Dieser Gesichtspunkt ist angesichts der
langfristig steigenden Bedeutung der Weltenergiewirtschaft sowie der damit un
mittelbar verbundenen Umweltfragen von großer Bedeutung. Zweitens soll eine
Einführung in Methoden, die zur Beurteilung von Prozessen der Energiewirt
schaft unumgänglich sind, gegeben werden. Bei der Vielfalt technischer Prozesse,
die in der Energiewirtschaft insgesamt von Bedeutung sind, kann dieser Ansatz
naturgemäß nur recht unvollkommen bleiben. Hinweise auf weiterführende Li
teratur sollen dem Leser bei Bedarf ein vertieftes Studium dieser Fragestellung
ermöglichen. Schließlich sollen in diesem Buch einige Verfahren zur Beurteilung
der wirtschaftlichen Bedingungen von Verfahren in der Energietechnik erläutert
werden. Hiermit soll er in den Stand versetzt werden, wichtige Zusammenhänge
selbständig beurteilen zu können. Dieser Aspekt scheint den Verfassern für Inge
nieure besonders wichtig zu sein, da sich alle technischen Entscheidungen im
Rahmen von Kompromissen im Spannungsfeld von Technik, Ökonomie und
Ökologie an wirtschaftlichen Gegebenheiten orientieren. Die Fähigkeit, wirt
schaftliche Zusammenhänge beurteilen zu können, ist damit für den in der Praxis
tätigen Ingenieur von größter Bedeutung. Auch hier können natürlich im Rah
men einer Einführung nur erste Hinweise gegeben werden.
Als Leser dieses Buches werden folglich Studenten des Maschinenbaus sowie in
der Praxis tätige Ingenieure, die sich einen allgemeinen Überblick über energie
wirtschaftliche Fragen verschaffen wollen, angesprochen. Es sei ausdrücklich be
tont, daß hier keine Konkurrenz zu verfügbaren ausgezeichneten Werken über
Einzelaspekte der Energietechnik und der Energiewirtschaft geschaffen werden
kann und soll.
Die Verfasser hegen die Hoffnung, daß der Leser nach dem Studium des Buches
in den Stand versetzt wird, energietechnische Verfahren bilanzieren und beurtei
len sowie Tendenzen in der Energiewirtschaft kompetent bewerten zu können.
Diese Fähigkeit wird in der Zukunft angesichts der zu erwartenden Entwick
lungen in der Energiewirtschaft, beispielsweise der Substitution von Energieträ
gern, der Erfüllung der Anforderungen im Hinblick auf den rationellen Einsatz
von Energie, wachsender Anforderungen für den Umweltschutz und des Ein
satzes von regenerativen Energiequellen, von zukünftigen Ingenieuren in beson
derem Maße gefordert werden.
VI Vorwort
Den Verfassern ist es ein besonderes Anliegen alldenen zu danken, die beim Zu
standekommen dieses Buches behilflich waren. Für wertvolle Hinweise und die
Mühe des Korrekturlesens sei den Herren Dipl.-Ing. A. Hurtado, Dr.-Ing. M.
Kugeler, Dr.-Ing. P. Schmidtlein und Dipl.-Ing. P. Schreiner recht herzlich ge
dankt. Die Zeichnungen wurden mit großer Sorgfalt von Frau E. Templin und
Frau R. Przewosnik angefertigt. Dem Springer Verlag sei für die Geduld sowie
für die Sorgfalt bei der Herausgabe dieses Buches unser ausdrücklicher Dank
ausgesprochen.
K. Kugeler
Duisburg, im April 1990
P. W. Phlippen
Vorwort zur 2. Auflage
Die Konzeption des Buches wurde für die zweite Auflage beibehalten. Neben
einigen Fehlerkorrekturen erfolgte eine Aktualisierung der wesentlichen Tabellen
und Graphiken im ersten Kapitel. Dazu liegen wie in der ersten Auflage die
Zahlenangaben für die BRD ohne Einbeziehung der fünf neuen Bundesländer
zugrunde.
K. Kugeler
Jülich, im Juni 1992
P. W. Phlippen
Inhaltsverzeichnis
1 Übersicht über die Energiewirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1
1.1 Bedeutung der Energiewirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Weltenergieversorgung .......................................... 2
1.3 Reichweite der Energievorräte ..................................... 5
1.4 Energieversorgung in der BRD .................................... 7
1.5 Elektrizitätswirtschaft in der BRD ................................. 11
1.6 Spezielle Aspekte der Energiewirtschaft ............................. 14
2 Allgemeine Gesichtspunkte bei der Behandlung energietechnischer Probleme . . . . . 19
2.1 Prozeßanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Bilanzgleichungen ............................................. 22
2.3 Bilanzhüllen ................................................. 24
2.4 Spezielle Mengen- und Energiebilanzen ............................. 26
2.4.1 Mengenbilanzen ........................................... 26
2.4.2 Energiebilanzen ........................................... 28
2.5 Exergiebilanzen .............................................. 32
2.6 Wirkungsgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7 Darstellung von Mengen- und Energiebilanzen ....................... 36
2.8 Prozeßeinheiten in der Energietechnik .............................. 38
2.9 Vorgehen bei Problernlösungen ................................... 41
3 Kreisprozesse zur Erzeugung von elektrischer Energie ..................... 43
3.1 Dampfturbinenprozesse ........................................ 43
3.l.l Einfacher Prozeß .......................................... 43
3.1.2 Verbesserungen des Dampfturbinenprozesses ...................... 45
3.1.3 Technischer Stand bei Dampfturbinenprozessen .................... 48
3.2 Gasturbinenprozesse ........................................... 51
3.2.1 Einfacher Prozeß .......................................... 51
3.2.2 Verbesserungen des Gasturbinenprozesses ........................ 54
3.3 Kombiprozesse ............................................... 56
3.3.1 Grundprinzip ............................................. 56
3.3.2 Schaltungen bei Kombiprozessen ............................... 57
4 Kraft-Wärme-Kopplung ........................................... 61
4.1 Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2 Dampfturbinenschaltungen ...................................... 64
4.3 Gasturbinenschaltungen ........................................ 66
4.4 Dieselanlagen als Blockheizkraftwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5 Wärmebereitstellung durch Umwandlung fossiler Brennstoffe ................ 71
5.1 Übersicht zu den Brennstoffen ................................... 71
5.2 Verbrennungsrechnung ......................................... 73
5.3 Besondere Aspekte bei Verbrennungsvorgängen ....................... 77
6 Technik von fossil befeuerten Dampferzeugern ........................... 81
6.1 Übersicht über das Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
VIII Inhaltsverzeichnis
6.2 Dampferzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.3 Bilanzierung des Kessels ........................................ 84
6.4 Feuerungssysteme ............................................. 89
6.5 Technische Ausführung von Dampferzeugern ........................ 93
7 Abwärmeabfuhr • • • . • . • . • • • • • . • . • • . • • • • . . . • . • . . • . • . • . . . . • • . • . • . • • 99
7.1 Übersicht . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.2 Kondensation ............................................... 100
7.3 Frischwasserkühlung .......................................... 103
7.4 Naßkühltürme .............................................. 106
7.5 Trockenkühltürme ........................................... 108
7.6 Hybridkühltürme ..... : ...................................... 110
7.7 Vergleichende Bewertung ...................................... 112
8 Emissionen und Rauchgasreinigung bei fossil gefeuerten Kraftwerken •..•.••.• 113
8.1 Emissionen ................................................ . 113
8.2 Ausbreitung und Wirkung von Schadstoffen ....................... . 115
8.3 Entstaubung ............................................... . 118
8.4 Entschwefelung ............................................ . 121
8.5 Entstickung ............................................... . 124
9 Konzepte fossil gefeuerter Kraftwerke ••..•.••.•••••..•.•••.•••.••.••. 127
9.1 Energiefluß im Kraftwerk ..................................... . 127
9.2 Konzepte von modernen Steinkohlekraftwerken ..................... . 128
9.3 Weiterentwicklungen zum Prozeß der Kohleverstromung .............. . 131
10 Wärmebereitstellung aus Kernbrennstoffen •....•.••.•.•...•...••..•..• 135
10.1 Energiegewinnung durch Kernspaltung .......................... . 135
10.2 Kettenreaktion und kritischer Reaktor ........................... . 139
10.3 Wärmefreisetzung im Reaktorkern .............................. . 142
10.4 Besondere Aspekte bei Kernreaktoren ........................... . 144
11 Konzepte von Kernkraftwerken ..........•...............•.•....... 147
11.1 Prinzipien und Reaktortypen .................................. . 147
11.2 Druckwasserreaktoren ....................................... . 150
11.2.1 Prinzip ............................................... . 150
11.2.2 Komponenten des Druckwasserreaktors ....................... . 150
11.2.3 Betriebs- und Sicherheitsfragen ............................. . 155
11.3 Siedewasserreaktoren ....................................... . 156
11.4 Hochtemperaturreaktoren .................................... . 158
11.5 Schnelle Brutreaktoren ...................................... . 161
11.6 Candu-Reaktoren .......................................... . 164
11.7 RBMK-Reaktoren ......................................... . 165
12 Kernbrennstoffkreislauf 167
12.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
12.2 Erzgewinnung, Aufbereitung und Konversion ..................... . 168
12.3 Urananreicherung .......................................... . 170
12.4 Brennelementfertigung ...................................... . 172
12.5 Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente .................... . 172
12.6 Wiederaufarbeitung ......................................... . 174
12.7 Konditionierung radioaktiver Abfälle ............................ . 176
12.8 Endlagerung .............................................. . 177
13 Heizwärmeversorgung . . • . • . . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . • . . • • . . • . 179
13.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Inhaltsverzeichnis IX
13.2 Wärmebedarf .............................................. 180
13.3 Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zur Heizwärmebereitstellung ....... 183
13.4 Elektroheizung ............................................. 186
13.5 Fernwärme ................................................ 187
13.6 Wärmepumpen ............................................. 189
14 Energieeinsatz im Verkehr ....................................... 195
14.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
14.2 Kreisprozesse flir den Antrieb im Verkehrssektor .................... 196
14.3 Fragen des Energieeinsatzes bei Antriebssystemen im Verkehrssektor ..... 201
14.4 Treibstoffe und alternative Energieträger .......................... 204
15 Energieeinsatz in der Industrie ..............................•..... 209
15.1 Allgemeine Übersicht ........................................ 209
15.2 Raffinerieprozesse ........................................... 210
15.3 Petrachemische Prozesse ...................................... 217
15.4 Herstellung von Wasserstoffund Ammoniak ....................... 218
15.5 Herstellung von Koks aus Kohle ................................ 222
15.6 Stahlerzeugung ............................................. 224
16 Energietransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
16.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
16.2 Transport von Fluiden in Rohrleitungen .......................... 230
16.3 Transport von Öl in Pipelines .................................. 231
16.4 Gastransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
16.5 Transport von Fernwärme und Dampf ........................... 236
17 Energiespeicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
17 .I Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
17.2 Speicherung von elektrischer Energie ............................. 242
17.3 Speicherung von thermischer Energie ............................. 247
17.4 Speicherung von flüssigen Kohlenwasserstoffen und Gasen ............ 255
18 Rationelle Energieumwandlung und -nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
18.1 Allgemeine Aspekte ......................................... 259
18.2 Rationelle Energienutzung bei der Erzeugung von elektrischer Energie .... 262
18.3 Rationelle Energienutzung im Sektor Haushalt und Kleinverbrauch ...... 263
18.4 Rationelle Energienutzung im Sektor Verkehr ...................... 264
18.5 Rationelle Energienutzung in der Industrie ........................ 265
18.5.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
18.5.2 Luftvorwärmung und Abhitzenutzung ......................... 266
18.5.3 Verfahren der Mehrfachentspannungsverdampfung ............... 270
18.5.4 Wärmepumpeneinsatz in der Industrie ......................... 272
18.5.5 Energierückgewinnung mit Hilfe von ORC-Anlagen ............•.. 274
18.5.6 Rezyklierungsverfahren .................................... 274
18.5.7 Technologische Entwicklungen bei der Produktherstellung .......... 275
19 Regenerative und alternative Energiequellen ........................... 277
19.1 Energiefluß der Erde ......................................... 277
19.2 Übersicht über Verfahren ..................................... 277
19.3 Solares Energieangebot ....................................... 278
19.4 Niedertemperatur-Solarkollektoren .............................. 280
19.5 Solarfarmanlagen ........................................... 283
19.6 Solartoweranlagen .......................................... 284
19.7 Fotovoltaische Kraftwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
19.8 Windenergie ............................................... 287
19.9 OTEC-Prozesse ............................................ 290
X Inhaltsverzeichnis
19.10 Bioenergie ................................................ 292
19.ll Laufwasserenergie .......................................... 294
19.12 Geothennische Energie ...................................... 296
19.13 Gezeitenenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
20 Neue Verfahren in der Energietechnik .........•.....•............... 299
20.1 Tertiäre Ölgewinnung ........................................ 299
20.2 Ölgewinnung aus Ölschiefer und Ölsand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
20.3 Kohlevergasung ............................................ 301
20.4 Kohleverflüssigung .......................................... 304
20.5 Fusionskraftwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
21 Allg~meine Betrachtungen zu Wirtschaftlichkeitsfragen in der Energiewirtschaft 311
21.1 Ubersicht ................................................. 311
21.2 Verfahren zur Kostenbewertung ................................ 315
21.2.1 Übersicht .............................................. 315
21.2.2 Kostenvergleich ......................................... 315
21.2. 3 Erfolgsvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
21.2.4 Rentabilitätsvergleich ..................................... 317
21.2.5 Amortisationsvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
21.2.6 Kapitalwertmethode ...................................... 318
21.2.7 Methode des internen Zinsfußes ............................. 319
21.2.8 Annuitätenmethode ....................................... 320
21.2.9 Methode der Life-cycle-Kosten .............................. 321
22 Spezielle Kostenanalysen in der Energiewirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
22.1 Stromerzeugungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
22.1.1 Kostenformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
22.1.2 Kostenparameter ......................................... 324
22.1.2.1 Investitionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
22.1.2.2 Kapitalfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
22.1.2.3 Anlagenauslastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
22.1.2.4 Mittlerer Anlagenwirkungsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
22.1.2.5 Sonstige Kostenparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
22.1.3 Rechenbeispiele zur Kostenformel ............................ 330
22.1.4 Diskussion der Kostenformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
22.1.5 Kraftwerkseinsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
22.1.6 Kosten beim Einsatz regenerativer Energieträger ................. 339
22.1. 7 Kosten bei Extrapolation der Kraftwerksleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
22.2 Kostenbewertung bei Koppelproduktion .......................... 341
22.2.1 Grenzkostenbetrachtungen bei der Kraft-Wärme-Kopplung ......... 341
22.2.2 Koppelproduktion bei industriellen Prozessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
22.3 Kostenbewertung bei der Energienutzung ......................... 344
22.3.1 Heizwärmeversorgung ..................................... 344
22.3.2 Einsatz von mechanischer Energie im Verkehrssektor .............. 346
22.3.3 Kosten der Herstellung von industriellen Produkten ............... 346
22.4 Bewertungskoeffizienten in der Energiewirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
23 Optimierungsfragen . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 349
23.1 Grundsätzliche Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
23.2 Mathematische Methoden der Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
23.3 Beispiele ftir die Optimierung in der Energietechnik .................. 353
24 Ökologische Fragen . . • . . . • • . • . • • • • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . 359
24.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
24.2 Das Kohlendioxidproblem ..................................... 359
Inhaltsverzeichnis XI
24.3 Störfallbetrachtungen zum Leichtwasserreaktor ..................... 363
24.4 Passives Sicherheitsverhalten von Reaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
24.5 Ökologisch-ökonomisch-technische Kompromisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
25 Literaturverzeichnis • . • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 371
25.1 Literatur zu Kapitel 1 ........................................ 371
25.2 Literatur zu Kapitel 2 ........................................ 372
25.3 Literatur zu Kapitel 3 ........................................ 372
25.4 Literatur zu Kapitel 4 ........................................ 373
25.5 Literatur zu Kapitel 5 ........................................ 374
25.6 Literatur zu Kapitel 6 ........................................ 374
25.7 Literatur zu Kapitel 7 ........................................ 375
25.8 Literatur zu Kapitel 8 ........................................ 376
25.9 Literatur zu Kapitel 9 ........................................ 377
25.10 Literatur zu Kapitel10 ...................................... 378
25.11 Literatur zu Kapitelll ...................................... 379
25.12 Literatur zu Kapitel12 ...................................... 379
25.13 Literatur zu Kapitel 13 ...................................... 381
25.14 Literatur zu Kapitel 14 ...................................... 381
25.15 Literatur zu Kapitel 15 ...................................... 382
25.16 Literatur zu Kapitel16 ...................................... 383
25.17 Literatur zu Kapitel 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
25.18 Literatur zu Kapitel 18 ...................................... 385
25.19 Literatur zu Kapitel 19 ...................................... 386
25.20 Literatur zu Kapitel 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
25.21 Literatur zu Kapitel 21 ...................................... 388
25.22 Literatur zu Kapitel 22 ...................................... 389
25.23 Literatur zu Kapitel 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
25.24 Literatur zu Kapitel 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
25.25 Literatur zum Anhang ....................................... 391
Abkürzungen • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • . • • . • . • . • . • • • • • • • . • • • • • . 393
Anhang A. Wichtige Zahlenwerte und Diagramme . • • • • . • • • • . • . • • • • • • . • • • • 395
Index •••.•••••••••••••••••••.••.•••••••••.•.••..•.•••.••.••••. 403