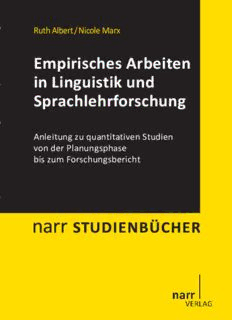Table Of Contentg Ruth Albert/Nicole Marx
Empirisches Arbeiten
in Linguistik und
p
Sprachlehrforschung
g
Anleitung zu quantitativen Studien
von der Planungsphase
bis zum Forschungsbericht
p
Ruth Albert/Nicole Marx
Empirisches Arbeiten
in Linguistik und
Sprachlehrforschung
Anleitung zu quantitativen Studien
von der Planungsphase bis zum Forschungsbericht
Prof.Dr.RuthAlbertistProfessorinfürDeutschalsFremdspracheamInstitutfürGermanistische
SprachwissenschaftderPhilipps-UniversitätMarburg.
Prof. Dr. Nicole Marx ist Professorin für Sprachlehrforschung und Deutsch als Fremdsprache am
InstitutfürGermanistikundVergleichendeLiteraturwissenschaftderUniversitätPaderborn.
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternetüber<http://dnb.d-nb.de>abrufbar.
©2010·NarrFranckeAttemptoVerlagGmbH+Co.KG
Dischingerweg5·D-72070Tübingen
DasWerkeinschließlichallerseinerTeileisturheberrechtlichgeschützt.JedeVerwertungaußerhalb
derengenGrenzendesUrheberrechtsgesetzesistohne Zustimmung desVerlagesunzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
EinspeicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
GedrucktaufchlorfreigebleichtemundsäurefreiemWerkdruckpapier.
Internet:http://www.narr-studienbuecher.de
E-Mail:[email protected]
DruckundBindung:Gulde,Tübingen
PrintedinGermany
ISSN0941-8105
ISBN978-3-8233-6590-7
(cid:2)
IIIInnnnhhhhaaaallllttttssssvvvveeeerrrrzzzzeeeeiiiicccchhhhnnnniiiissss
Vorwort....................................................................................................................... 9
1 Zur Einführung ............................................................................................... 11
1.1 Arten von empirischer Forschung ............................................................... 12
1.2 Warum eigentlich empirisch arbeiten? ....................................................... 14
1.3 Zum Aufbau des Studienbuchs..................................................................... 16
Aufgabe ..................................................................................................................... 18
Schritt 1: Planungsphase .............................................................................. 19
2 Vorplanung einer empirischen Untersuchung .......................................... 21
2.1 Auswahl eines Untersuchungsgegenstand(cid:70)s .............................................. 21
2.2 Was ist eine Forschungsfrage? ...................................................................... 24
2.3 Wie formuliere ich eine Hypothese? ............................................................ 25
2.4 Gütekriterien für empirische Untersuchungen .......................................... 27
2.4.1 (cid:59)(cid:86)(cid:87)(cid:70)(cid:83)(cid:77)(cid:1)ä(cid:1)(cid:84)(cid:84)(cid:74)(cid:72)(cid:76)(cid:70)(cid:74)(cid:85)(cid:1)(cid:9)Verlässlichkeit(cid:13) Reliabilität(cid:10)(cid:1)................................... 28
2.4.2 Objektivität ............................................................................................ 30
2.4.3 Gültigkeit (Validität) ........................................................................... 30
2.4.4 Warum kann es schwierig sein, Gütekriterien zu erfüllen? ........... 33
2.5 Wie komme ich zu einem Forschungsplan? ............................................... 33
2.5.1 Eine passende Forschungsmethode finden ...................................... 34
2.5.2 Die passenden Versuchspersonen auswählen .................................. 34
2.6 Worauf muss ich sonst noch achten? .......................................................... 35
2.6.1 Störfaktoren(cid:1)(cid:9)(cid:52)(cid:85)ö(cid:1)(cid:1)(cid:83)(cid:87)(cid:66)(cid:83)(cid:74)(cid:66)(cid:67)(cid:77)(cid:70)(cid:79)(cid:10)(cid:1) .............................................................. 35
2.6.2 Kontrollfaktoren ................................................................................... 37
2.7 Zusammenfassung .......................................................................................... 38
Aufgaben ................................................................................................................... 38
Schritt 2: Datenerhebung ............................................................................. 41
3 Die Beobachtung ............................................................................................ 43
3.1 Offene und verdeckte Beobachtung ............................................................. 43
3.2 Beobachtungskategorien ............................................................................... 45
3.3 Datenklassifikation ......................................................................................... 46
3.4 Zur Wahl der Stichprobe ............................................................................... 49
Aufgaben ................................................................................................................... 49
4 Arbeiten mit Textkorpora ............................................................................. 51
Aufgabe ..................................................................................................................... 55
6 Inhaltsverzeichnis
5 Die Befragung .................................................................................................. 59
5.1 Die Wahl der Stichprobe................................................................................ 62
5.1.1 Auswahl der Befragten ......................................................................... 62
5.1.2 Die Größe der Stichprobe .................................................................... 65
5.2 Befragungsarten .............................................................................................. 65
5.2.1 Offene Konzepte, explorative Interviews .......................................... 65
5.2.2 Geschlossene Konzepte, festgelegte Fragefolgen .............................. 67
5.2.3 Die Wahl zwischen offenen und geschlossenen Fragen .................. 70
5.2.4 Direkte und indirekte Fragen.............................................................. 71
5.3 Aufbau eines Fragebogens ............................................................................. 72
5.4 Umgang mit der Gefahr von Artefakten ..................................................... 73
5.5 Das Klassifizieren von umfangreichen Befragungsdaten für eine
differenzierte Auswertung ............................................................................. 75
Aufgaben ................................................................................................................... 76
6 Das Experiment ............................................................................................... 81
6.1 Experimentelle Forschung ............................................................................. 81
6.2 Der Entwurf des Forschungsvorhabens ....................................................... 83
6.2.1 Vorbereitungen für ein Experiment .................................................. 87
6.2.2 Labor- vs. Feldexperiment ................................................................... 88
6.2.3 Kontrollgruppen ................................................................................... 89
6.2.3 Probleme ................................................................................................ 91
6.3 Mehrfaktorielle Fragestellungen ................................................................... 92
6.4 Verbreitete Experimentformen in der Psycholinguistik ........................... 95
6.4.1 Experimente zur Sprachproduktion .................................................. 96
6.4.2 Experimente zur Sprachrezeption ................................................... 100
6.5 Auswertung der Experimentergebnisse .................................................... 101
Aufgaben ................................................................................................................ 102
Schritt 3: Datenauswertung / Datenanalyse .............................................. 103
7 Skalenniveaus ............................................................................................... 105
Aufgaben ................................................................................................................ 109
8 Beschreibende Statistik................................................................................ 111
8.1 Häufigkeit ..................................................................................................... 111
8.2 Maße der zentralen Tendenz: Modalwert, Median, Mittelwert ............ 113
8.3 Standardabweichung .................................................................................. 114
8.4 Die Darstellung der Daten .......................................................................... 117
Aufgaben ................................................................................................................ 119
9 Inferentielle Statistik I: Beziehungen zwischen Daten ............................ 121
9.1 Korrelation en............................................................................................... 121
9.1.1 Korrelationen bei intervallskalierten Daten berechnen............... 125
Inhaltsverzeichnis 7
9.1.2 Wann ist eine Korrelation hoch genug? .......................................... 127
9.1.3 Wie man Korrelationen präsentiert ................................................. 129
9.2 Assoziationen und Häufigkeit: Der Chi-Quadrat-Test ........................... 129
9.2.1 Chi-Quadrat bei Befragungen .......................................................... 130
9.3 Assoziation bedeutet keine Kausalität ...................................................... 135
Aufgaben ................................................................................................................. 137
10 Inferentielle Statistik II: Experimentelle Daten ........................................ 139
10.1 Tests für intervallskalierte Daten................................................................ 142
10.1.1 Annahmen, die Tests für intervallskalierte Daten voraussetzen 14 2
10.1.2 t-Test für abhängige Gruppen ........................................................ 142
10.1.3 t-Test für unabhängige Gruppen ................................................... 144
10.1.4 Varianzanalyse (ANOVA: analysis of variance) .......................... 146
10.2 Test für nominalskalierte Daten: der Chi-Quadrat-Test ........................ 151
10.3 Tests für ordinalskalierte Daten: U-Test und Wilcoxon-Test................ 152
10.4 Zusammenfassung: Wann man welchen Test benutzt............................ 155
Aufgaben ................................................................................................................. 157
11 Signifikanz vs. Aussagekraft ........................................................................ 159
11.1 Interpretation des Signifikanzniveaus ....................................................... 159
11.2 Effektgröße .................................................................................................... 160
11.2.1 Korrelation und r-Quadrat ............................................................. 161
11.2.2 Chi-Quadrat und Cramér’s V ......................................................... 162
11.2.3 t-Test und Cohen’s d sowie Eta zum Quadrat ((cid:2)2) ..................... 163
11.2.4 ANOVA und Eta zum Quadrat ((cid:2)2) .............................................. 164
11.3 Warum über Effektgröße berichten? ......................................................... 164
Aufgabe ................................................................................................................... 165
Schritt 4: Der Forschungsbericht ............................................................... 167
12 Präsentation der Studie: Wie schreibe ich es auf? .................................... 169
12.1 Das Abstract .................................................................................................. 169
12.2 Einleitung, theoretischer Rahmen und relevante Literatur .................... 170
12.3 Fragestellung und Hypothesen ................................................................... 171
12.4 Forschungsdesign / Methodik .................................................................... 171
12.5 Präsentation der Ergebnisse ........................................................................ 172
12.6 Besprechung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen bzw. Ausblick ... 173
Aufgabe ................................................................................................................... 174
Anhang: Lösungen der Aufgaben ...................................................................... 175
Literaturverzeichnis .............................................................................................. 197
Stichwortverzeichnis ............................................................................................. 201
(cid:2)
(cid:2)
VVVVoooorrrrwwwwoooorrrrtttt
Das vorliegende Buch bietet eine systematische Anleitung zum Schreiben
einer quantitativ vorgehenden empirischen wissenschaftlichen Arbeit in der
Sprachlehrforschung oder Linguistik, in der jeder einzelne Schritt genau er-
läutert wird. Da der Linguistik und Sprachlehr- und -lernforschung1 (die in
vielen Ländern nicht nur als Teil der „angewandten Linguistik“ vorkommt,
sondern explizit so genannt wird) gemeinsam ist, dass sie sich mit Sprachen
beschäftigen und mit den Prozessen, in denen man Sprachen lernt, und da sie
auch größtenteils dieselben Verfahren benutzen, schien uns die Schnittmenge
groß genug zu sein, um eine Einführung für beide Wissenschaften zu schrei-
ben. Wir richten uns besonders an Studierende linguistischer Fächer, die ihre
Bachelor-, Master-, Examens- oder Doktorarbeit schreiben und die eine
quantitative Studie durchführen möchten, und haben uns deshalb auf die Be-
schreibung der Verfahren beschränkt, die Sprachwissenschaftler tatsächlich
häufig benutzen, verweisen jedoch im Text und in unserem kommentierten
Literaturverzeichnis auf nützliche weiterführende Literatur.
Sogenannte qualitative empirische Forschung wird in diesem Buch nur
am Rande behandelt, weil sie in der Linguistik ohnehin nicht praktiziert wird
und weil die Einigung auf methodische Standards bei qualitativer empirischer
Sprachlehrforschung sich noch im Anfangsstadium befindet (vgl. dazu auch
den programmatischen Beitrag von Riemer 2008). Nicht zu bestreiten ist,
dass auch in der Sprachlehrforschung ein Bedarf an generalisierbaren Ergeb-
nissen quantitativ vorgehender Forschung besteht. So schwierig Untersu-
chungen zur Wirkungsweise von Lehrmethoden oder Lernstrategien manch-
mal auch durchzuführen sein mögen, die Lehrpersonen brauchen sie als Basis
für ihre professionellen Entscheidungen.
Dieses Buch kann keine Wunder bewirken. Es ersetzt nicht die Bespre-
chung mit dem/der Betreuer(in) der Arbeit darüber, was genau untersucht
werden soll, welche Methoden dabei zur Datenerhebung eingesetzt werden
können und wie bei der Analyse der erhobenen Daten vorzugehen ist. Wir
erklären häufig benutzte Verfahren und warnen vor häufig vorkommenden
Fehlern. Die statistische Aufbereitung der Daten und die Benutzung von
Computerprogrammen für die statistische Analyse als „Handwerkszeug“
können wir vermitteln, die Interpretation der Daten sollte man mit dem Be-
treuer oder der Betreuerin durchsprechen.
Wenn man ein Buch für Personen mit recht verschiedenem Hintergrund-
wissen schreibt, dann tut man gut daran, bei der Darstellung der einzelnen
Methoden Beispiele zu wählen, die man verstehen kann, ohne dass vorher
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
1 Wir verwenden aus Gründen der Lesbarkeit im Weiteren die Bezeichnung „Sprachlehrfor-
schung“ und meinen damit die Sprachlehr- und -lernforschung.