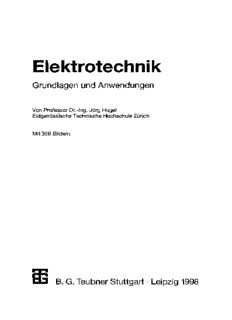Table Of ContentElektrotechnik
Grundlagen und Anwendungen
Von Professor Dr.-Ing. Jörg Hugel
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Mit 356 Bildern
EI3
B. G. Teubner Stuttgart· Leipzig 1998
Prof. Dr.-Ing. Jorg Hugel
Geboren 1938 in Stuttgart. 1958 Studium der Elektrotechnik an der
Technischen Hochschule Stuttgart. 1963 Wissenschaftlicher Assi
stent am Institut fOr elektrische Anlagen bei Prof. Adolf Leonhard.
1968 Promotion, ab 1969 Industrietătigkeit im Bereich der Industrie
Anlagen und Leistungselektronik. Seit 1982 Prolessor fUr elektro
technische Entwicklungen und Konstruktionen an der Eidgenossi
schen Technischen Hochschule ZUrich.
Weitere Informationen und etwaige Korrekturen im Internet unter
http://www.eek.ee.ethz.ch
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Hugel, Jorg:
Elektrotechnik : Grundlagen und Anwendungen / von Jarg Hugel. -
Stuttgart ; Leipzig: Teubner, 1998
(feubner-StudienbOcher: Elektrotechnik)
ISBN 978-3-519-06259-2 ISBN 978-3-663-05860-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-05860-1
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschOtzt. Jede
Verwertung auBerhalb derengen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulăssig und strafbar. Das gilt besonders lOr
Vervielfăltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 1998 B. G. Teubner Stuttgart· Leipzig
Vorwort
Das vorliegende Studienbuch ist, wie wohl bei den meisten Lehrbüchern üb
lich, aus einer Vorlesung hervorgegangen. Seit Jahren lese ich den hier zusam
mengefassten Stoff für die Studenten der Elektrotechnik im ersten und zweiten
Semester an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. In dieser
Einführungsveranstaltung werden die Grundlagen des Fachgebiets vermittelt,
ergänzt durch Hinweise auf eine ganze Reihe von Anwendungen, hauptsäch
lich in den Übungen. Diese sind überwiegend in praktische Fragestellungen
eingekleidete Aufgaben, wie sie dem Ingenieur in seiner Tätigkeit ja gewöhn
lich begegnen. Dabei spielen die elektrischen Netzwerke eine zentrale Rol
le. Ich habe allerdings der Versuchung widerstanden, die Netzwerke allein
zu betrachten, auf axiomatischer Grundlage wie es den amerikanischen Ge
pflogenheiten entspricht. Vielmehr bin ich der europäischen Tradition treu ge
blieben, und nach dem MAXWELLschen Vorbild vom elektrischen und ma
gnetischen Feld ausgegangen; die Netzwerke sind bekanntlich eine sehr lei
stungsfahige und praktisch bedeutsame Idealisierung des Geschehens in den
Feldern. Grundbegriffe der Elektrotechnik, wie Spannung, Stromstärke, In
duktivität, Kapazität usw. haben eine physikalische Bedeutung, die aus den
Eigenschaften des elektromagnetischen Feldes entspringt, und nur mit dessen
Hilfe befriedigend erklärbar ist. Zum Anderen hat der Ingenieur bei allen Idea
lisierungen deren Gültigkeitsgrenzen im Auge zu behalten; mit dem Blick auf
die Felder ist diese Pflicht leichter erfüllbar als bei einer abstrakten, formalwis
senschaftIichen Betrachtung elektrotechnischer Vorgänge allein.
Bei der Niederschrift des Manuskriptes haben mich meine Mitarbeiter Dr. Pa
trick Hofer und Dipl.-Ing. Kuno Schmid tatkräftig unterstützt; Herr Roger
Strasser hat in mühevoller Kleinarbeit Text und Bilder in den Datensatz ver
wandelt. Den genannten Herren und den ungenannten Helfern danke ich herz
lich.
Mein weiterer Dank gilt Herrn Dr. Jens Schlembach vom Teubner Verlag, ohne
dessen Initiative und Unterstützung das Buch nicht zustande gekommen wäre.
Zürich, August 1998 J. Hugel
Inhalt
Vorwort III
Inhaltsverzeichnis V
1 Einleitung 1
1.1 Die Ingenieurwissenschaft Elektrotechnik. 1
1.2 Das Mass-System ... . . . . . . . . . . 2
1.3 Die Basis-Masseinheiten der Elektrotechnik 3
1.4 Grössengleichungen....... 4
1.5 Aufgaben............. 7
1.5.1 Beleuchtungsstromkreis . 7
1.5.2 Durchtrenntes Kabel ... 9
1.5.3 Kabel- oder Steckerkurzschlüsse 9
2 Elektrische Ladungen und Felder 11
2.1 Der Begriff der elektrischen Ladung . 11
2.2 Das elektrische Feld . . . . . . . . . 13
2.3 Die Arbeit im elektrischen Feld . . . 16
2.4 Elektrische Spannung und elektrisches Potential, Maschenregel 19
2.5 Spannungsquellen und Erläuterungen zur Maschenregel 23
2.6 Äquipotentialftächen................ 25
2.7 Aufgaben...................... 27
2.7.1 Elektronenbewegung im elektrischen Feld 27
2.7.2 Kathodenstrahlröhre . . . . . . . 28
2.7.3 Sekundärelektronenvervielfacher 29
3 Der elektrische Strom 33
3.1 Bewegte Ladungsträger als Strom 33
3.2 Die Knotenregel ...... . 35
3.3 Elektrische Leitungsvorgänge 37
3.4 Aufgaben .......... . 43
3.4.1 Galvanisieranlage .. 43
3.4.2 Leitfähigkeit bei Halbleitern 44
VI Inhalt
4 Der elektrische Widerstand 47
4.1 Treibende und bremsende Einflüsse auf Ladungsbewegungen 47
4.2 Der elektrische Widerstand ....... 48
4.3 Spannungs- und Stromquellen . . . . . . 51
4.4 Einfache, lineare Gleichstromnetzwerke 57
4.5 Aufgaben............. 64
4.5.1 Elektrischer Kettenleiter . 64
5 Theorie der Gleichstromnetzwerke 67
5.1 Grundlagen und Aufgaben der Theorie . . . . . . 67
5.2 Die Methode der Knotenpotentiale . . . . . . . . 69
5.3 Ein Beispiel für die Methode der Knotenpotentiale 75
5.4 Weitere Methoden zur Berechnung von Netzwerken 78
5.5 Überlagerungsprinzip und Netzwerktheoreme 81
5.6 Beispiel zum Überlagerungssatz . . . . . . . . . . . 86
5.7 Beispiel zur Ersatz-Spannungsquelle ... . . . . . 88
5.8 Netzwerke mit begr. gültigen Spannungs-Strom-Beziehungen 89
5.9 Beispiele: Netzwerke mit abschnittweise linearen Kennlinien 96
5.10 Aktive Netzwerke, Operationsverstärker ........... 102
5.11 Aufgaben ............................ 112
5.11.1 Messeinrichtung für Innenwiderstände einer Spannungs-
quelle ...................... 112
5.11.2 Bestimmung von Widerständen in Netzwerken . 113
5.11.3 Spannungs-Konstanthalter. . . . . . . 114
5.11.4 Transistorverstärker . . . . . . . . . . 116
5.11.5 Stromquelle mit Operationsverstärker. 118
6 Arbeit und Leistung 121
6.1 Berechnung aus Spannung, Strom und Zeit 121
6.2 Energiewandlung . . . . . . . · . 123
6.3 Leistung eines Widerstandes. · .. 126
6.4 Wärmewirkung des Widerstandes .. 126
6.5 Thermoelektrische Energiewandlung 128
6.6 Aufgaben. ... . . . · . . . 135
6.6.1 Fehlerfreie Leistungsmessung . 135
6.6.2 Korrekturschaltung für einen Messgeber 136
6.6.3 Verlustbehaftete Leitung 137
6.6.4 Trolleybus-Fahrleitung .... . . 138
Inhalt VII
7 Die elektrische Verschiebung 141
7.1 Einleitung ........................... 141
7.2 Zusammenhang zwischen Feldstärke und elektrischer Verschie-
bung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.3 Die Kapazität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.3.1 Plattenkondensator mit homogenem Feld. 147
7.3.2 Zylinderkondensator . . . . . . . . . . . . 148
7.4 Das Coulombsche Anziehungsgesetz . . . . . . . 149
7.5 Ladestrom und Energieinhalt eines Kondensators. 150
7.6 Die Anziehungskraft im Plattenkondensator 151
7.7 Der elektrische Dipol ........ 152
7.8 Linien-, Flächen- und Raumladungen 155
7.9 Aufgaben............... 160
7.9.1 Schichtkondensator . . . . . 160
7.9.2 Kondensator mit geschichtetem Dielektrikum 161
7.9.3 Teilweise in eine Flüssigkeit eingetauchter Kondensator162
7.9.4 Elektrostatische Kraftwirkung . . . . . . . . . . . .. 163
8 Das magnetische Feld 165
8.1 Vorbemerkungen zum magnetischen Feld . ....... 165
8.2 Die magnetischen Wirkungen des elektrischen Stromes 167
8.3 Die Kraftwirkung im Magnetfeld des geraden Leiters 173
8.4 Die magnetische Feldstärke und das Durchftutungsgesetz 175
8.5 Der Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke und
Induktion ............................ 179
8.6 Das Magnetfeld als relativistischer Effekt bewegter Ladungen 183
8.7 Aufgaben ...................... 187
8.7.1 Magnetfeldberechnung in einer Ringspule 187
8.7.2 Magnetischer Dipol 188
8.7.3 Dauermagnetkreis 189
9 Das Induktionsgesetz 191
9.1 Vorbemerkungen zum Induktionsgesetz . ...... 191
9.2 Die induzierte Spannung in einem bewegten Leiter . 193
9.3 Induzierte Spannung bei veränderlichem Magnetfeld 196
9.4 Weitere Ausführungen zum Induktionsgesetz 198
9.5 Aufgaben .............. 204
9.5.1 HELMHOLTZ-Spulenpaar ..... 204
VIII Inhalt
9.5.2 Weltraumgenerator ... 206
10 Gegeninduktion und Selbstinduktion 209
10.1 Magnetische Kopplung von Stromkreisen . 209
10.2 Selbstinduktion.......... 211
10.3 Induktivität und Widerstand . . . . . . . . 212
10.4 Zwei verkoppelte Leiterschleifen . . . . . 214
10.5 Berechnung der Selbstinduktion einfacher Spulen 219
10.5.1 Ringspule ...... . 219
10.5.2 Schlanke Zylinderspule 221
10.6 Induktivitäten mit Eisenkreis . 221
10.7 Aufgaben............ 223
10.7.1 Abschalten von Gleichstrom 223
10.7.2 Ringkern mit Gegeninduktivität . 225
11 Wechselgrössen 227
11.1 Begriffe der Wechselgrössen. . . . . . 227
11.2 Elemente der Wechselstrom-Netzwerke 231
11.3 Zeigerdiagramme ........ 234
11.4 Einfache Wechselstromnetzwerke . . . 237
11.5 Aufgaben................ 240
11.5.1 Anpassung von Verbrauchern an ein Netz 240
11.5.2 Modulation von Wechselgrössen . . . 241
12 Komplexe Berechnung von Wechselstromkreisen 243
12.1 Komplexe Zahlen ............... 243
12.2 Wechselgrössen in der komplexen Zahlenebene . 247
12.3 Zusammengesetzte komplexe Widerstände 250
12.4 Der Schwingkreis . . . . . . . . 253
12.4.1 Der Reihenschwingkreis 254
12.4.2 Der Parallel schwingkreis 258
12.5 Allgemeines zum Transformator. 259
12.6 Fest verkoppelter und idealer Transformator 262
12.7 Leistungsbeziehungen bei Wechselgrössen . 268
12.8 Aufgaben................... 272
12.8.1 Wechselstromschaltung mit zwei Widerständen, Dros-
sel und Kondensator . . . . . . . . . . . . . . 272
12.8.2 Transformator mit verschiedenen Belastungen . . . . 272
Inhalt IX
12.8.3 Netztransformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
12.8.4 Magnetisierungsstrom eines Transformators mit Sät
tigungseinfluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
13 Wechselstromnetzwerke 277
13.1 Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Grössen 277
13.2 Maschen- und Knotenregel ............. 279
13.3 Allgemeines zur Theorie der Wechselstromnetzwerke 281
13.4 Aufgaben.......... 283
13.4.1 Allpass l. Ordnung . 283
13.4.2 Leistungsanpassung . 284
13.4.3 Fahrrad-Beleuchtung 284
14 Vierpole 287
14.1 Erklärung der Vierpole in verschiedenen Darstellungsformen 287
14.2 Messungen an Vierpolen. . . . . . . . 294
14.3 T- und II-Ersatzschaltbild des Vierpols 296
14.4 Verknüpfung von Vierpolen . . . . . . 298
14.5 Wellenparameter-Darstellung . . . . . 302
14.6 Nichtreziproke lineare Vierpole, Gyrator 307
14.7 Beispiel für einen nichtreziproken Vierpol 310
14.8 Aufgaben.................. 316
14.8.1 Vierpolersatzschema eines Transistors 316
14.8.2 Die elektrische Leitung als Vierpol 318
15 Mehrphasensysteme 321
15.1 Zweiphasensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
15.2 Mehrphasensysteme, insbesondere Dreiphasensysteme . . 325
15.3 Vergleich verschiedener Leistungsübertragungs-Systeme . 329
15.4 Symmetrische Drehspannungs-oder Drehstromsysteme 334
15.5 Allgemeine Drehspannungs-und Drehstromsysteme . . . 337
15.6 Aufgaben.......................... 340
15.6.1 Symmetrisches Drehspannungsnetz mit leerlaufender
Leitung ........................ 340
15.6.2 Symmetrierung einer Einphasenlast . . . . . . . . . . 342
15.6.3 Versorgung eines symmetrischen Drehstromverbrau-
chers aus einer Einphasenquelle . . . . . . . . . . . . 343
X Inhalt
16 Ortskurven 345
16.1 Erklärung der Ortskurven . . . . . . . . . . . 345
16.2 Konforme Abbildung analytischer Funktionen 347
Ih . . . . . . . . . . . .
16.3 Die Abbildung!Q= 348
16.4 Die Abbildung der allgemeinen bilinearen Funktion 352
16.5 Beispiele von Ortskurven .. . . . . . 356
16.5.1 Strom in variabler Induktivität 356
16.5.2 Phasendreher ..... 357
16.6 Beispiel für Ortskurvenscharen 359
16.7 Ergänzendes zu den Ortskurven 363
16.8 Aufgaben............ 365
16.8.1 Transformator mit Belastung 365
16.8.2 Ortskurve eines Reihenschwingkreises 367
17 Einschwingvorgänge 369
17.1 Erklärung der Einschwingvorgänge . . . . . . . . . 369
17.2 Einschwingvorgang bei Gleichspannungserregung . 371
17.3 Einschwingvorgang bei Wechselspannungserregung 376
17.4 Aufgaben....................... 378
17.4.1 Ausgleichsvorgang bei Kondensatoren in Reihenschal-
tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
17.4.2 Ausgleichsvorgang bei einem Zweiwicklungstransfor-
mator ..... 380
18 Lösungen zu den Aufgaben 383
18.1 Kapitell............. 383
18.1.1 Beleuchtungsstromkreis . 383
18.1.2 Durchtrenntes Kabel. . . 384
18.1.3 Kabel- oder Steckerkurzschlüsse 385
18.2 Kapite12 ................ . 388
18.2.1 Elektronenbewegung im elektrischen Feld 388
18.2.2 Kathodenstrahlrähre. . . . . . . 389
18.2.3 Sekundärelektronenvervielfacher 391
18.3 Kapitel3 .............. . 393
18.3.1 Galvanisieranlage ..... . 393
18.3.2 Leitfahigkeit bei Halbleitern 393
18.4 Kapitel 4 . . . . . . . . . . . . . 395
18.4.1 Elektrischer Kettenleiter ... 395
18.5 Kapitel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
18.5.1 Messeinrichtung für Innenwiderstände einer Spannungs-
quelle ...................... 397
18.5.2 Bestimmung von Widerständen in Netzwerken. 401
18.5.3 Spannungs-Konstanthalter. . . . . . . 404
18.5.4 Transistorverstärker . . . . . . . . . . 406
18.5.5 Stromquelle mit Operationsverstärker. 411
18.6 KapiteI6.................... 412
18.6.1 Fehlerfreie Leistungsmessung . . . . . 412
18.6.2 Korrekturschaltung für einen Messgeber 414
18.6.3 Verlustbehaftete Leitung 416
18.6.4 Trolleybus-Fahrleitung 418
18.7 Kapitel7 . . . . . . . . . . . . . 424
18.7.1 Schichtkondensator . . . 424
18.7.2 Kondensator mit geschichtetem Dielektrikum 425
18.7.3 In eine Flüssigkeit eingetauchter Kondensator 427
18.7.4 Elektrostatische Kraftwirkung . . . . . . . 428
18.8 Kapitel8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
18.8.1 Magnetfeldberechnung in einer Ringspule 432
18.8.2 Magnetischer Dipol 433
18.8.3 Dauermagnetkreis . . . . . 435
18.9 Kapitel9 . . . . . . . . . . . . . . 438
18.9.1 HELMHOLTZ-Spulenpaar 438
18.9.2 Weltraumgenerator . . . . 440
18.10 Kapitel 10 ............. 442
18.10.1 Abschalten von Gleichstrom 442
18.10.2 Ringkern mit Gegeninduktivität . 444
18.11 Kapitel 11 ................ 447
18.11.1 Anpassung von Verbrauchern an ein Netz 447
18.11.2 Modulation von Wechselgrössen . . . . . 449
18.12 Kapitel12 ..................... 451
18.12.1 Wechselstromschaltung mit zwei Widerständen, Dros-
sel und Kondesator ...... . . . . . . . . 451
18.12.2 Transformator mit verschiedenen Belastungen . . . . 452
18.12.3 Netztransformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
18.12.4 Magnetisierungsstrom eines Transformators mit Sät-
tigungseinfluss . 456
18.13 Kapitel 13 ........................... 457
Description:Grundlagenkenntnisse der Elektrotechnik werden heute in allen Ingenieurberufen benötigt und von allen Ingenieuren erwartet. Fachspezialisten, die sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie befassen, oder die auf einem der vielen Gebiete der elektrotechnischen Anwendung