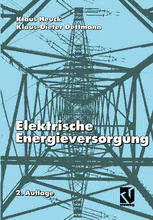Table Of ContentKlaus Heuck . Klaus-Dieter Dettmann
Elektrische Energieversorgung
__A us dem Programm ___________
Elektrische Energietechnik
Einftihmng in die elektrische Energiewirtschaft
von K. Brinkmann
Elektrische Energieversorgung
von K. Heuck und K.-D. Dettmann
Einfiihmng in die Hochspannungs-Versuchstechnik
vonD.Kind
Hochspannungs-Isoliertechnik
von D. Kind und H. Karner
Neue Wege der Energieversorgung
von W. Kremer, J. Thiele und F. Wahl
Kemenergie und Kemtechnik
von E. Luscher (Hrsg.)
Zeitschrift ftir Energiewirtschaft
Herausgeber: H. K. Schneider und C. C. von Weizsacker
___ ________________________________
~eweg ~
Klaus Heuck . Klaus-Dieter Dettmann
Elektrische
Energieversorgung
Zweite, neubearbeitete Auflage
Mit 490 Abbildungen,
14 Tabellen und 57 Aufgaben mit Losungen
Unter Mitarbeit van Egan Reuter
Dieses Lehrbuch entstand mit Unterstiitzung der ELEKTROMARK, Hagen
1. Aufiage 1984
2., neubearbeitete Aufiage 1991
Der Verlag Vieweg ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
Aile Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Veriagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1991
Softcover reprint of the hardcover 2nd edition 1991
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung in
anderen als den gesetzlich zugelassenen Fallen bedarfd eshalb dervorherigen
schriftlichen Einwilligung des Veriages.
Umschlaggestaltung und Foto: Moll, ELEKTROMARK
Satz: Waldhaim, Hamburg
Druck: Wilhelm + Adam, Heusenstamm
Buchb. Verarbeitung: Lengericher Handelsdruckerei, Lengerich
Gedruckt auf saurefreiem Papier
ISBN-13: 978-3-528-18547-3 e-ISBN-13: 978-3-322-83619-9
DOl: 10.1007/978-3-322-83619-9
v
Vorwort
Das Buch "Elektrische Energieversorgung" vermittelt vornehmlich die Kenntnisse, die von sei
ten der Industrie und Energieversorgungsunternehmen bei Jungingenieuren als Grundwissen
erwartet werden. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung der physikalischen Zusammenhange
gelegt, die fiir die Energieversorgung bestimmend sind; die Darstellung der Technologie be
schrankt sich auf das Mafi, welches fiir das Verstandnis von Planung und Betrieb von Netzen
notwendig ist.
Das Buch ist so angelegt, dafi es auch fiir ein Selbststudium geeignet ist. Zu diesem Zweck ist
strikt darauf geachtet worden, dafi die einzelnen Begriffe bzw. Definitionen streng und folge
richtig nacheinander entwickelt werden. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Grund
lagenkenntnisse wie z.B. die Berechnung galvanisch-induktiv gekoppelter Kreise, die nach den
Erfahrungen der Autoren nicht generell bei Studenten nach dem Vorexamen zu erwarten sind,
werden erlautert oder zumindest noch einmal gestreift.
Urn die Verstandlichkeit weiter zu erhohen, werden die Modelle, von denen ausgegangen wird,
zunachst sehr einfach gehalten. Fiir die analytische Formulierung werden, von einer Ausnahme
abgesehen, die Kenntnisse der Mathematik benotigt, wie sie iiblicherweise nach dem Grundstu
dium an einer Fach- oder wissenschaftlichen Hochschule vorliegen. Es werden die Giiltigkeitsbe
reiche dieser Modelle im Hinblick auf ihre Anwendung in der Praxis herausgearbeitet. Sofern die
Idealisierungen fiir wichtige Bereiche der Praxis zu weitreichend sind, wird auf kompliziertere
Modelle eingegangen. Urn die mathematischen Anforderungen niedrig zu halten, wird jedoch bei
diesen Modellen vielfach mit der physikalischen Plausibilitat argumentiert. Dabei wird auch auf
Feinheiten eingegangen, die fiir den bereits im Berufsleben stehenden Ingenieur von Interesse
sein diirften.
Der stufenformige Aufbau gestattet es, dafi die Passagen, welche die komplizierteren Modelle
behandeln, iibersprungen werden konnen, ohne dafi es im weiteren zu Verstandnisschwierigkei
ten kommen mufi. Aufgrund dieses Aufbaus sind die Autoren der Meinung, dafi mit diesem
Buch nicht nur die Studenten der Hoch-, sondern auch der Fachhochschulen angesprochen wer
den. Zugleich diirfte damit auch der bereits in der Praxis stehende Ingenieur seine Kenntnisse
auffrischen und erweitern konnen.
Seit der Erstellung des Manuskriptes fiir die erste Auflage Anfang der achtziger Jahre haben eine
Reihe moderner Technologien zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dazu seien einige Beispie
Ie genannt: Wirbelschichtfeuerung, SF -Technik, VPE-Kunststoff in der Kabeltechnik, Einsatz
6
leistungsstarker Generatoren mit grofier subtransienter Reaktanz, breite Verwendung von Rech
nern zur Steuerung des Netzbetriebs und zur Planung von Netzen. Diese Entwicklungen haben
zu Modifikationen bei den Netzberechnungsverfahren und damit einhergehend auch zu Ande
rungen bei vielen DIN-VDE-Bestimmungen gefiihrt.
In der erst en Auflage konnten diese Entwicklungen nicht hinreichend beriicksichtigt werden. Urn
das erforderliche Mafi zu erreichen, mufite die erste Auflage so tiefgreifend umgearbeitet werden,
dafi praktisch eine Neufassung entstand; die alte, 1987 bereits vergriffene Auflage konnte nur
noch fragmentarisch verwendet werden. Bei der Neufassung liefi sich die angestrebte Praxis
niihe dadurch vertiefen, dafi Herr Dr.-Ing. Reuter, Abteilungsdirektor und Leiter der Abteilung
Elektrotechnik beim Energieversorgungsunternehmen ELEKTROMARK, als Mitautor gewon
nen werden konnte. Die Autoren glauben, dafi die daraus erwachsene gemeinsame Arbeit von
Hochschule und Praxis zu einer fruchtbaren Symbiose gefiihrt hat. Dadurch ist das Buch noch
starker als bisher auf die beiden Zielgruppen - Studenten und Ingenieure in der Praxis - aus
gerichtet. Zur Vertiefung des Verstiindnissses sind 57 praxisnahe Aufgaben einschliefilich einer
Skizze des Losungsweges und Angabe von Losungen aufgenommen worden.
Ahnlich wie bei der erst en Auflage haben die Autoren auch das neuverfafite Manuskript wie-
VI
derum einer Reihe von Fachleuten mit der Bitte urn kritische Stellungnahme vorgelegt. So hat
erneut Herr Dr.-Ing. Dietrich, Niirnberg, eine Reihe von Verbesserungen bei den Abschnitten 4.2
und 9.4.5 vorgeschlagen. Auf seinen Rat hin ist u.a. der EinfiuB des Kessels auf die Nullindukti
vitiit des Transformators iiberarbeitet worden. Auch Herr Prof. Funk, Universitiit Hannover, hat
wiederum sehr konstruktiv zu einer Reihe von Kapiteln Stellung genommen. 1m gleichen Sinn
hat auch Herr Prof. Nelles, Universitiit Kaiserslautern, gewirkt. Fiir dieses Entgegenkommen
mOchten sich die Autoren nochmals bedanken. Weiterhin sind die Autoren Herrn Gully, Herrn
Brendel, Frau Jacob sowie Herrn und Frau Waldhaim zu groBem Dank verpflichtet, ohne deren
Mithilfe das Buch nicht hiitte erscheinen konnen.
1m Rahmen der Neufassung muBten nahezu alle der ca. 500 Bilder neu gestaltet werden. 1m
wesentlichen sind diese sehr aufwendigen Arbeiten von Herrn Gully, ELEKTROMARK, und
der Zeichenstelle der UniBw Hamburg unter Leitung von Herrn Brendel ausgefiihrt worden.
Weiterhin hiitte ohne den tatkriiftigen Einsatz von Frau Jacob, Sekretiirin am Fachgebiet Ener
gieversorgung, die Reinschrift des Manuskriptes kaum die gewiinschte Form angenommen. Es
waren eine Reihe von Iterationen notwendig, bevor die endgiiltige Fassung erreicht war. Ei
ne entsprechend umfangreiche Arbeit stellte die erstmalige Erfassung des Manuskriptes fiir
ein Textverarbeitungssystem dar. Durch eine schnelle Einarbeitung in die Sprachsyntax von
u,TEX, ihre geschickte Handhabung sowie durch einen groBen personlichen Einsatz gelang es
Frau Waldhaim, diese Aufgaben ziigig zu bewiiltigen. Unterstiitzt wurde sie dabei von Herrn
Dipl.-Ing. Waldhaim, Mitarbeiter am Fachgebiet Energieversorgung. Herr Waldhaim hat nicht
nur die u,TEX-Makros an die internen Verlagsnormen angepaBt, sondern dariiberhinaus stammt
von ihm auch der gesamte Satz und das Layout des Buches.
Einen beachtlichen Beitrag zur Fertigstellung des Manuskriptes haben weiterhin Herr Dr.-Ing.
Kegel, Herr Dr.-Ing. Heidorn und Herr Dr.-Ing. Fricke geleistet. Herr Dr.-Ing. Kegel war sei
nerzeit Leiter des Labors Energieversorgungj Herr Dr.-Ing. Heidorn sowie Herr Dr.-Ing. Fricke
waren Wissenschaftliche Mitarbeiter am Fachgebiet Energieversorgung. Sie haben intensiv Kor
rektur gelesen und bei der Erstellung des Manuskriptes mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Ebenfalls bedanken sich die Autoren bei Herrn Sauermann, ELEKTROMARK, der zusammen
mit Herrn Gully die druckfertige Version auf Schreibfehler iiberpriift hat. GroBen Dank schulden
die Autoren auch dem Vieweg Verlag fiir die Bereitschaft, diese Neufassung herauszugeben.
Hamburg, im Miirz 1991 Klaus Heuck
Klaus-Dieter Dettmann
Egon Reuter
VII
Inhaltsverzeichnis
Formelzeichen XII
1 Uberblick tiber die geschichtliche Entwicklung der elektrischen
Energieversorgung 1
2 Grundztige der elektrischen Energieerzeugung 5
2.1 Fossil befeuerte Kraftwerke .................... . 5
2.1.1 Kondensationskraftwerke ................. . 5
2.1.1.1 Prinzipieller Ablauf der Energieumwandlung in
Kondensationskraftwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.1.2 Aufbau von Kondensationskraftwerken .......... 8
2.1.1.3 Wiirmeverbrauchskennlinie von Kondensationskraftwerken 14
2.1.2 Uberblick tiber weitere Wiirmekraftwerke 15
2.1.2.1 Gegendruckanlagen ..... 15
2.1.2.2 Kraftwerke mit Gasturbinen 15
2.1.2.3 Kombinationskraftwerke. 16
2.2 Wasserkraftwerke............. 17
2.2.1 Bauarten von Wasserturbinen .. 17
2.2.2 Bauarten von Wasserkraftwerken 18
2.3 Kernkraftwerke . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Kraftwerksregelung ........... . 22
2.4.1 Regelung von Wiirmekraftwerken 22
2.4.1.1 Regelung eines Blockes im Inselbetrieb 22
2.4.1.2 Regelung im Insel- und Verbundnetz . 27
2.4.2 Regelung von Wasser- und Kernkraftwerken . 31
2.5 Kraftwerkseinsatz . . . . . . . 31
2.5.1 Verlauf der Netzlast . 31
2.5.2 Deckung der Netzlast 32
2.6 Aufgaben '" ....... . 33
3 Aufbau von Energieversorgungsnetzen 35
3.1 Ubertragungssysteme ..... 35
3.2 Wichtige Netzstrukturen . . . 38
3.2.1 Niederspannungsnetze 39
3.2.2 Mittelspannungsnetze 41
3.2.3 Hoch- und Hochstspannungsnetze . 43
3.3 Aufgaben ... . . . . . . . . . . . . . . . 45
4 Aufbau und Ersatzschaltbilder wichtiger Netzelemente 47
4.1 Berechnung von Netzwerken mit induktiven Kopplungen . 47
4.1.1 Analytische Beschreibung induktiver Kopplungen . 47
4.1.2 Induktive Kopplungen in Netzen 51
4.1.3 Nichtlineare Induktivitaten . . . . . . . . . . . . . 55
VIn Inhaltsverzeichnis
4.2 Transformatoren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.1 Einphasige Zweiwicklungstransformatoren . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2.1.1 Autbau und Giiltigkeitsbereich induktiver Modelle von
einphasigen Zweiwicklungstransformatoren 57
4.2.1.2 Ersatzschaltbild eines einphasigen
Zweiwicklungstransformators . . . . . . . . 61
4.2.1.3 Betriebsverhalten von Zweiwicklungstransformatoren im
einphasigen Netzverband .................. 66
4.2.2 Einphasige Dreiwicklungstransformatoren . . . . . . . . . 68
4.2.3 Dreiphasige Transformatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
4.2.3.1 Autbau eines Drehstromtransformators mit zwei
Wicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
4.2.3.2 Schaltungen .................... 73
4.2.3.3 Ubersetzung bei symmetrischem Betrieb 74
4.2.3.4 Ersatzschaltbild fUr den symmetrischen Betrieb 77
4.2.3.5 Betriebsverhalten von dreiphasigen
Zweiwicklungstransformatoren im Netzverband . . . . .. 82
4.2.4 Spartransformatoren.................... 84
4.2.4.1 Autbau und Einsatz von Spartransformatoren 84
4.2.4.2 Ersatzschaltbild eines Spartransformators . . . 86
4.2.5 'Iransformatoren mit einstellbarer Ubersetzung ..... 88
4.2.5.1 Erlauterung der direkten Spannungseinstellung . 88
4.2.5.2 ErHiuterung der indirekten Spannungseinstellung . 90
4.2.5.3 Leistungsverhaltnisse bei Umspannern mit einstellbaren
Ubersetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3 Wandler.......... 96
4.3.1 Spannungswandler 96
4.3.2 Stromwandler... 98
4.4 Synchronmaschinen. . . . 100
4.4.1 Grundsatzlicher Autbau von Synchronmaschinen 100
4.4.2 ErHi.uterungen zum Betriebsverhalten von Synchronmaschinen . 101
4.4.2.1 Ersatzschaltbild fUr den stationaren Betrieb 101
4.4.2.2 Betriebseigenschaften von Synchronmaschinen in
Energieversorgungsnetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.4.2.3 Spannungsregelung von Synchronmaschinen. . . . . . . . 110
4.4.3 Erlauterungen zum KurzschluBverhalten von Synchronmaschinen . 112
4.4.3.1 Dreipoliger KlemmenkurzschluB bei einer verlustfreien,
leerlaufenden Synchronmaschine mit Dauermagnetlaufer . 112
4.4.3.2 Dreipoliger KlemmenkurzschluB bei einer verlustfreien,
leerlaufenden Vollpolmaschine mit Gleichstromerregung . 114
4.4.3.3 KurzschluBverhalten einer belasteten Vollpolmaschine 117
4.5 Freileitungen ............ . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.5.1 Autbau von Freileitungen . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.5.2 Ersatzschaltbilder von Drehstromfreileitungen fUr den
symmetrischen Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.5.2.1 Induktivitatsbegriff bei Dreileitersystemen 128
4.5.2.2 Kapazitatsbegriff bei Dreileitersystemen . . 134
Inhaltsverzeichnis IX
4.5.2.3 Ohmscher Widerstand bei Dreileitersystemen . 140
4.5.2.4 Ableitungswiderstand bei Dreileitersystemen 141
4.5.3 Betriebsverhalten von symmetrisch aufgebauten
Drehstromfreileitungen bei symmetrischem Betrieb 142
4.6 Kabel 146
4.6.1 Aufbau von Kabeln ................ . 147
4.6.2 Ersatzschaltbild und Betriebsverhalten von Drehstromkabeln 154
4.7 Lasten .................... . 156
4.8 Leistungskondensatoren .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.8.1 Aufbau von Leistungskondensatoren ............. . 159
4.8.2 Grundsatzliche ErHiuterungen zur Blindleistungskompensation 160
4.8.3 Blindleistungskompensation bei Netzen mit parasitaren
Oberschwingungen 162
4.9 Drosselspulen ........................... . 167
4.10 Schalter .............................. . 169
4.10.1 Ersatzschaltbild und prinzipielle Eigenschaften von Schaltern 169
4.10.2 Beschreibung wichtiger Schaltertypen 170
4.11 Schaltanlagen ............. . 176
4.11.1 Schaltplane von Schaltanlagen ... . 176
4.11.2 Bauweise von Schaltanlagen ..... . 180
4.11.3 Beriicksichtigung von Schaltanlagen in Ersatzschaltbildern . 187
4.11.4 Leittechnik in Schaltanlagen ................. . 187
4.12 Uberblick iiber wichtige Einrichtungen zum Schutz von Netzelementen 189
4.12.1 Einrichtungen zum Schutz vor Uberspannungen . 189
4.12.2 Einrichtungen zum Schutz vor Uberstromen . 193
4.12.2.1 Sicherungen und Is-Begrenzer . 194
4.12.2.2 Schutzsysteme 199
4.13 Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
5 Bemessung von Netzen im Normalbetrieb 211
5.1 Bemessungskriterien fiir den Normalbetrieb und Erlauterungen zu
elektrisch kurzen Leitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.2 Einseitig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen 212
5.3 Einseitig gespeiste Leitung mit Verzweigungen 217
5.4 Zweiseitig gespeiste Leitung 218
5.5 Vermaschtes Netz ..... . 221
5.6 Nachbildung von Teilnetzen 223
5.7 LastfluBrechnung 225
5.8 Aufgaben .. . . . . . 230
6 Dreipoliger Kurzschlu6 233
6.1 Generatorferner dreipoliger KurzschluB .............. . 233
6.1.1 Berechnung des stationaren KurzschluBstromverlaufes in
unverzweigten Netzen ................... . 234
6.1.2 Berechnung des transienten KurzschluBstromverlaufes in
unverzweigten Netzen ................... . 235
x Inhaltsverzeichnis
6.2 Generatornaher dreipoliger KurzschluB ........... . 238
6.2.1 Verzweigte Netze mit einer Generatoreinspeisung .. 238
6.2.2 Beriicksichtigung von Verbrauchern und Querkapazitaten 244
6.2.3 Verzweigte Netze mit mehreren Generatoreinspeisungen 246
6.3 Aufgaben ............................. . 250
7 Kurzschlu6festigkeit von Anlagen 254
7.1 Lichtbogenkurzschliisse in Anlagen . . . . . . . . . . . . . 254
7.2 Mechanische KurzschluBfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 256
7.2.1 Auslegung von linienformigen, biegesteifen Leitern . 256
7.2.2 Auslegung von Leiterschienen mit groBen Querschnittsabmessungen 260
7.2.3 Auslegung von Stiitzern . . . . . . . . . 262
7.2.4 Auslegung von Leiterseilen und Kabeln .... 263
7.3 Thermische KurzschluBfestigkeit ............ 263
7.4 MaBnahmen zur Beeinflussung der KurzschluBleistung 268
7.5 Auswirkungen von Kurzschliissen auf das transiente
Generatordrehzahlverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.5.1 Wichtige Netzparameter zur Gewahrleistung der transienten
Stabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.5.2 Drehzahlverhalten der Generatoren in einem kurzschluBbehafteten
Netz mit mehrfacher Generatoreinspeisung 277
7.6 Aufgaben .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
8 Grundziige der BetriebsiUhrung und Planung von Netzen 281
8.1 Betriebsfiihrung von Netzen ............ . 281
8.2 Wichtige Gesichtspunkte zur Planung von Netzen . 283
8.3 Aufgaben ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 288
9 Berechnung von unsymmetrisch gespeisten Drehstromnetzen mit
symmetrischem Aufbau 290
9.1 Methode der symmetrischen Komponenten ............ . 290
9.2 Anwendung der symmetrischen Komponenten auf unsymmetrisch
betriebene Drehstromnetze ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
9.3 Impedanzen wichtiger Betriebsmittel im Mit- und Gegensystem der
symmetrischen Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
9.4 Impedanzen wichtiger Betriebsmittel im Nullsystem der symmetrischen
Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
9.4.1 Nullimpedanz einer Freileitung ohne Erdseil ............. 301
9.4.1.1 Ohmscher Widerstand einer nullspannungsgespeisten
Freileitung .......................... 301
9.4.1.2 Induktivitat einer nullspannungsgespeisten Freileitung. 303
9.4.1.3 Kapazitaten einer nullspannungsgespeisten Freileitung. 305
9.4.2 Nullimpedanz einer Freileitung mit Erdseil 305
9.4.3 Nullimpedanz einer Doppelleitung 307
9.4.4 Nullimpedanz von Kabeln . . . . . . . . . . 308