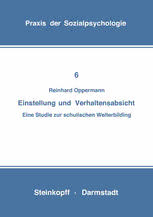Table Of ContentPRAXIS DER SOZIALPSYCHOLOGIE
PRAXIS DER SOZIALPSYCHOLOGIE
Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Rudinger, Bonn
BAND 6
EINSTELLUNG UND VERHALTENSABSICHT
"
~
DR. DIETRICH STEINKOPFF VERLAG
DARMSTADT 1976
EINSTELLUNG
UND VERHALTENSABSICHT
EINE STUDIE ZUR SCHULISCHEN WEITERBILDUNG
Von
Dr. Reinhard Oppermann
Bonn-Beue!
Mit 37 Tabellen
DR. DIETRICH STEINKOPFF VERLAG
DARMSTADT 1976
Reinhard Opper1l1Jlnn wurde am 16. Juni 1946 in Hoxter/Weser geboren. Nach
Berufsausbildung (Elektriker) und Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg Studium der
Theologie und Philosophie in Paderbom und ab 1969 der Psychologie in Bonn; 1973
Dipl. Psych.; 1975 Promotion. Seit 1974 wissenschaftlicher Angestellter am Seminar
fijr Politische Wissenschaft an der Universitat Bonn im Studienprojekt "Partizipations
forschung".
Interessengebiete:
Bildungsentscheidungen unter sozialpsychologischem Gesichtspunkt
Einstellungs-Verhaltens-Relation
Sozialisation
Politisches Verhalten
CIP-Kurztitel der Deutschen Bibliothek
Oppermann, Reinhard
Einstellung und Verhaltensabsicht:
e. Studie zur schul. Weiterbildung.
1. Aufl. - Darmstadt: Stemkopff, 1976
(Praxis der Sozialpsychologie; Bd. 6)
ISBN-13: 978-3-7985-0465-3 e-ISBN-13: 978-3-642-47058-5
DOl: 10.1007/978-3-642-47058-5
© 1976 by Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH & Co. KG./Darmstadt
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1976
Aile Rechte vorbehalten (insbesondere des Nachdrucks und der 'Obersetzung)
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Xerographie,
Mikrofilm, unter Verwendung elektronischer Systeme oder anderer Reproduktions
verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert werden. Bei Her
stellung einzelner Vervielfiiltigungsstiicke des Werkes oder von Teilen davon ist nach
§ 54, Abs. 2 URG eine Vergiitung an den Verlag zu entrichten, iiber deren Hahe der
Verlag Auskunft erteilt.
Gesamtherstellung: Mono-Satzbetrieb, Darmstadt-Arheilgen
IV
Zweck und Ziel der Reihe
Praxis der Sozialpsychologie liefert Informationen aus der Praxis sozialpsycho
logischer Forschungsarbeit, deren Ergebnisse Moglichkeiten zur Losung gegen
wartiger Sozialer Probleme bieten sollen.
Praxis der Sozialpsychologie tragt zur systematischen Sammlung sozialpsycholo
gischer Kenntnisse und Erkenntnisse bei. Sozialpsychologie wird dabei im weite
sten Sinne, z. B. im Sinne der Handbticher von Graumann und Lindzey/Aron
son·), verstanden.
Praxis der Sozialpsychologie ist als Forum fur soziale Psychologie in seiner
Erscheinungsform und -weise nicht fixiert: neben Monographien werden auch
Sammelbiinde mit mehreren Beitragen verschiedener Autoren zu einem tiberge
ordneten Leitthema, kritische Sammelreferate tiber sozialpsychologische Neuer
scheinungen und Reader zur VerOffentlichung angenommen. Hauptgewicht wird
auf empirische Beitrage gelegt, seien es Feldstudien, Feldexperimente oder Labor
versuche. Der stets angestrebte Praxis-Bezug mu6 jedoch in jedem Fall den metho
dischen Anforderungen geniigen, wie sie etwa von Bredenlazmp und Feger··)
zusammengestellt worden sind. Die Bevorzugung empirischer Arbeiten steht jedoch
der Publikation von theoretischen Entwiirfen und methodologischen Beitragen
nicht im Wege.
Praxis der Sozialpsychologie wendet sich an Psychologen, Soziologen, Sozial
wissenschaftler allgemein und an die Fachleute der Praxis, welche in ihrer Arbeit
auf empirisch fundierte Informationen aus der Sozialpsycho!ogie angewiesen
sind.
Praxis der Sozialpsychologie solI moglichst in 4 Banden pro Jahr in etwa
vierteljahrlichen Abstanden erscheinen. Manuskripte sind an den Unterzeichneten
einzureichen, der tiber ihre Aufnahme in die Sammlung entscheidet und den
Mitarbeitern die entsprechenden Richtlinien fur die Gestaltung der Bande auf
Wunsch tibermittelt. Herausgeber und Vedag sind fur alle Anregungen fur die
weitere Ausgestaltung der Reihe jederzeit dankbar.
Prof. Dr. Georg Rudinger
Psychologisches Institut der Universitat Bonn,
5300 Bonn 1, An der Schlo6kirche
.) Lindzey, G. & Aronson, E.: (Eds.): The Handbook of Social Psychology,
5 Vols., Addison-Wesley, Reading Massachusetts 1968/1969
Graumann, C.F. (Hrsg.): Handbuch der Psychologie, 7, I: Sozialpsychologie:
Theorien und Methoden, Hogrefe Gottingen 1969 und
Handbuch der Psychologie, 7,2: Sozialpsychologie: Forschungsbereiche, Hogrefe
Gottingen 1972
**) Bredenkamp, J. & Feger, H.: Kriterien flir die Entscheidung tiber Aufnahme
empirischer Arbeiten in die Zeitschrift flir Sozialpsychologie,
Zeitschrift ftir Sozialpsychologie, 1, 1970, 43 - 47
v
Vorwort
GroLl.e Teile der Arbeit wurden als Dissertation betreut von Herrn Prof.
Dr. R. Bergler, dem ich fUr die dabei gewahrte Hilfe danke.
Wertvolle Anregungen erfuhr ich in Diskussionen mit den Herren Drs.
B. Schiifer und B. Six und Herrn Prof. Dr. G. Rudinger. Besonders hilfreich
war die im Rahmen von Praktika geleistete UnterstUtzung von Fraulein
Giesela Nickel und Herrn Klaus Landwehr.
Die Arbeit hatte nicht zustandekommen konnen, wenn mir durch
Kultusministerium, Schulaufsichtsbehorde, Schulleiter und Lehrer nicht
groLl.zUgiges Entgegenkommen gezeigt worden ware und die Schiller nicht
in oft mUhevoller Arbeit die Fragebogen der Vor-und Hauptuntersuchung
beantwortet hatten.
Die Datenverlochung der Hauptuntersuchung besorgte Herr Gerd Schiifer.
Allen beteiligten Personen gilt mein ausdrUcklicher Dank!
Die Berechnungen wurden auf der Rechenanlage IBM 370-165 im
Rechenzentrum der Universitat Bonn durchgefUhrt. Au&r eigenen wurden
u..
Rechenprogramme von K.H. Steffens, F. Kahlau, H. Kohr, T. Krumnack
und F. Gebhardt benutzt.
Bonn, Herbst 1976 Reinhard Oppermann
VI
Erliiuterungen zum Autbau dieses Beitrages
Die vorliegende Arbeit kann als die Synthese von drei Untersuchungs
anliegen betrachtet werden:
1. soUte ein theoretischer und operationaler Beitrag zur Analyse des Ein
stellungskonzeptes geliefert werden mit der Behandlung von Fragen der
Einstellungsbildung, der -iinderung und der Verhaltensrelevanz von Ein
steUungen (Kapitel 2);
2. sollte die methodische Umsetzung der Operationalisierung der relevanten
Variablen geleistet werden in kritischer Auseinandersetzung mit den
wichtigsten Meflverfahren der Einstellung: semantisches Differential,
Likert-, Thurstone- und Guttman-Skala. Dabei sollten sowohl der heutige
Kenntnisstand aufgearbeitet als auch die eigenen Konstruktionsschritte
ausfUhrlich beschrieben werden (Kapitel 5 und 6);
3. sollte zusammenfassend der Forschungsstand dargestellt werden zur
Frage der Bedeutung von Schulblldung fUr unser soziales System und
der Abhiingigkeit der Schulentscheide von den Einstellungen der Eltern
beim Dbertritt des Kindes von der Grundschule zur weiterfiihrenden
Schule (diese Fragen werden auf dem Hintergrund bisheriger Untersu
chungen in Kapitel 1 behandelt) und ein eigener Beitrag geleistet werden
zur Frage der Abhiingigkeit der Bereitschaft zu schulischer Weiterbildung;
nach einem Lehrabschlufl von den Blldungseinstellungen und den wahr
genommenen sozialen Verhaltenserwartungen bei Schillern des Ab
schlufljahrgangs kaufmiinnischer Berufe einerseits und zur Abhiingigkeit
der Auseinandersetzung der SchUler mit schulischer Weiterbildung von
Merkmalen ihrer Sozialisation andererseits (die Ergebnisse dieser Unter
suchung werden in Kapitel 8 dargestellt - cf. besonders 8.4 und 8.5).
Die beiden ersten Teile der Arbeit wurden in etwas anderer Form im
Sommer 1975 als Dissertation an der Philosophischen Fakultiit der Uni
versitiit Bonn vorgelegt mit dem Titel: "Die Dreikomponentenkonzeption
der EinsteUung - untersucht am Beispiel der schulischen Weiterbildung".
der Punkt 3 stellt grofltenteils eine Ergiinzung dar.
Die einzelnen Teile der Arbeit sind zwar aufeinander bezogen, doch
lassen sie sich auch einzeln verwerten fUr solche Leser, die z.B. hauptsiich
lich an Konstruktionsprinzipien von Einstellungsskalen interessiert sind
oder an der Einstellungsstruktur von kaufmiinnischen Berufsschiilern zur
schulischen Weiterbildung
VII
Inhalt
Zweck und Ziel der Reihe . . . . . . v
Vorwort ....................... . VI
Erliiuterungen zum Aufbau die8e8 Beitrage8 . . . . . . . . . VII
1. Bedeutung von SchulbHdung und BHdungsentscheidungen .. 1
2. EinsteUungskonzeption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
21 Begriffsbestimmung ....................... . 5
22 Aussagenanalyse .........•................ 10
22.1 Affektive und kognitive Aspekte der Einstellungsaussagen ........ . 11
22.2 Konative Aussagen ............•................... 25
23 Theoretische und empirische Beitriige zur Beziehung der Komponenten
zueinander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.1 Die Beziehung zwischen Affekt und Kognition ............... . 32
23.2 Die Beziehung zwischen Einstellung und Verhaltensabsicht bzw. Verhalten 39
3. Hypothesen der Untersuchung. . . . . . . . . . . . . . 50
4. Wahl des Einstellungsobjektes der Untersuchung . . . . . SO
S. Darstellung des Versuchsplanes und der Methoden 51
5.1 Das Bewertungsdifferential. . . . . . . . . . . . 52
5.2 Das Wahrscheinlichkeitsdifferential . . . . . .. 58
5.3 Konstruktionskriterien von Einstellungsskalen. 62
5.3.1 Die Thur8tone-Skala. . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3.2 Die Likert-Skala. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.3.3 Kombinierbarkeit von Thu1'8tone- und Likert-Skalen . . . 69
6. Entwicklung der eigenen Skalen . . . . . . . . . . . . . . 72
6.1 Bestimmung der Untersuchungspopulation und Beschreibung der Stich-
proben ...................................... . 73
6.2 Konstruktion des Bewertungsdifferentials . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 78
6.3 Konstruktion des Wahrscheinlichkeitsdifferentials. . . . . . . . . . . . . . 80
6.4 Konstruktion der Einstellungs-und Absichtsskala. •.............. 81
6.5 Ermittlung der Bezugsobjekte, Bezugspersonen und Entscheidungs-
alternativen. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 88
7_ Zuverllissigkeitsschiltzungen der entwickelten Instrumente . 95
8. Ergebnis1tericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.1 Zur Variablenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 97
8.2 Deskriptive Statistiken der Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.3 Entscheidung tiber die Zusatzhypothesen .. 103
8.4 Entscheidung tiber die Haupthypothesen. . . . . . . . . . . . . . 105
VIII
8.5 Erkllirbarkeit der Bildungseinstellungen, -erwartungen und -absichten durch
Sozialisationsmerkmale der SchUler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8.5.1 Der Einflu1\ des Vaters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.5.2 Der Einfluf.\ der Mutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122
8.5.3 Der Einflu1\ der Geschwister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123
8.5.4 Der Schulabschluf.\ der SchUler und ihr Beruf als Merkmale sekundlirer und
beginnender tertilirer Sozialisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125
8.6 Merkmale der schulischen Weiterbildung und ihre Bedeutsamkeit. . . . 126
9. ZU!JI1mmenfassung. . 127
10. Anhang..... 129
11. Literatur.... 157
Sachregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
IX
1. Bedeutung von Schulbildung und Bildungsentscheidungen
Bildung und Erziehung hat fUr aIle Kulturen eine bedeu tsame Rolle im
Prozei.) der Vergesellschaftung gespielt. Bildungs- und Erziehungsinstitu
tionen - besonders Sehuleinriehtungen - haben daher aufmerksame 8e
achtung gefunden: in standischer Gesellschaft ausdriicklich als Instrument
der Aufrechterhaltung von Standes- und Berufsprivilegien, in heutiger Ge
sellsehaft faktisch als "erste und damit zentrale soziale Dirigierungsstelle
fUr die zukiinftige soziale Sicherheit, fUr den kiinftigen sozialen Rang und
fUr das Ausmai.) kiinftiger Konsummogliehkeiten" (Scheisky 1961, 17).
Dabei sind es nicht unbedingt die dort vermittelten Kenntnisse und
Fertigkeiten, mit denen ausgeriistet man den Zutritt zu bestimmten sozia
len oder beruflichen Positionen erwirbt, sondern "der Grad des Abschlus
ses der Schulbildung (ist) ein manifestes soziales Merkmal, ein Attribut,
das yom letzten Schultag bis ans Lebensende unabhangig yom Lebens
erfolg und fast so unverandoerlieh wie angeborene Merkmale gewertet wird"
(Strzelewicz, Raapke und Schulenberg 1966, 587), so dai.) "ein Abiturient,
der als unterer Angestellter sein Leben beschliei.)t, ... vor sich und seiner
Umwelt Abiturient bleiben (wird), wie andererseits ein erfolgreicher Ge
schaftsmann es nicht vergii.)t oder vergessen machen kann, wenn er ,nur'
von der Volksschule kommt" (ebenda, 588).
Vor diesem Hintergrund sind zwei Fragen bedeutsam, die unter den
Begriffen der Chancengieichheit und der Bildungssackgasse in die politisehe
wie wissenschaftliehe Diskussion eingegangen sind.
Bei der Auseinandersetzung urn die Chancengleichheit geht es verkiirzt
gesprochen darum, jedem Mitglied der Gesellschaft eine gleiche Chance
zum Einstieg in den Verteilungskampf urn soziale und materielle Giiter zu
verschaffen. In einer kritischen Besprechung des in deutscher Ubersetzung
"Chancengleichheit" genannten Buches von Christopher Jencks (1973)
nennt Hartmut von Hentig (1973) dies den von den USA und uns be
schrittenen indirekten Weg zur Uberwindung von Ungleichheit: "Man ver
such~ dafUr zu sorgen, dai.) aIle den Wettbewerb mit gleichen Vorteilen
und Nachteilen beginnen" (ebenda, Lit. 4).
Anstoi.) fUr die Forderung nach Chancengleichheit war die Beobachtung,
dai.) nicht aile Bevolkerungsteile gleiche Zugangs- und Durchhaltemoglich
keiten zu und in den Bildungsinstitutionen weiterfUhrender Art haben.
Als besonders benachteiligt haben sich Kinder aus unteren Schichten,
aus Landgemeinden, aus katholischen Familien sowie Madchen herausge
stellt (cf. Heller 1966, 326 ff.). Diese Benachteiligung nicht durch Be
gabungsmangel erklaren zu konnen, war man sich bald einig; denn selbst
wenn Erblichkeit von Begabung und Intelligenz eine bedeutsame, wenn
auch umstrittene Rolle spielt (cL die Kontroverse Arthur R. Jensen versus
Hans-Jilrgen Eysenck oder allgemeiner der Environmentalisten versus die
Nativisten), so kann dieser Faktor doch nicht annahernd die festgestellten
Unterschiede der Beschulung der verschiedenen Bevolkerungsgruppen er
klaren (ef. v. Bracken 1967, 131 f.). Der Versuch scheitert bereits, wenn
man die Intelligenz- und Leistungswerte in der letzten Klasse der Grund
schule als Kriterium fiir die Ubergangseignung in eine weiterfiihrende