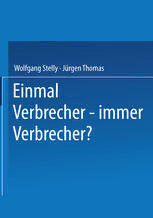Table Of ContentWolfgang Stelly · Jürgen Thomas
Einmal Verbrecher- immer Verbrecher?
Wolfgang Stelly · Jürgen Thomas
Einn1al Verbrecher -
in1n1er Verbrecher?
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek-CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich.
ISBN 978-3-531-13665-3 ISBN 978-3-322-89598-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-89598-1
1. Auflage Juli 2001
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2001
Ursprünglich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH, Wiesbaden 2001.
Lektorat: Monika Mülhausen
www. westdeutschervlg.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim
mung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun
gen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzg~bung als frei zu betrachten wären und daher von jeder
mann benutzt werden dürften.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Umschlaggestalrung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .......................................................................................................... ll
2 Verlaufsmuster von Kriminalität- Eine Bestandsaufnahme ........................ 17
2.1 Die Philadelphia-Kohortenstudie ................................................................... 22
2.2 Die schwedische Langzeitstudie von Stattin/Magnusson ............................... 26
2.3 Verlaufsstrukturen in deutschen Kohortenstudien ......................................... 33
2.4 Rückfall nach Jugendstrafvollzug .................................................................. 38
2.5 Verlaufsstrukturen selbstberichteter Delinquenz ........................................... 40
2.6 Zusammenfassung ......................................................................................... 45
3 Theorien zur Kontinuität und Diskontinuität von Kriminalität .................. 49
3.1 Klassische Theorieansätze ............................................................................. 51
3 .1.1 Die Theorie der differentiellen Assoziation .............................................. 51
3 .1.2 Die Drucktheorie ....................................................................................... 53
3.1.3 Der Labeling-Ansatz ................................................................................. 55
3.1.4 Die Theorie der Abschreckung ................................................................. 57
3 .1.5 Die soziale Kontrolltheorie ............. :. ........................................................ 6 I
3.1.6 Zusammenfassung ..................................................................................... 63
3.2 Neuere entwicklungsdynamische Theorieansätze .......................................... 66
3.2.1 Braithwaites Beschämungstheorie ............................................................ 71
3.2.2 Das Konzept der "differential expectations" ............................................. 73
3.2.3 Greenbergs "Alterstheorie" ....................................................................... 74
3.2.4 Agnews allgemeine Drucktheorie ............................................................. 75
3.2.5 Moffitts Tätertaxonomie ........................................................................... 78
3.2.6 Thornberrys Interaktionsmodell ................................................................ 83
3.2.7 Zusammenfassung ..................................................................................... 89
3.3 Die altersabhängige soziale Kontrolltheorie von Sampson/Laub .................. 93
3.3.1 Theoretische Grundannahmen .................................................................. 93
3.3.2 Die Kontinuität delinquenten Verhaltens .................................................. 97
3.3.3 Veränderungen und Brüche im delinquenten Verhalten ..... :. .................... 99
3.3.4 Die Mediatisierungsthese von Sampson/Laub ........................................ I 00
3.3.5 Die empirische Ergebnisse von Sampson/Laub ...................................... 101
3.3.6 Kritische Anmerkungen zur "altersabhängigen sozialen
Kontrolltheorie" ...................................................................................... I 03
3.4 Die allgemeine Kriminalitätstheorie von Gottfredson/Hirschi ..................... 105
3.5 Folgerungen für die eigene Untersuchung ................................................... I I 0
6 Inhaltsverzeichnis
4 Die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung ....................................... 115
4.1 Zur Anlage der Studie .................................................................................. 115
4.2 Zur Repräsentativität der TJVU .................................................................. 119
4.3 Die TJVU im Vergleich mit der Glueck-Studie "Unraveling
Delinquency" ............................................................................................... 126
5 Kriminalität und soziale Einbindung im Kindes- und Jugendalter ........... 129
5.1 Familie und Jugendkriminalität ................................................................... 130
5.1.1 Das Familienmodell von Sampson und Laub .......................................... 130
5 .1.2 Operationalisierung der Modellfaktoren ................................................. 13 2
5.1.3 Familie und schwere Jugendkriminalität... .............................................. 136
5.1.4 Familie und leichte Jugendkriminalität.. ................................................. 149
5.2 Frühe Verhaltensauffälligkeiten ................................................................... 154
5.3 Schule und Jugendkriminalität... .................................................................. 167
5.4 Delinquente Peers und Jugendkriminalität .................................................. 177
5.5 Zusammenfassung: Soziale Einbindung und Jugendkriminalität.. ............... 186
6 Kriminalität und soziale Einbindung im Erwachsenenalter ...................... 193
6.1 Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeit im V-Sample ............ 200
6.2 Verlaufsmuster im V-Sample ...................................................................... 206
6.3 Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeit im H-Sample ............ 215
6.3.1 Der Zusammenhang der Kriminalitätsentwicklung zwischen den
einzelnen Lebensphasen .......................................................................... 215
6.3.2 Die Wirkung der Kindheits- und Jugendgeschichte auf Kriminalität
und soziale AuffäHigkeiten in späteren Lebensphasen ............................ 223
6.3.3 Die Selbstverstärkung der "kriminellen Karriere" .................................. 229
6.3.4 Veränderungen und Brüche in der Kriminalitätsentwicklung ................. 240
6.4 Verlaufsmuster im H-Sample ...................................................................... 246
6.4.1 Verlaufsmuster im H-Sample bis zum 32. Lebensjahr ............................ 247
6.4.2 Verlaufsmuster im H-Sample bis zum 39. Lebensjahr. ........................... 261
6.5 Soziale Einbindung und das Ende der AuffäHigkeiten ................................ 275
6.6 Zusammenfassung ....................................................................................... 292
7 Schlussbetrachtung: Die zentralen Ergebnisse ............................................ 297
8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis .......................................................... 307
8.1 Tabellenverzeichnis ..................................................................................... 307
8.2 Abbildungsverzeichnis ................................................................................ 314
9 Literaturverzeichnis ....................................................................................... 315
10 Anhang ............................................................................................................ 329
Geleitwort
Hinter dem weiten Begriff "Kriminalität" verbergen sich zahlreiche unterschiedliche
Problemlagen, die zwar in der Wirklichkeit des Lebens alle auf die eine oder andere
Weise miteinander verknüpft sind, aber dennoch in wissenschaftlicher, praktischer
und (kriminal-) politischer Hinsicht einer separaten Analyse bedürfen, wenn man im
Grundlagenwissen weiterkommen und Anwendungswissen verbessern will. Krimina
lität als soziales Phänomen, insbesondere Massenphänomen in modernen Gesell
schaften, hat andere Gesetzmäßigkeiten denn Kriminalität als Einzelereignis im
Alltag oder Kriminalität als Teil einer lebensgeschichtlichen Verstrickung von Men
schen in eine Art Kreislauf von "Verbrechen und Strafe", die in bestimmten Fällen
als ausgeprägte so genannte "kriminelle Karriere" imponiert. Dunkelfelduntersu
chungen in der Kriminologie haben überall in der Welt in den letzten Jahrzehnten
den Befund verfestigt, dass das Begehen von Handlungen, die einem Straftatbestand
subsumiert werden können, vor allem bei den männlichen Angehörigen der Normal
population statistisch normal und sozusagen ubiquitär ist. Das heißt, im Schnitt rund
90 %junger Männer geben bei so genannten Täterbefragungen an, Straftaten began
gen zu haben. Die meisten dieser Taten werden allerdings nicht entdeckt. Und die
meisten jungen Menschen bleiben offiziell unauffällig oder kommen, selbst wenn sie
einmal polizeilich angezeigt werden, allenfalls vorübergehend "in Schwierigkeiten".
Eine genauere Analyse der Ergebnisse von Täterbefragungen im Dunkelfeld zeigt
nun regelmäßig, soweit die Daten überhaupt entsprechende Differenzierung erlau
ben, dass das Begehen von Straftaten, wenn es auch normal ist, jedenfalls nicht
gleich verteilt ist. Vereinfacht: viele Befragte geben nur eine oder maximal 3 Strafta
ten an, wenige Befragte geben viele Straftaten an. Oder anders betrachtet: die meis
ten Befragten bewegen sich nach ihren Angaben üblicherweise im Bereich der klei
nen oder allenfalls mittleren Kriminalität, nur wenige Befragte berichten von wie
derholten schwereren Taten. Dem Grunde nach bestätigen Täterbefragungen damit
einen auch international ziemlich gesicherten Befund aus der Auswertung von Hell
felddaten, insbesondere von Sondererhebungen zu polizeilichen Ermittlungsverfah
ren bzw. Kriminalstatistiken: 3-5 % einer Geburtskohorte werden im Jahresquer
schnitt verdächtig, für mehr als 30 % aller erfassten Straftaten verantwortlich zu sein.
Bei Einzeldelikten fallen die Prozentwerte je nachdem niedriger oder höher aus. Im
Längsschnitt können sich im Detail ebenfalls andere Werte ergeben. Für die wieder
holt Auffälligen haben sich Begriffe wie "Mehrfachtäter", "Intensivtäter" oder
"chronische Täter" (entsprechend den "chronics" in den USA) eingebürgert. Solche
Befunde sind natürlich geeignet, klassische Fragestellungen der täterorientierten
Kriminologie und Kriminalpolitik wieder zu aktivieren. Dazu gehört die Frage, ob
die mehrfach Auffälligen etwa bestimmte "Eigenschaften" haben oder zeigen könn
ten, die sie in der Substanz von anderen Menschen bzw. nur einmal oder gelegentlich
Straffälligen abheben oder, noch brisanter, anhand derer man sie sozusagen von
8 Geleitwort
Amts wegen (oder mit Hilfe von Gutachtern) unterscheiden und einer wie auch
immer gestalteten besonderen Behandlung zuführen kann. Der vor allem in den 70er
Jahren blühende Labeling Approach (Etikettierungsansatz) war angetreten, die Frage
nach "Unterschieden", gar statischen und in der Persönlichkeit eingebundenen
Merkmalen, schon im Ansatz für sinnlos zu erklären. Wo es um "Zuschreibung"
durch gesellschaftliche und dann institutionelle Definitionsprozesse geht, verfehlt
danach jeder Versuch einer "Beschreibung" von vorgeblich real vorhandenen Phä
nomenen und der Analyse von ggf. vorhandenen kausalen Zusammenhängen den
wissenschaftlichen Punkt, auf den es ankommt. In den USA hatten Michael Gottfred
son und Travis Hirschi mit ihrem Werk über eine "General Theory of Crime" ( 1990)
den in jüngeren Jahren am meisten Aufmerksamkeit erregenden Versuch gestartet,
eine an der Persönlichkeit ausgerichtete umfassende Kriminalitätstheorie zu entwi
ckeln und damit sozusagen dem Labeling Ansatz den kriminologischen und krimi
nalpolitischen Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit ihrem Konzept der "criminali
ty", einer früh in der Persönlichkeit angelegten und im Kern nicht veränderbaren
Neigung zu abweichendem Verhalten, die sich in einzelnen "crimes", aber auch in
anderen Abweichungen manifestieren kann und faktisch manifestiert, und die sie
letztlich auf den Faktor mangelnder Selbstkontrolle zurückführen, starteten sie indes
nicht nur einen Angriff auf etikettierungstheoretische Positionen, sondern auch auf
alle diejenigen kausal orientierten Positionen in der Kriminologie, die Wandel oder
"Veränderung" für möglich halten. Dazu gehören insbesondere Längsschnitt- oder
Verlaufsuntersuchungen, die davon ausgehen, dass durchaus vorfindbare "Unter
schiede" zwischen Menschenträtern besser als Folge von dynamischen divergieren
den lebensgeschichtlichen Entwicklungsverläufen denn als Ausfluss von statischen
Eigenschaften verstanden werden können und sollten. Dementsprechend gehen sie
weiter davon aus, dass auch bei scheinbar hartnäckig verfestigten kriminellen Karrie
ren, die sich schon in früher Jugend entwickeln, prinzipiell jederzeit Veränderungen
und sogar Abbrüche möglich sind. Umgekehrt ist es danach prinzipiell auch jederzeit
möglich, dass ein bis dato ganz unauffälliger Mensch erst im Erwachsenenalter mit
erheblicher Straffälligkeit imponiert. Am einflussreichsten waren in dieser Hinsicht,
zugleich am pointiertesten in der Gegenposition zu Gottfredson/Hirschi, in den USA
Robert Sampson und John Laub mit ihrem Werk über "Crime in the Making" (1993).
Anhand einer imponierenden neuen Aufbereitung der Daten, die Sheldon und Elea
nor Glueck für ihre (selbst eher statisch orientierte) Verlaufs- und Vergleichsstudie
über die Ursachen erheblicher Jugendkriminalität und deren weiteren Verlauf (Un
raveling Juvenile Delinquency, 1950) erhoben hatten, entwickelten sie mit ihrer
"age graded theory of social control" eine besonders anregende Variante interaktio
nistischer Kriminalitätstheorien. Danach gibt es nicht nur sehr differenzierte Wege
des Einstiegs und des Verweilens in Kriminalität ("pathways"), sondern im einzelnen
ebenfalls sehr differenzierte, aber grundsätzlich doch typische Wendemarken ("tur
ning points") heraus aus der Kriminalität, die mit wichtigen lebensgeschichtlichen
Ereignissen oder Entscheidungen verknüpft sind.
Die Autoren des vorliegenden Werkes steigen aus deutscher Sicht in die durch
Gottfredson/Hirschi und Sampson/Laub exemplarisch markierte neuere Diskussion
Geleitwort 9
über Bedingungen und Zusammenhänge von "Kontinuität und Diskontinuität von
Kriminalität im Lebenslauf' anhand einer Reanalyse der Ergebnisse der "Tübinger
Jungtäter- Vergleichsuntersuchung" (begründet durch und geleitet von Hans Göp
pinger) einschließlich der späteren Nachuntersuchung (geleitet von Hans-Jürgen
Kerner) ein. Sie vertiefen damit zugleich Einsichten, die am Institut für Kriminologie
durch ein entsprechendes von der DFG gefördertes Projekt über "Verlaufsmuster
und Wendepunkte in der Lebensgeschichte" gewonnen werden konnten. Da die Tü
binger Untersuchung international zu den wenigen gehört, die ihre Probanden über
das 30. Lebensjahr hinaus begleitet und untersucht haben, beansprucht die empiri
sche Studie von Wolfgang Stelly und Jürgen Thomas besondere Aufmerksamkeit.
Anhand von zwei aufeinander bezogenen Perspektiven, nämlich "Kriminalität und
soziale Einbindung im Kindes- und Jugendalter" einerseits und "Kriminalität und
soziale Einbindung im Erwachsenenalter" andererseits, arbeiten sie eindrücklich
heraus, dass diejenigen Kriminologen, die es theoretisch sozusagen mit Sampson und
Laub halten, empirisch die besseren Argumente für sich haben. Bei der repräsentati
ven Vergleichsgruppe der Tübinger Probanden beschränkt sich der weitaus größte
Teil der registrierten Kriminalität auf einmalige oder im Wiederholungsfall doch
eher leichte Delikte in der Jugend- und Heranwachsendenphase. Dieses Erschei
nungsbild ist weder mit einer problematischen Sozialisation erklärbar, noch findet
sie ihre Entsprechung in einer in sonstigen Bereichen auffälligen Lebensführung, und
hat schließlich keine größeren Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg der Indi
viduen. Bei der Gruppe der Häftlingsprobanden ist es naturgemäß zunächst nicht
verwunderlich zu sehen, dass sich bei der Mehrzahl von ihnen die eher schwereren
strafrechtlichen Auffälligkeiten auch in anderen Verhaltensauffälligkeiten und einer
insgesamt sozial depravierten Lebenssituation widerspiegeln. Der für die weitere
kriminologische Diskussion herausfordernde Befund ist freilich, dass die um das 25.
Lebensjahr der Probanden herum ziemlich ähnliche Situation einerseits auf höchst
unterschiedlichen Vorgeschichten beruht, und dass auch ab dann die weitere Le
bensgeschichte weniger von gleichförmiger Kontinuität (in) der Straffälligkeit denn
von Brüchen und Veränderungen gekennzeichnet ist. Für das Auslaufen oder sogar
den raschen Abbruch scheinbar verfestigter krimineller Karrieren sind weniger Fak
toren aus der frühen Kindheits- und Jugendgeschichte verantwortlich als vielmehr
die jeweils aktuellen Einbindungen der Probanden in die informellen Bereiche der
sozialen Kontrolle wie Freundschaftsbeziehungen, Partnerschaft, Familie und Ar
beitswelt. Einem Großteil der Häftlingsprobanden gelingt es auf diese Weise, sich
wider alle Belastungsfolgen aus dem bisherigen Leben in eine sozial unauffällige
Lebensweise erfolgreich zu integrieren. Durch die vorliegende quantitativ angelegte
Studie ist ein solider Grund für weitergehende und vertiefende, vor allem qualitative
Analysen zum Thema "Kriminalität und Verlauf' und zum Thema "Sanktion und
Lebensgeschichte" gelegt. Ich wünsche ihr weite Verbreitung.
Tübingen, im April 2001 Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner
Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen
1 Einleitung
Diese Arbeit handelt von individuellen Entwicklungsmustern von Kriminalität im
Lebenslauf. Wir fragen danach, welche unterschiedlichen Kriminalitätsverläufe sich
in einer Langzeitperspektive identifizieren lassen und wie die unterschiedlichen
Verlaufsmuster erklärt werden können. Dies schließt auch die Frage mit ein, welche
Faktoren hinter dem Beginn, dem Fortgang und dem Ende krimineller Karrieren
stehen.
Der Begriff "kriminelle Karriere" meint dabei lediglich, dass die Verstrickung in
kriminelle Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben beginnt, sich über
eine bestimmte Zeitdauer erstreckt, und dann aufhört. Dabei kann es sich sowohl um
eine einmalige oder episodenhafte strafrechtliche Auffälligkeit handeln, die ohne
lebensgeschichtliche und strafrechtliche Konsequenzen bleibt, als auch um wieder
holte strafrechtliche Auffälligkeiten, die sich über verschiedene Lebensphasen er
strecken und mit längeren Haftaufenthalten einhergehen. Für beide Verlaufsformen
gibt es zahlreiche empirische Evidenzen: so wurde einerseits in verschiedenen Lang
zeitstudien festgestellt, dass Individuen, die als Kinder und Jugendliche kriminelles
Verhalten zeigten, sehr viel häufiger auch als Heranwachsende und junge Erwachsene
strafrechtlich auffällig wurden (z.B. Parrington 1992, McCord 1991, Elliott et al.
1985). Loeber (1996, S.1) spricht in seinem Literaturüberblick über Entwicklungsver
läufe von Kriminalität zusammenfassend von einem "impressive body of longitudinal
data on the continuity of problern behaviors over time." Andererseits belegen viele der
bekannten Langzeitstudien aber auch, dass die große Mehrheit der jugendlichen Straf
täter ihre "Karriere" vor oder während der frühen Erwachsenenphase abbricht (z. B.
Stattin/Magnusson 1991, Shannon 1988).
Nicht zuletzt aufgrund dieser scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse besteht in
der kriminologischen Forschung Uneinigkeit darüber, ob es sich bei kriminellem
Verhalten eher um ein über den Zeitverlauf stabiles Verhaltensmuster oder um ein
passageres, auf einen relativ engen Zeitraum begrenztes Phänomen handelt. Dies ist
umso bedenklicher, als mit der Klärung dieser Frage weitreichende Konsequenzen
für die Kriminalpraxis verbunden sind. Zum einen sind Richter, psychiatrische und
psychologische Sachverständige durch gesetzliche Vorgaben gehalten teilweise
langfristige Prognosen über die weitere Entwicklung von Straftätern abzugeben. Zum
anderen können damit verschiedene kriminalpolitische Strategien begründet werden.
Die Diskussion um die Verschärfung des Strafrechts und die tatsächlich eingetretene
Verschärfung (Kreß 1998) sind nicht zuletzt aufgrund eines diffusen allgemeinen
Eindrucks in der Öffentlichkeit entstanden, den man trotzJahrzehntender Resoziali
sierungsidee immer noch auf die Formel ,Einmal Verbrecher immer Verbrecher'
bringen kann. Besonders jugendliche Mehrfachtäter, die in der kriminologischen
Fachdiskussion mit Begrifflichkeiten wie "chronische Lebenslauf-Täter" (Schneider
2000) oder "life-course persistent antisocials" (Moffitt 1993) bedacht werden, stehen
immer wieder im Mittelpunkt der kriminalpolitischen Diskussionen. Sollten sich