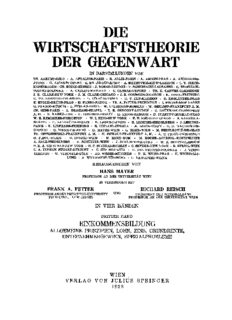Table Of ContentDIE
WIRTSCHAFTSTHEORIE
DER GEGENWART
IN DARSTELLUNGEN VON
TH. AARUMt-oSLO • A. AFTALION-PARIS • E.ALLIX-PARIS • A. AMONN-PRAG • A. ANDREADEs
ATHEN • G. ARlAS-FLORENZ,. K. BALAs-BUDAPEST. A. BILIMOVICZ.KIEW-LAIBACH • L. V. BmOK
KOPENHAGEN • CH. BODIN-RENNES • J. BONAR-LONDON· P. BONINSEGNI-LAUSANNE • C. BRESCIANI
TURONI-BOLOGNA • A. CABIATI-MAILAND • E. CANNAN-oXFORD • TH. N. CARVER-CAMBRIDGE
J. B. CLARK-NEW YORK • J. M. CLARK-cmCAGO • J. R. COMMONS-MADISON· K. DIEHL-FREIBURG
K. TH. EHEBERG-ERLANGEN • L. ElNAUDI-TUR1N • R. T. ELY-MADISON • O. ENGLANDER-PRAG
K. ENGLIS-BRtl'NN-PRAG • M. FANNo-PADUA • FR. A. FETTER-PRINCETON. L FISHER-NEW HAVEN
G. FRANCO-MURCIA· L. FURLAN-BASEL· W. GELESNOFF-MOSKAU • W. GERLOFF-FRANKFURT A. M.
CH. GIDE-PARIS • A. GRAZIANI-NEAPEL • T. E. GREGORY-LONDON. C. GRONBERG-FRANKFURT
A. M. • B. HARMs-KIEL • H. HERKNER-BERLIN • H. mGGS-BANGOR • D. lVANCOV-MOSKAU-PRAG
W. E. KEMMERER-PRINCETON • W. I. KING-NEW YORK • F. H. KNIGHT-cmCAGO • A. LABRIOLA
NEAPEL • C. LANDAUER-BERLIN· E. LASKlNE-PARlS • E. LEDERER-HEIDELBERG· J. LESCURE
PARIS· R. LIEFMANN-FREIBURG • E. LINDAHL-UPSALA· A. LORIA-TURIN. D. H. MACGREGOR
OXFORD • G. MASCI-PALERMO • H. MAYER-WIEN • L. MISES-WIEN • M. NEDELKOVIC-BELGRAD
FR. OPPENHEIMER-FRANKFURT A. M. • H. OSWALT-FRANKFURT A. M. • A. C. PIGOU-CAMBRIDGE
G. pmOU-PARlS • R. RElSCH-WIEN • U. RICCI-ROM • M. ROCHE-AGUSSOL-MONTPELLIER
A. SALZ-HEIDELBERG • R. SCHtl'LLER-WIEN • J. SCHUMPETER-BONN • W. R. SCOTT-GLASGOW
E. R. A. SELIGMAN-NEW YORK· G. F. SHmRA8-BOMBAY· C. SNYDER-NEW YORK· R. STRIGL-WIEN
C. A. VERRIJN STUART-UTRECHT • C. SUPINo-PAVIA • G. DEL VECcmO-BOLOGNA • J. VINER
CmCAGO • W. VLEUGELS-KOLN • AD. WEBER-Mtl'NCHEN • F. X. WEISS-PRAG • K. WICKSELLt-
LUND • R. WILBRANDT-Ttl'BINGEN • L. ZAWADZKl-WILNA
HERAUSGEGEBENVON
HANS MAYER
PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT WIEN
IN VERBlNDUNG MIT
FRANK A. FETTER RICHARD REISCH
PROFESSOR ANDER PRINCETON-UNIVERSITY UND PRAsmENT DER NATIONALBANK
PRINCETON, NEW JERSEY PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT WIEN
IN VIER B.ANDEN
DRITTER BAND
EINKOMMENSBILDUNG
ALLGEMEINE PRINZIPIEN, LOHN, ZINS, GRUNDRENTE,
UNTERNEHMERGEWINN, SPEZIALPROBLEME
WIEN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1928
EINKOMMENSBILDUNG
ALLGEMEINE PRINZIPIEN, LOHN, ZINS, GRUND
RENTE,
UNTERNEHMERGE~NN,
SPEZIALPROBLEME
DARGESTELLT VON
ALFRED AMONN . LAURITS V. BIRCK . JAMES BONAR . THOMAS
N. CARVER· JOHN B. CLARK . JOHN R. COMMONS . RICHARD T. ELY
IRVING FISHER· CHARLES GIDE . HEINRICH HERKNER . WILLFORD
1. KING . CARL LANDAUER· D. H. MACGREGOR· HENRY OSWALT
ARTHUR C. PIGOU . UMBERTO RICCI . ARTHUR SALZ . CAMILLO
SUPINO . GUSTAVO DEL VECCHIO . ADOLF WEBER . FRANZ X.
WEISS • KNUT WICKSELL
WIEN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1928
ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAB DER "OBERSETZUNG
IN FREMDE SPRACHEN. VORBEHALTEN
COPYRIGHT 1928 BY JULIUS SPRINGER IN VIENNA
SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 1ST EDITION 1928
ISBN 978-3-7091-5879-1 ISBN 978-3-7091-5929-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-7091-5929-3
Inhaltsverzeicbnis
Seite
Allgemeine Prinzipien
Tbeorie der Verteilung; Von Dr. CARL LANDAUER-Berlin.................... 1
Der Einkommensbegriff im Lichte der Erfahrung. Von Professor IRVING FIsHER-
New Haven ..•..........................•. " • . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • .. 22
Vo1kswirtschaftlicher und privatwirtschaftJicher Reinertrag und die Lehre von
der Maximalbefriedigung. Von Professor ARTHUR C. PIGou-Cambridge •.•..• 46
Lohn
Grundsiitze einer Tbeorie vom Arbeitslohn. Von Professor ARTHUR SALZ-Heidelberg 49
Die Lohntheorien der deutschen Arbeiter- und Arbeitgeberverbiinde seit der
Stabilisierung der Valuta. Von Professor HEINRICH HERKNER-Berlin ....... 85
Die Lohntheorie. Von Professor CHARLES GIDE-Paris ...........•........... 98
Die Arbeit in der Individualwirtschaft. Von Professor UlIIBERTO RIccI-Rom •... 113
Zins
Tbeorie des Kapitalzinses. Von Dr. HENRY OswALT-Frankfurt a. M. .......... 132
Die Tbeorie des Zinses. Von Professor THOMAS N. CARVER-Cambridge (U.S.A.) 151
Der Diskont als geldtheoretisches Problem. Von Professor CAMILLO SupINo-Pavia 168
Rea1kapital contra PrivatkapitaI. Von Professor LAURITS V. BmcK-Kopenhagen 181
Zur Zinstheorie(B6hm-BawerksDritterGrund). Von Professor KNUTWICKSELL t-Lund 199
Grundrente
Die Grundrente im System der Nutzwertlehre. Von Professor FRANz X. WEIss-Prag 210
Die stlldtische Grundrente. Von Professor ADOLF WEBER-Miinchen .........•. 235
Kosten und Einkommen bei der Bodenverwertung. Von Professor RICHARD T. ELY-
Chicago ............................................................. 242
Unternehmergewinn
Der Untemehmergewinn. Von Professor ALFRED bONN -Prag ................ 259
Bemerkungen zur Theorie des Profits. Von Professor D. H. MAcGREGOR-Oxford 271
Untersuchungen zur Tbeorie des Untemehmergewinnes. Von Professor GUSTAVO
DEL VECCHIo-Bologna. ................................................ 281
Spezialprobleme
DasR~~=:~w:~!!~c~t. ~~. ~~ ~~~~~~~~~~: .~~~ .~~~~~~~~. ~~~.
293
Das Einkommen der Vereinigten Staaten und der zu seiner Berechnung ver-
wendbare Einkommensbegriff. Von WILLFORD I. KING-New york .......... 318
Die Grenzen der Macht. Von Professor JAMES BONAR-London ................ 325
Ein altes Prinzip in neuer Zeit. Von Professor JOHN BATES CLARK-New York .. 328
Theorie der Verteilung
Von
Dr. Carl Landauer, Berlin
DaB die okonomische Theorie iiber die Einkommensbildung etwas aus
sagen kann, ist viel weniger selbstverstandlich als ihre Aufgabe und Leistungsfahig
keit bei Erklarung des menschlichen Handelns auf dem Gebiete der Produktion.
Eine Theorie kann nur dort etwas leisten, wo das Geschehen sich nach erkenn
baren Regeln richtet. 1m Bereiche der Produktion herrschen offensichtlich
bestimmte Regeln der Rationalitat. Werden sie nicht befolgt, so ist der Pro
duktionsertrag geringer, als er sein konnte. Wollen die Menschen ihre Bediirfnisse
moglichst reichlich befriedigen, so sind sie genotigt, sich an diese Regeln zu
halten. Das gilt nicht etwa nur fiir die technischen MaBnahmen, sondern ebenso
fiir die wirtschaftlichen Uberlegungen und Handlungen, fUr die Disposition
iiber die relativ seltenen Produktivkrafte und -mittel. Nun liegt die Annahme
nahe, daB der Bereich des Zwangslaufigen verlassen wird, wenn die Giiter aus
Mitteln und Realertragen der Produktion zu Einkommen der einzelnen Menschen
werden. Wieviel von den Erzeugnissen der Produktion das eine und wieviel
das andere Mitglied der Gesellschaft erhalt, scheint auf den ersten Blick der
willkiirlichen Entscheidung durch die Gesellschaftsverfassung oder die von ihr
berufenen Organe anheimgegeben zu sein. Wohl wird bei der bestehenden Form
der Gesellschaftswirtschaft die Einkommensbildung nicht unmittelbar durch
Eingriffe des Staates oder anderer gesellschaftlicher Organisationen geregelt,
sie ergibt sich vielmehr im ganzen aus dem Ablauf der verkehrswirtschaftlichen
Vorgange. Trotzdem aber ist die Vorstellung moglich, daB diese Art der Ein
kommensverteilung nur deshalb bestehe, weil gerade ihr Ergebnis von jenen
gesellschaftlichen Machten, denen die Entscheidung obliegt, als gerecht gewollt
werde, und daB diese Machte nach ihrem Belieben Abanderungen bewirken
konnten, wenn ein solcher Wunsch bei ihnen entstiinde. Diese Vorstellung muB
auch nicht notwendig iiberwunden werden durch die haufige Erfahrung, daB
Eingriffe in die Einkommensbildung im Einzelfall oft mit groBen Schwierigkeiten
verbunden sind und zu Ergebnissen fUhren, die ihr Urheber gar nicht wiinscht.
Damit ist die Erkenntnis einer umfassenden GesetzmaBigkeit der Einkommens
bildung noch nicht gegeben. Und so ging zeitweise die groBe Mehrzahl der
Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspolitiker von der stillschweigenden
oder ausdriicklichen Annahme aus, daB es in der Macht der Gesellschaft liege,
sogar ohne umwalzende Anderung der Produktionsorganisation die Verteilung
anders einzurichten. Daraus leitete man die Forderung ab, daB auf der Grund
lage der bestehenden Gesellschaftsordnung deren "AuswUchse" - nach ethischen
MaBstaben beurteilt - beseitigt werden sollten. Man erkannte wohl im einzelnen
Hindernisse dieser Reformbestrebungen, aber man fiigte die Einzelerkenntnisse
nicht zusammen zur grundsatzlichen Erkenntnis einer allgemeinen Grenze der
Wirksamkeit von Eingriffen. Dieser Erkenntnis waren die Klassiker und ihre
unmittelbaren Nachfolger bereits nahe gewesen; unter der Herrschaft der
historisch-ethischen Schule ging das Erreichte wieder verloren.
Mayer, Wirtschaftstheorie III 1
2 C. LANDAUER
Die Meinung, daB die Einkommensverteilung Sache willkiirlicher Gestaltung
sei, ist keineswegs durchaus faJsch. Sie ist nur faJsch fiir die Wirtschaftsform,
die wir heute besitzen, fiir die Verkehrswirtschaft. Nur in der Verkehrswirtschaft
sind Einkommen zwangslaufig bedingt, nur fiir die Verkehrswirtschaft gibt es
"Gesetze" der Einkommensbildung, die erforscht werden konnen, und deshalb
eine Einkommenstheorie.
Der Verkehrswirtschaft ist eigentiimlich, daB in ihr die
Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Befriedigung der
menschlichen Bediirfnisse zur QueUe von Einkommen wird. Bei
gegebenen Bediirfnissen der Wirtschaftspersonen und gegebenen Produktions
moglichkeiten bringt nur eine bestimmte GroBe jedes einzelnen Einkommens die
Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Erzielung eines groBtmoglichen
Ertrages richtig zum Ausdruck. Verandert man die Aussicht, durch Anbieten
bestimmter Giiter oder Leistungen Einkommen zu erzielen, so wird das wirt
schaftliche Handeln in falsche Richtung gelenkt; das Handeln der Wirtschafts
personen entspricht dann nicht der Bedeutung, die den anzubietenden Giitern
im Verhaltnis zu anderen fiir die Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse
zukommt. So erfiillt jedes Einkommen in der Verkehrswirtschaft auBer dem
personlichen Zwecke fiir seinen Bezieher noch den gesellschaftlichen Zweck,
das Handeln in bestimmte, den Forderungen der Rationalitat entsprechende
Bahnen zu lenken.
Soweit verkehrswirtschaftliche Einrichtungen bestehen, fiihren willkiirliche
Eingriffe in die Einkommensbildung dazu, das wirtschaftliche Handeln aus der
Richtung auf den groBtmoglichen Ertrag abzulenken. Dem stellen sich aber
Widerstande entgegen. Wenn das Handeln einer Person nicht so enolgt, wie es
fiir den Gesamtertrag der Volkswirtschaft am giinstigsten ist, so werden stets
Interessen verletzt, denn irgendwo muB sich das Minus an Wirtschaftsertrag
ja zeigen. Manchmal tragt jene Wirtschaftsperson, deren Handeln aus der
Bahn des wirtschaftlich ZweckmaBigen abgelenkt ist, in erster Linie den Schaden;
manchmal tragen ihn zunachst andere. Stets aber sucht ihn der zunachst
Betroffene nach Moglichkeit von sich abzuwalzen, indem er sein Handeln der
veranderten Gesamtsituation anpaBt. Dadurch wird die Ertragsminderung
an vielen Stellen des WirtschaftskOrpers fiihlbar. Nun ist bei "willkiirlichen"
Eingriffen in die Einkommensverteilung stets die Absicht maBgebend, bestimmten
Gruppen von Wirtschaftspersonen Vorteile zu verschaffen. Die indirekten
Folgen der Ertragsminderung zeigen sich aber sehr haufig gerade an dem Ein
kommen dieser zunachst bevorzugten Personen und machen damit den Eingriff
erfolglos. Die Versuche, den Anteil bestimmter Einkommensarten am Sozial
produkt zwangsweise zu erhohen, setzen in wichtigen Fallen eine Verteuerung
des Produktionsfaktors (oder Teilfaktors) voraus, auf dem dieses Einkommen
beruht. Der Wirtschaftsverkehr aber hat die Tendenz, den wenigst belasteten
Weg zu suchen. Die Wirtschaftspersonen streben darnach, ihr eigenes Handeln
der Verteuerung anzupassen, indem sie die Inanspruchnahme des verteuerten
Faktors einschranken oder vermeiden. Damit verringern sie ihren eigenen
Anteil an dem Minderertrag der Produktion und walzen ihn auf jene Wirtschafts
personen ab, die durch den Eingriff begiinstigt werden sollten. Sobald diese
Wirkung hervortritt, ist fiir den Urheber des Eingriffes ein Beweggrund gegeben,
seine MaBnahme rUckgangig zu machen. In der Wirkungsweise umgekehrt,
im Ergebnis gleichartig liegt der Fall, wenn ein Kreis von Wirtschaftspersonen
dadurch begiinstigt werden solI, daB die von ihm zu verbrauchenden Giiter
auf Kosten der an ihrer Produktion beteiligten Gruppen verbilligt werden. Die
Einkommensverteilung der Verkehrswirtschaft weist daher eine Widerstands-
Theorie der Verteilung 3
fahigkeit gegen Eingriffe von auBen am, keine absolute Widerstandsfahigkeit
allerdings, wohl aber eine relative. Wenn wir also jene Regeln uber die
Einkommensverteilung amstellen, die sich aus der Bedeutung jedes Einkommens
fiir die Erzielung eines groBtmoglichen Gesamtertrages der Wirtschaft ergeben,
dann werden zwar diese Regeln nicht die Grundzuge der Einkommensbildung
fiir jedes Stadium der realen Wirtschaftsentwicklung schildern, sie werden aber
den Zustand erkennen lassen, zu dem die Einkommensverteilung der Verkehrs
wirtschaft in jedem Augenblick tendiert. Die Theorie kann demnach fiir die
Erklarung der Einkommensbildung wenigstens im Bereiche der Verkehrswirtschaft
ganz dasselbe leisten wie fiir die Erklarung aller anderen Wirtschaftsvorgange.
Die relative Widerstandsfahigkeit der Einkommensverteilung in der
Verkehrswirtschaft muB an einigen Beispielen erHi,utert werden1). Das einfachste
Beispiel fiir einen Eingri£f von auBen her in die Einkommensverteilung der Ver
kehrswirtschaft ist die Festsetzung von Hoc hs t pr eis en. Durch Hochstpreise wird
versucht, die (Real-)E inkommen der Konsumenten von Waren, vor allem der
Lohn-und Gehaltsempfanger, auf Kosten des Einkommens der Warenproduzenten
zu steigern. Den Produzenten solI es unmoglich gemacht werden, die (vielleicht
durch besondere Verhaltnisse gesteigerte) Bedeutung der von ihnen hergestellten
Guter zur Erzielung eines entsprechenden Einkommens voll auszunutzen. Also
miissen Preise festgesetzt werden, die hinter der Bedeutung der Giiter zuriick
bleiben. Die Verkamer passen sich dieser Verschiebung durch Verminderung
des Angebotes der betreffenden Ware an, indem sie die Produktion auf die
Ausnutzung der giinstigsten Erzeugungsmoglichkeiten einschranken. Bei land
wirtschaftlicher Produktion geschieht dies durch einen geringeren Intensitatsgrad
des Betriebes, unter Umstanden Brachliegenlassen schlechterer Boden, im Berg
bau durch Stillegung aller tiefliegenden oder weniger ergiebigen Gruben, in der
Industrie vor allemdurchLohndruck und die sichdaraus ergebendeBeschaftigungs
beschrankung auf die anspruchslosesten Arbeiter, wahrend jene mit hoheren
Lohnanspriichen in andere Produktionszweige (oder Lander) abwandern. Das
verringerte Angebot bewirkt nun, daB die Konsumenten, zu deren Schutz die
ganze MaBnahme gedacht war, ihre Bediirfnisse nicht mehr voll decken konnen.
Sie fiihlen deshalb ihre Interessen verletzt und gewohnlich iiberzeugt sich
dann die offentliche Gewalt, daB ihr Streben, an den Beweggriinden gemessen,
nicht erfoIgreich war, und macht die ganze MaBnahme riickgangig.
Ein weiterer nicht seltener Fall staatlichen Eingriffes in die Einkommens
verteilung ist der Versuch der Lohnregulierung. Sollen die Lohne "kiinstlich"
am Steigen verhindert werden, so handelt es sich um eine Analogie zur Politik
der Warenhochstpreise, und wenn auch die Eigentiimlichkeit der Arbeitskraft
als Gegenstand des Tauschverkehrs im einzelnen Abweichungen schafft, so
sind doch grundsatzlich fiir die Beurteilung der Hochstlohne die gleichen Gesichts
punkte maBgebend wie fUr die Beurteilung der Hochstpreispolitik. Aber haufig
werden nicht Hochstlohne, sondern Mindestlohne angestrebt. Man will den
Arbeitern helfen, zu einem hoheren Lohn zu gelangen, als jener ist, den sie ohne
staatliche Beihilfe erreichen wiirden.
Dabei ist nun wohl zu unterscheiden: Zuweilen handelt es sich durchaus
nicht um eine Festsetzung, die der Absicht nach mit der relativen Bedeutung
der Arbeitskraft fiir den ProduktionsprozeB in Widerspruch steht. Vielmehr
ist oft nur der Wunsch maBgebend, die Erreichung gerade dieses Lohnes zu
1) Vgl. hiezu BOHM-BAWERK: Macht oder okonomisches Gesetz~ (Zeitschr.
f. Volksw., Sozialpol. u. Verw., Bd.26), und SCHUMPETER: Das Grundprinzip der
Verteilungstheorie (Arch. f. Sozialw., Bd. 42).
1*
c.
4 LANDAUER
siohern. Das Eingreifen des Staates wird entweder nur deshalb fUr erwiinsoht
gehalten, weil man glaubt, daB wegen der Unerfahrenheit der Arbeiter die
Interessenwahrung nioht auf beiden Seiten in gleioher Weise erfolge, oder weil
man fUrohtet, daB sioh der "natUrliche" Lohn erst nach produktionsschadlichen
Kampfen einstellen werde. .AIle Lohnfestsetzungen dieser Art konnen hier
auBer Betrooht bleiben. Dagegen rufen gesetzliche Minima.llOhne, die das Lohn
niveau iiber die funktionelle Bedeutung der einzelnen Arbeitskraft hinaus erhohen,
notwendig Reaktionsersoheinungen hervor, mit der Tendenz, den Vorteil fUr
die Lohnempfanger wieder aufzuheben. Die einfaohste Form dieser Reaktions
erscheinungen besteht darin, daB die Arbeitgeber sich der Soohlage duroh Arbeiter
entlassungen anzupassen suohen. Damit werden zunaohst die Interessen der
zur Entlassung kommenden Arbeiter - und zwar sehr schwer - geschadigt.
Die arbeitslos Gewordenen suchen nun ihre in Arbeit verbliebenen Kollegen
zu unterbieten, um selbst Arbeit zu erlangen. Die Unterbietung stoBt aber auf
den Widerstand des gesetzlichen Lohnminimums. Sie werden also versuchen,
diese Schranke zu beseitigen. Dabei kommt ihnen der Umstand zu Hille, da.B
der Anpassungsvorgang auch die Interessen der in Arbeit Verbliebenen geschadigt
hat. Denn die Arbeiterentlassung bedeutet Produktionseinschrankung, diese
aber bedeutet Steigen der Warenpreise, also Geldwertsenkung, teilweise Ent
wertung des gestiegenen Nominallohnes. Ein solcher Zustand, bei dem die
einen sohwer geschiidigt sind und die anderen des urspriinglichen Vorteils bald
wieder ganz oder zum groBen Teile beraubt werden, ist nicht haltbar.
Sowohl im Falle der Rochstpreise wie im Falle der Mindestlohne gibt es
noch andere Reaktionserscheinungen. Von diesen solI hier nur noch eine allgemein
wichtige Gruppe herausgegriffen werden: Reaktionen auf Eingriffe in die Z ins
bildung. Jede Anderung der Warenpreise und jede Anderung der Lohne wirkt
irgendwie auch auf den Zins. Daneben hat es nicht an Versuchen gefehlt, den
Zins unmittelbar durch staatliche MaBnahmen zu regulieren.
Der Zins hat, wie alle anderen Preiserscheinungen, eine bestimmte Regulie
rungsaufgabe zu erfiillen. Er sorgt fUr die Verleilung der soohlichen und person
lichen Produktionsmittel auf das Wirken fUr den Gegenwartsbedarf und das
Wirken fUr den Zukunftsbedarf. Steigt der Zins, so hat dies zur Folge, daB die
Versorgung der Gegenwart auf Kosten der Versorgung der Zukunft ausgedehnt
wird; sinkt der Zins, so wird umgekehrt die Gegenwartsversorgung eingeschrankt,
um eine starkere Versorgung der Zukunft zu ermoglichen. Der Weg dieser
Regulierung ist folgender: Je hoher der Zins, um so weniger kann auf den letzten
Ertrag der Produktion gewartet werden, um so weniger wird daher eine Aus
dehnung des Produktionsapparates privatwirtschaftlich moglich, die ja ihren
Ertrag erst in der Zukunft liefert. In solcher Ausdehnung des Produktions
apparates aber auBert sich volkswirtschaftlich die Vorsorge fUr die Zukunft,
die Ermoglichung eines kiinftigen hoheren Giiterverbrauches.
Der Regulator Zins muB sich also normalerweise so bewegen, wie die Ab
wagung der Gegenwarts- gegen die Zukunftsbediirfnisse dies verlangt. 1m
allgemeinen kann - nicht nur privatwirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaft
lich - durch Investition von Produktionsmitteln in den WirtschaftsprozeB
um so mehr gewonnen werden, auf je langere Zeit diese Investition erfolgt. Aber
das Mehr in der Zukunft rechtfertigt nicht jede EntbloBung der Gegenwart.
Man kann sich wohl heute Entbehrungen auferlegen, um in einigen Jahren
desto besser versorgt zu sein. Kein wirtschaftlich richtiges Randeln aber ware
es, wenn man um des groBten Wohlfahrtsgewinnes in der Zukunft willen in
der Gegenwart sich des absolut Notwendigen berauben wollte. Der Zins reguliert
die Minderbewertung der Zukunftsgiiter, die notwendig ist, wenn nicht das
Theorie der Verteilung 5
Ergebnis der Wirtschaftsrechnung zu· einer absoluten Unterversorgung der
Gegenwart fiihren soIl.
W:illkUrliche Beeinflussung des Zinses zur Erzeugung einer bestimmten
Einkommensverteilung bedeutet, daB ein Regulator, der nach dem inneren
Ausgleichsbediir£nis des wirtschaftlichen Mechanismus sich bewegen miiBte,
statt dessen von auBen her nach MaBgabe von Absichten bewegt wird, die mit
jenem Ausgleichsbediirfnis nichts zu tun haben. Die Folge ist, daB der Regulator
seine Aufgabe nicht mehr erfiillt. Die Verteilung der Produktionsmittel und
-krafte vollzieht sich nicht mehr im Sinne der optimalen Wirtschaftsfiihrung.
Daraus ergibt sich eine Beeintrachtigung der Lebenshaltung, besonders auch
fUr jene, die durch den Eingriff begiinstigt werden soIlten. Das kann nicht ohne
EinfluB bleiben auf die Entschliisse der Machttrager, von denen die Einwirkung
auf den Zins ausgegangen ist.
Die Reaktionserscheinungen, die durch w:illkUrliche Beeinflussung des
Zinses hervorgerufen werden, erhohen - auf die Dauer gesehen - in auBer
ordentlichem MaBe die Widerstandsfahigkeit der Einkommensverteilung, die
auf der Bedeutung der Giiter und Leistungen fiir die Bedarfsdeckung beruht.
Wie schon angedeutet, stabilisieren sie nicht nur das Zinseinkommen, sondern
sie wirken auch noch als indirekte Sicherung gegen Anderungen der Waren
preise1), weil jede solche Anderung den Zins irgendwie beeinflussen miiBte.
Die Widerstandsfahigkeit der verkehrswirtschaftlichen Einkommensver
teilung wird weiter durch die Tatsache verstarkt, daB aIle Reaktionserscheinungen,
die unmittelbaren Reaktionen gegen Preisdiktate wie auch die den Zins stabili
sierenden Krafte, nicht nur gegen Eingriffe offentlicher Gewalten wirksam
werden, sondern grundsatzlich in gleichem MaB auch gegen Monopolpreis
bildungen. Beispielsweise macht es fiir die Frage derReaktionen keinen Unter
schied aus, ob eine Lohnerhohung durch gesetzlichen MinimaIlohn oder durch
gewerkschaftliche Aktionen zu erreichen gesucht wird.
Das Wesen der Monopolnutzung besteht darin, daB fiir den Preis des Monopol
gutes nicht der Nutzen der letzten vorhandenen oder noch mit einem UberschuB
des Nutzens iiber die Kosten produzierbaren Einheit zur Grundlage der Preis
bildung gemacht wird, sondern ein hoherer Einheitsnutzen. Dadurch wiirde
der Kaufer genotigt werden, einen Teil der Einheiten mit einemPreise zu bezahlen,
der den Nutzen iibersteigt. Dagegen wehrt er sich, indem er seinen Bedarf
einschrankt. Der Verkaufer mag versuchen, ihn zu zwingen, daB er aIle Einheiten
abnimmt, wenn er iiberhaupt Einheiten erhalten will. Aber im allgemeinen
ist der Kaufer in diesem Kampfedem Verkaufer bei weitem iiberlegen, weil die
Oktroyierung der Ubernahme aller Einheiten in einer individualistischen Wirt
schaftsordnung technisch auBerordentlich schwer durchzufiihren ist.
1) Eine Politik der Preissenkung durch Hochstpreise mull, wenn sie umfassend
angewendet und nicht durch technische Schwierigkeiten oder ihre unmittelbaren
Wirkungen (Angebotseinschrankung) alsbald zu einer rucklaufigen Bewegung ge
zwungen wird, notwendig ein Sinken des ZinsfuBes zur Folge haben. Denn die Preis
senkung schreckt von der Warenerzeugung ab und setzt dadurch Kapital frei. Die
Folge solcher ZinsermaBigung wird sein, daB nun weit ausgreifende Kapitalsinvesti
tionen erfolgen, die auf lange Sicht eine Verbesserung und Rationalisierung des
Produktionsapparates bezwecken; es wird, da Arbeit fUr die Gegenwart unlohnend
scheint, mehr fUr die Zukunft gearbeitet. So -6rwlinscht dies auch unter anderem
Gesichtspunkt sein mag, so ist ein solcher doch der typischen Motivierung einer
Hochstpreispolitik, namlich der besseren Versorgung der Konsumenten in der Gegen
wart, durchaus zuwider.
c.
6 LANDAUER
Ein Beispiel fUr diesen Sachverhalt bilden die Bestrebungen der Gewerk
schaften, zugleich mit der Durchsetzung bestimmter Lohnanspruche die Erit
lassung von Arbeitskraften moglichst zu verhindern. Der Arbeitgeber zeigt
das Bestreben, sobald durch Tarifvertrag eine bestimmte Mindesthohe des
Lohnes vorgeschrieben ist, aIle Arbeiter zu entlassen, deren Nutzen fUr den
Betrieb geringer ist, als diesem Lohn entspricht. Dem suchen die Gewerkschaften
durch Erzwingung entsprechender tarifvertraglicher Abmachungen oft entgegen
zuwirken. Durch die Drohung, zu streiken, d. h. uberhaupt keine Einheiten
des Faktors Arbeit mehr zu liefern, wollen sie den Arbeitgeber zwingen, aIle
angebotenenEinheiten zu dem verlangten erhohten Preis abzunehmen. Manchmal
muB sich der Arbeitgeber vorubergehend fugen, weil er sonst keine Arbeiter
mehr erhalten wiirde. Aber uber kurz oder lang setzt der Unternehmer die
Entlassung immer durch, und zwar deshalb, weil ihm auf der Grundlage der
Privatwirtschaftsordnung die Freiheit der EntschlieBung in den fUr die Betriebs
fiihrung entscheidenden Fragen letzten Endes nicht genommen werden kann.
Die Einschrankung des Verbrauches durch den Kaufer schlieBt an sich
einen Sondergewinn des Monopolisten nicht aus, weil der hohere Stuckgewinn
aus der kleineren Stuckzahl ihm im ganzen mehr einbringen kann als der
niedrigere Stuckgewinn aus der groBeren Stuckzahl, und zwingt ihn also auch
nicht zur Aufgabe der Monopolnutzung. Die Preisuberhohung bietet aber anderen
Wirtschaftspersonen einen Anreiz, als Anbieter aufzutreten und so das Monopol
zu durchbrechen. Dieser AuBenseitergefahr kann der Monopolist nur erfolgreich
begegnen, wenn entweder das Monopolgut nicht reproduzierbar ist und sich
alle Stucke in seinem Besitz befinden oder wenn er uber unentbehrliche Voraus
setzungen fUr die Produktion des Monopolgutes ausschlieBlich verfugt. Auch das
Auftreten der AuBenseiter ist im gleichen Sinne wie die Einschrankung des
Verbrauches eine Reaktion, die durch den Versuch monopolistischer Beeinflussung
der Einkommensbildung hervorgerufen wird: Der Konsument strebt darnach,
sich mit anderen Personen, die als Anbieter auftreten konnen, zu verstandigen
und dadurch den Monopolisten auszuschalten.
FUr jene FaIle, in denen der Sondergewinn des Monopolisten weder durch
Verbrauchseinschrankung noch durch AuBenseiterangebote vernichtet wird,
bleiben schlieBlich die komplizierteren Reaktionserscheinungen ubrig, die durch
Beeinflussung des Geldwertes und des Zinses hervorgerufen werden. So ist
auch hier die relative Widerstandsfahigkeit der verkehrswirtschaftlichen Ein
kommensverteilung gesichert.
Man kann die Tatsache dieser Widerstandsfahigkeit in besonderem Hinblick
auf die Stabilitat gegenuber Monopolpreisbildungen vielleicht am besten durch
folgende Formulierung zum Ausdruck bringen: In der Verkehrswirtschaft ist
der Tendenz nach keine Einkommensverteilung stabil, die fur irgendwelche
Guter oder Leistungen eine Bewertung voraussetzt, die nicht die Grenzbedeutung
der kleinsten, einer wirtschaftlichen Disposition noch zu unterwerfenden Einheit
zur Grundlage hat.
Die Wirkung von Monopolpreisbildungen ist nur grundsatzlich die gleiche
wie die Wirkung staatlicher Eingriffe in die verkehrswirtschaftliche Einkommens
bildung. Praktisch ergeben sich gewisse Abweichungen damus, daB in typischen
Fallen der Monopolisierung die Beweggrunde und der EinfluBbereich anders
gestaltet sind. Dabei kommen vor allem zwei Tatsachen in Betracht. Staatliche
Eingriffe in die Einkommensverteilung sind im allgemeinen von der Absicht
geleitet, von groBeren sozialen Gruppen, etwa von Klassen, die eine vor anderen
zu begunstigen. Nur selten wird der Staat es sich zum Ziele setzen, einer absolut
kleinen Zahl von Wirtschaftspersonen, etwa den Angehorigen eines Spezial-