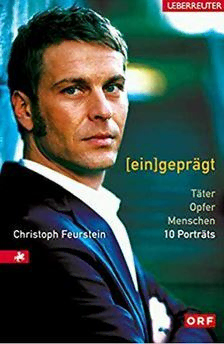Table Of ContentChristoph Feurstein
(ein)geprägt
Täter
Opfer
Menschen
10 Porträts
UEBERREUTER
Redaktionelle Mitarbeit: Mag. Anni Bürkl, Redaktion Texte und Tee,
www.rexteundtee.at
ISBN 978-3-8000-7385-6
Alle Urheberrechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung
und öffentlichen Wiedergabe in jeder Form, einschließlich einer Verwertung in
elektronischen Medien, der reprograftschen Vervielfältigung, einer digitalen
Verbreitung und der Aufnahme in Datenbanken, ausdrücklich vorbehalten.
Covergestaltung: Walter Reiterer
Coverfoto: Thomas Maria Laimgruber; Foto Klappe: ORF
Copyright © 2008 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Druck: Druckerei Theiss Gmbl I, A-9431 St. Stefan i. L.
Gedruckt auf Salzer Papier
7 6 5 4 3 2
Ueberreuter im Internet: www.ueberreuter.at
Inhalt
Vorwort von Christoph Feurstein 7
Vorwort von Andreas Zembaty 9
Zeuge einer Hinrichtung 13
Gerti Jones kämpft vergeblich um das Leben ihres Mannes
Begegnung mit einem Kinderschänder 35
Peter und was der Trieb aus ihm gcmacht hat
Kaffee mit Schlag 53
Umtrunk mit Domina Alice und Madame Sue
Ein Rebell vor dem Herrn 69
Pater Udo Fischer und die Affäre Groer
Wahrheit statt Karriere 95
Karin Weinländer deckt einen sexuellen Missbrauch im
Haus der Barmherzigkeit auf
Ein Schrei zu viel 109
Wie Stefans aufgestaute Aggressionen dem Leben seiner Tochter
ein Ende setzten
Ersehnte Heimat 125
Die Hoffnung von Arigona Zogaj und Denis Zeqaj auf Asyl in Österreich
Wenn Liebe weh tut 151
Neubeginn im Frauenhaus - Andrea Brem
Ein Toter auf Urlaub 173
Der echte Fälscher Adolf Burger
Im Keller abgründiger Fantasien 189
Opfer und was man von ihnen erwartet - Natascha Kampusch
Wichtige Kontaktadressen und Anlaufstellen 219
Bildnachweis 222
5]
Vorwort von Christoph Feurstein
Der unmittelbare Kontakt mit meinen Interviewpartnern war mir im-
mer schon besonders wichtig. Oft war und ist der Kontakt zwar inten-
siv, aber aufgrund der Dynamik des Mediums Fernsehen viel zu flüchtig
in der Präsentation. So traf es sich optimal, dass der Ueberreuter-Verlag
mir die Gelegenheit bot, mit dem Medium Buch diese Geschichten aus-
führlicher zu erzählen, als man das in einem Fernsehbeitrag tun kann.
Was liegt bei der Wahl des Themas näher, als über die vielen interes-
santen Menschen, die ich in den vierzehn Jahren als Journalist getroffen
habe, zu schreiben. So habe ich zehn der Geschichten, die sich in mein
Gedächtnis eingebrannt haben und mich auch immer wieder begleitet
haben, ausgewählt. Alle handelnden Personen sind in besonderer Weise
vom Leben geprägt und haben sich mir, aber auch vielen Zuseherinnen
und Zusehern meiner Fernschbeiträge eingeprägt. Sie sind entweder
Opfer oder Täter, aber auf jeden Fall sind sie alle Menschen. Menschen
mit Gefühlen und einer eigenen Geschichte.
Das Schreiben des Buches war für mich eine spannende, manch-
mal auch aufreibende Zeitreise, von meinen Anfangen als Journalist bis
heute. Alle Menschen, die in diesem Buch vorkommen, habe ich noch
einmal getroffen, um zu sehen, wie sie heute leben. Ich möchte mich
bei allen Interviewpartnerinnen und -partnern bedanken, dass sie mir
so bereitwillig Auskunft und vor allem Einblick in ihr Leben gegeben
haben. Ich bin stolz auf das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben und
schenken. Es geht in diesem Buch um intime Dinge, Dinge, über die
zu sprechen oft sehr schwer fallt. Es kommen Personen vor, mit denen
viele nicht einmal etwas zu tun haben möchten. Dennoch haben gerade
auch diese Menschen Beachtung verdient. Ich bin der Meinung, dass
es für eine Gesellschaft wesentlich ist, darüber nachzudenken, warum
Menschen aus der Bahn geraten sind und für uns unverständliche Taten
setzen. Als Journalist will und soll ich die 1 Untergründe von Schicksalen
und Ereignissen ergründen.
Nicht selten finden sich die Ursachen in den Lebensgeschichten der
7]
Menschen. Diese Lebensgeschichten können niemals als Entschuldi-
gung dienen, sie sollen zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken,
was wir selbst im Umgang mit anderen anders machen könnten. Sie sol-
len anregen, um bei uns selbst nachzuschauen, wo wir ähnliche Fehler
machen, oder uns zu fragen, warum wir uns dagegen wehren, uns auf
unsere Mitmenschen genauer einzulassen. Jeder Mensch wird einmal er-
wachsen und muss dann die Verantwortung für sich selbst übernehmen,
auch wenn sich in der Kindheit oder Jugend Vorfalle ereignet haben,
die eine »normale« Entwicklung erschweren. Es ist aber auch klar, dass
manche Menschen aufgrund ihrer Lebensgeschichten nicht die Chance
haben, aus einem breiten Spektrum von Möglichkeiten auszuwählen.
Ich hatte dieses Glück. Wer aus sozialen und psychologischen Gründen
diese Möglichkeit nicht hat, ist wesentlich gefährdeter, den Boden unter
den Füßen zu verlieren, als andere. Es liegt also nahe, diesen Menschen
die Wahlmöglichkeiten zu erweitern und nicht zu reduzieren. Zu un-
serem eigenen Nutzen, zu unserer eigenen Sicherheit. Sie brauchen uns
und unsere Zuwendung, gerade wenn sie es am wenigsten verdienen.
Immer wieder stellt man mir die Frage, ob es nicht deprimierend ist,
sich ständig mit derart dramarischen Schicksalen zu beschäftigen. Ich
sage ganz klar: Nein. Für mich wäre es wesentlich deprimierender, hätte
ich nicht die Möglichkeit, zu verstehen. Versucht man zu verstehen, be-
kommt man die Macht des Handelns zurück, weigert man sich, hinter
die Schlagzeilen zu sehen, bleibt nur die Ohnmacht.
Ich bin nach meinen Interviews mit Natascha Kampusch immer
wieder gefragt worden, warum gerade ich dieses Interview gemacht
habe. Für mich ist die Antwort in den Geschichten zu finden, die ich
in diesem Buch beschreibe. Hätte ich mich nicht mit all diesen Men-
schen und ihren Schicksalen beschäftigt, wäre es mir wahrscheinlich
nicht möglich gewesen, das Interview mit Natascha Kampusch auf diese
Art und Weise zu führen. Die Menschen und ihre Geschichten, die ich
im Laufe meines Journalistenlebens kennenlernen durfte, haben sich
bei mir eingeprägt, und sie haben mich geprägt. Und ich hoffe, dass
sie auch bei Leserinnen und Lersern einen prägenden Eindruck hinter-
lassen.
8]
Vorwort von Andreas Zembaty
aufdecken, um zu verstehen
»Ich möchte mit Jugendlichen sprechen, die einen Menschen getötet
haben...« Mit diesem Satz sprach mich, als Mitarbeiter des Vereins
NEUSTART (Leben ohne Kriminalität. Wir helfen.), vor vielen Jah-
ren Christoph Feurstein an. Was mich damals daran verwunderte, war
der Akzent, den Christoph Feurstein setzte: Nicht die journalistische
»Geschichte« stand im Vordergrund, sondern der Wunsch nach einem
Gespräch mit Menschen, mit denen niemand mehr etwas zu tun haben
wollte. Nicht die Suche nach 'Iätortdetails, die beim Publikum wohliges
Gruseln verursachen, nicht die moralisierende Aburteilung von Verbre-
chen, die einem die Gewissheit gibr, auf der Seite der »Guten« zu sein
in. ] n: das Gespräch.
In seiner Recherche bestätigte er, allein schon im Umgang mit diesen
Jugendlichen jenseits von Kamera und Mikrofon, diese Grundhaltung:
das Bedürfnis, durch Zuhören selbst einer weiteren Wahrheit näher zu
kommen und nicht die Wahrheit vor sich herzutragen. Als Sozialarbei-
ter war ich beeindruckt, wie wertschätzend, aber auch pointiert er die
Gespräche führte. Der Respekt vor dem Objekt der Berichterstattung,
dem Menschen, war spürbar. Teilweise konfrontativ, ersparte er sich
und dem Gesprächspartner nichts. Aus diesem intensiven Einlassen des
Journalisten entstand für die Jugendlichen der Eindruck, ernst genom-
men zu werden. Sie sprachen über sich, über ihr Leben und die Katas-
trophe, die sie verursacht hatten. Einer der Klienten war das erste Mal
bereit, überhaupt die Hintergründe seiner Int zu beschreiben, lange
nach den Verhören und der Befragung bei Gericht und Psychiatrie —
eine Art Katharsis, die die Betreuung durch uns intensivierte.
Dabei blieb es nicht. Diese Gespräche wurden in einer Dokumenta-
tion verarbeitet. Wiederum wurden nicht gängige Formen der Krimina-
litätsinszenierung gewählt. Kein simples »Gut-Böse«-Schema, obwohl
das bei Mördern doch so nahelag. Nein, Christoph Feurstein macht
9]
es seinem Publikum nicht leicht: Er eröffnet uns durch seine Bilder
Welten anderer, die wir nicht als exotisch abtun können, er konfrontiert
uns über andere mit Impulsen in uns selbst, denen wir uns oft nicht
stellen wollen.
Ähnliches erlebte ich in seiner Rccherche zur Sexualkriminalität.
Auch hier kein Bedienen voycurisrischer Bedürfnisse, sondern ein Auf-
decken, wie nahe wir selbst gerade in diesen voyeuristischen Bedürfnis-
sen der Gedankenwelt des Täters sind. Unbequem, keine unterhaltsame
Talkshow-Atmosphäre.
Auch die Welt der Kriminalitätsopfer ist nicht eindimensional. Ei-
nerseits wird Mitleid mobilisiert, andererseits auch Abwehr: Niemand
möchte Opfer sein. In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder das Mit-
leid des Publikums. Ausgrenzung und »Selber-mit-schuld«-Erklärungen
folgen jedoch prompt. Auch das Opfer konfrontiert uns. Es erschüt-
tert unsere (lebenswichtige) Illusion des »Mir kann so etwas nicht pas-
sieren«. Das Verdrängte kommt jedoch in einer Form zurück, die wir
nicht kontrollieren können. Am Beispiel der Recherchen zum sexuellen
Missbrauch durch Geistliche wurde oft deutlich, dass gerade dort, wo
teilweise rigide (Sexual-)Moral gepredigt wird, einzelne Prediger daran
zerbrechen und in der Folge, meist im Verborgenen, Menschen in ihrem
Umfeld zu Opfern werden.
Am Schicksal von Natascha Kampusch zeigt sich die Notwendigkeit,
nicht die »schnelle Geschichte« als Maßstab journalistischer Arbeit gel-
ten zu lassen. Mit den Angehörigen, insbesondere der Mutler des Op-
fers, jahrelang kontinuierlich im Kontakt zu bleiben, sie nicht medial
ins Abseits zu stellen und sie damit der Hoffnung zu berauben, mirhilfe
der Öffentlichkeit die Tochter wiederzubekommen, zeigt einen Journa-
lismus, der an Menschen »dran bleibt« und nicht »drübergeht«. Trotz
aller notwendigen beruflichen, journalistischen Distanz.
Diese Form des Journalismus sucht die Welt der Menschen auf der
Straße, also den Boulevard. Jedoch eine andere Art des Boulevards: ohne
zu belehren, ohne liebgewordene Vorurteile zu bedienen, ohne simple
Unterhaltung. Warum sind Christoph Feursteins »Geschichten« trotz-
110]
dem erfolgreich und quotenträchtig? Meine Antwort: Die Art, wie er
mit Menschen, die Extremes erlebt haben, kommuniziert, konfrontiert
uns zwar mit eigenen unerwünschten Anteilen, er verurteilt (uns) aber
nicht, er nimmt es an und entlastet damit. Er macht Unverständliches
nicht akzeptabel, aber nachvollziehbar. Im besten Fall erfahren wir da-
bei etwas über uns selbst.
Christoph Feurstein bei F. Flstner, Menschen der Woche, 3. 5. 2008: » Wir
alle müssen lernen, dass eben das angepasste Brave nicht unbedingt das un-
schuldige Glückliche ist... Die Gesellschaft muss offener werden, nur dann
kann sie sich richtig mit Fällen wie z. B. dem Fall Fritzl auseinander-
setzen«
Andreas Zembaty
Sozialarbeiter, Psychotherapeu i
tätig in Wien im Bereich Bewährungshilfe, Hille für Opfer und Prä-
vention
11]
Zeuge einer Hinrichtung
Gerti Jones kämpft vergeblich um das Leben ihres Mannes
In wenigen Minuten soll ein Mann sterben. Sein Tod wird nach Plan
eintreten. Wir befinden uns im Hochsicherheitsgefängnis von Potosi,
am Ende der Welt - die Landkarte sagt, ein Dorf im Süden der USA.
Heute Abend, Punkt Mitternacht, steht die Hinrichtungeines Mörders
auf dem Programm. Ist diese morbide Inszenierung die Gerechtigkeit,
von der manche so gern sprechen? Gibt es eine solche Gerechtigkeit?
Die Entscheidung fällt nicht leicht: Werde ich den Tod dieses Ver-
urteilten in einem benachbarten Raum abwarten, dabei die Uhr nicht
aus den Augen lassen, wissend, wann es so weit ist, wann der Tod ein-
getreten sein muss, in den ersten Minuten des neuen Tages? Während
meine Augen nicht dabei sind, meinen Ohren das Erlebnis fehlt? Die
Neugier brennt mir Fragen in den Kopf. Kann ich aber die Bilder ertra-
gen, die unweigerlich auf mich zukommen, wenn ich als Zuseher dabei
bin, diese Bilder, wenn das Gift zuerst die Muskeln des Mannes lähmt
und dann sein Herz?
Ist es nicht auch meine Pflicht, all dies zu beobachten, zu berichten,
das Wissen über die Geschehnisse hinauszutragen, hinaus aus Potosi,
hinaus aus den Südstaaten, hinaus aus diesen Vereinigten Staaten Ame-
rikas? Wie weit aber kann ich gehen, wie viel ertragen? Viele haben mir
abgeraten, auch meine Redaktion in Wien. Ich habe eine Entscheidung
getroffen: Ich werde dabei sein.
Die Gefühle zerreißen mich beinahe, kämpfen gegeneinander an.
Ein zwiespältiges Gefühl.
Ich stehe gleichermaßen neben mir, beobachte mich, sehe mir zu,
wie ich schließlich in den Zuseherraum gehe. Immerauch als Kamera,
als filmendes Auge. Warte ab, beobachte mich und alles rundum. Es
ist erst zwei Stunden her, seit wir wissen: Der Kampf um das Leben
des Verurteilten ist endgültig verloren. Wir, das sind die österreichische
13
Ehefrau des Mörders und ich ... und es ist Teil meines Jobs, hierzu sein,
zu berichten, zu sehen, zu spüren, festzuhalten. Ich muss die Kamera
sein, die wir nicht mitnehmen dürfen.
Dann ist keine Zeit mehr für Gedanken. »Two - One - Zero«, zählr
eine metallische Stimme den Countdown bis zur ersten Injektion her-
unter. Und ich sehe mich um, jedes Detail will ich aufnehmen, alles will
ich in meinem Kopf wie auf Band speichern. Vor den Glasfronten im
Zuseherraum werden gleichzeitig Rollos hochgekurbelt. Das Ganze ist
aufgezogen wie eine Show: Mein Blick fällt auf den Hauptdarsteller.
Was hier sein Ende findet, hat Jahre zuvor als ungewöhnliche Romanze
begonnen. Den Auftakt macht eine Notiz in den Salzburger Nachrich-
ten. Unter dem Titel »Rettungsanker Hochzeit« berichtet eine Salzbur-
gerin von ihrem Plan: Sic will ihren Briefpartner, einen amerikanischen
Todeskandidaten, mit dem Trauschein vor der Hinrichtung bewahren.
Ich vereinbare ein Treffen mit ihr, einer Hälfte dieser romantischen
Verbindung dieses Traumpaars im ganz anderen Sinn. Gertrude Sey-
waldstetter lädt mich ein, sie mit einem Kamerateam in Salzburg zu
treffen. Drei Stunden dauert die Fahrt nach Salzburg, drei Stunden
Zeit, um zu überlegen: Was treibt diese Frau an? Und dann der erste
Eindruck, der alle Vorstellungen sprengt, der sämtliche Bilder und Ge-
danken im Kopf ad absurdum führt. Wie ein Wirbelwind begrüßt uns
Gertrude, erzählt bei einem gemeinsamen Essen von sich und ihrem
Liebsten. Billy heißt er, sein voller Name lautet William Robert Jones.
Sic hat seine Anzeige im Internet gelesen, ein paar Monate zuvor. Open
your heart and mind, ruft er darin auf und schreibt von seinen braunen
Puppydog Eyes. Eine Zuflucht zu zweit will er finden, Zuflucht vor einer
Welt der Selbstzerstörung. Er spricht offen von der Todesstrafe, zu der
er verurteilt wurde, die er seit Jahren in einem zeitlosen Ort abzuwarten
gezwungen ist.
Der Mensch, der hier schreibt, spricht die Salzburgerin sofort an -
und bald mehr als das. Die Briefe werden intensiver, länger, eindring-
licher. »Ich hab immer gern geschrieben«, schildert sie mit leuchtenden
Augen, »Das geschriebene Wort hat für mich viel mehr Wert.« Schon
14