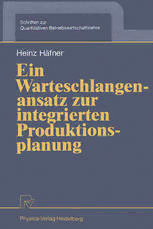Table Of ContentEin Warteschlangenansatz zur
integrierten Produktionsplanung
Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre
Band 1: Martin Kuhn
F1exibilitit in logistischen Systemen
1989.240 Seiten. DM 65,-
ISBN 3-7908-0450-9
Band 2: Christoph SchneeweiBI
Volkmar Sohner
Kapazititsplanung.bei modemer
F1ieBfertigung
1991. 126 Seiten. DM 65,
ISBN 3-7908-0576-9
Band 3: Lothar Lillich
Nutzwerlverfahren
1992.208 Seiten. DM 68,
ISBN 3-7908-0580-7
Heinz Hafner
Ein
Warteschlangen
ansatz zur
integrierten
Produktions
planung
Mit 58 Abbildungen
Physica-Verlag Heidelberg
Reihenherausgeber
Prof. Dr. Christoph SchneeweiB, Universitat Mannheim
Autor
Dr. Heinz Hafner
Lehrstuhl flir Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
und Untemehmensforschung
Universitat Mannheim
SchloB
0-6800 Mannheim 1
ISBN-13: 978-3-7908-0579-6 e-ISBN-13: 978-3-642-95888-5
DOl: 10.1007/978-3-642-95888-5
Physica-Verlag Heidelberg
CIP·Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Hafner, Heinz:
Ein Warteschlangenansatz zur integrierten Produktionsplanung
I Heinz Hafner. - Heidelberg: Physica-VerI., 1992
(Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre; Bd. 4)
NE:GT
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschlitzt. Die dadurch begrlindeten Rechte, insbesondere die
der Ubersetzung, des Nachdruckes, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendungen, der Mikroverfilmung oder der Vervielf<iltigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vor
behalten. Eine Vervielfaltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall
nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepu
blik Deutschland vom 9. September 1965 in der Fassung vom 24. Juni 1985 zulassig. Sie ist grund
satzlich verglitungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urhe
berrechtsgesetzes.
© Physica-Verlag Heidelberg 1992
Softcover reprint of the hardcover 1s t edition 1992
Geleitwort
Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme (sog. PPS
Systeme) sind heute fester Bestandteil der operativen Pla
nung. 1m Zentrum dieser Systeme steht der MRP (Material
Requirements-Planning) - Modul, der die LosgroBenrechnung der
Erzeugniskomponenten durchfUhrt und durch Vorlaufverschiebung
die Terminplanung bestimmt.
PPS-Systeme weisen erhebliche Mangel auf, die letztlich von
ihrem streng hierarchischen Charakter herrUhren. Weder sind
sie in der Lage, den benotigten Kapazitatsbedarf frUhzeitig
zu bestimmen, noch gelingt es ihnen, mogliche Unsicherheiten
adaquat zu erfassen. Dieser Mangel zeigt sich besonders in
der Durchlaufzeit, aus der sich die Vorlaufverschiebung er
gibt. sie wird nicht endogen errechnet, sondern lediglich
exogen vorgegeben.
Deutlich treten die Schwierigkeiten heutiger PPS-Software in
der wichtigen Kleinserienfertigung zutage. Es ist daher das
zentrale Anliegen der vorliegenden Abhandlung, hier zu einer
Neukonzeption zu gelangen. Ausgangspunkt ist die Uberlegung,
daB bei Kleinserienfertigung zum Zeitpunkt der Erstellung ei
nes Master-Production-Schedule (MPS) das Produktionssystem
(d.h. die Werkstatt) als ein Netzwerk von Warteschlangensy
stemen aufzufassen ist. Hierdurch wird es unter Einsatz war
teschlangentheoretischer Resultate moglich, Durchlaufzeiten,
LosgroBen und Kapazitaten simultan fUr samtliche um die Re
sourcen konkurrierende Produktarten zu bestimmen. FaBt man
wegen der positiven Beeinflussung der Flexibilitat und des
gebundenen Kapitals die Minimierung von Durchlaufzeiten als
das wesentliche Ziel der operativen Produktionsplanung auf,
so bleibt fUr die sich anschlieBende Ablaufplanung
(Produktionssteuerung) lediglich die Beachtung der Termin
treue.
Mit der Neukonzeption werden nicht nur die zuvor beschriebe
nen Mangel beseitigt, gleichzeitig wird durch eine Feedfor-
VI
wardkopplung der einzelnen Planungsmodule deren Abstimmung
wesentlich verbessert. Dies trifft fUr den Ubergang von der
Produktionsprogrammplanung zum Master-Production-Schedule und
vom MRP-Modul zur Ablaufplanung zu. Theoretisch schlecht fun
dierte MaBnahmen, wie sie etwa in der z.zt. viel diskutierten
belastungsorientierten Auftragsfreigabe vorgesehen sind, wer
den UberflUssig. Es ware zu wtinschen, wenn sich daher nicht
nur die Theorie, sondern auch die Praxis mit der vorgeschla
genen Neukonzeption intensiv auseinandersetzte.
Mannheim, im August 1991 Ch. SchneeweiB
Inhaltsverzeichnis
1 Einftihrung 1
1.1 Konzeption der Produktionsplanung 1
1.2 Problemstellung 3
1.3 Gang der Arbeit 6
2 Beschreibung und Beurteilung des klassischen Konzeptes
der Hierarchischen Produktionsplanung 9
2.1 Hierarchische Strukturierung 9
2.1.1 Hierarchische vs. simultane Planung 9
2.1.2 Strukturelemente 14
2.1.2.1 Dekomposition 15
2.1.2.2 Integration 18
2.2 Stufen der Produktionsplanung 26
2.2.1 Produktionsprogrammplanung 28
2.2.2 Masterplanung 31
2.2.3 Materialbedarfsplanung 36
2.2.4 Kapazitatsbedarfsplanung 40
2.2.5 Ablaufplanung 43
2.3 Beurteilung des klassischen Konzeptes 47
2.3.1 Grundsatzliche Kritik 47
2.3.2 Bedeutung der Durchlaufzeit 51
2.3.3 Integration der Planungsstufen 55
2.3.4 Konsequenzen mangelnder Integration 64
3 Beschreibung und Beurteilung der Belastungsorientierten
Auftragsfreigabe 72
3.1 Darstellung des Verfahrens 73
3.1.1 Hierarchische Einordnung und tlbersicht 73
3.1.2 Durchlaufterminierung 78
3.1.3 Einlastung der Planauftrage 82
3.2 Kritische Beurteilung 89
VIII
4 Analyse der Werkstattfertigung mit Hilfe der
Warteschlangentheorie 97
4.1 Einsatz der Warteschlangentheorie zur Lasung der
Integrationsprobleme 97
4.2 Die Werkstatt als Warteschlangennetzwerk 103
4.2.1 Dekomposition von Warteschlangennetzwerken 103
4.2.2 Ergebnisse der Warteschlangentheorie 107
4.3 Untersuchung eines Warteschlangensystems 109
4.3.1 RegelmaBiger Zugang und Auslastung 111
4.3.2 RegelmaBige Bearbeitungszeiten und Auslastung 115
4.3.3 RegelmaBiger Zugang, regelmaBige Bearbei-
tungszeiten und Auslastung 120
4.3.4 variation der mittleren LosgraBe und Aus-
lastung 125
4.3.4.1 Vernachlassigbar kleine Rtistzeiten 126
4.3.4.2 Berticksichtigung von Rtistzeiten 130
4.4 Ausstrahlungseffekte im Warteschlangennetzwerk 146
4.4.1 Effekte von Vorgangermaschinen 147
4.4.2 Effekte auf Nachfolgemaschinen 152
4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 158
5 Integrierte Produktionsplanung 162
5.1 Uberblick 162
5.2 Produktionsprogrammplanung 166
5.3 Betriebsauftragsplanung 170
5.3.1 Masterplanung 172
5.3.1.1 Kapazitatsgrobplanung und Aggregation 172
5.3.1.2 Planung der LosgraBen 175
5.3.2 Terminplanung 193
5.3.3 Losanpassung 201
5.4 Ablaufplanung 208
5.5 AbschlieBende Zusammenfassung und Vergleich der
vorgestellten Verfahren 222
6 Zusammenfassung und Ausblick 231
Literaturverzeichnis 235
1 Einfiihrung
1.1 Konzeption der Produktionsplanung
Just-in-Time (JIT) und computer Integrated Manufacturing
(CIM) sind zwei Schlagworte, die nichts an Bedeutung verloren
haben und nach wie vor im Brennpunkt der Uberlegungen von
Praxis und Wissenschaft stehen. Sie zeigen, daB der Stellen
wert der Produktionswirtschaft in den 80er Jahren erheblich
zugenommen hat. Ausgelost durch eine Kaufermarktsi tuation,
verktirzte produktlebenszyklen,1 eine steigende Produkt- und
Variantenvielfalt sowie einen scharferen internationalisier
ten Wettbewerb ist manchen Autoren zufolge der Wettbewerbs
faktor Produktion als gleichrangig zum Marketing zu sehen.2
Die Inhalte der Ktirzel JIT und CIM kennzeichnen die aktuellen
Tendenzen in der Weiterentwicklung der Planungskonzeptionen,
die im Rahmen der Produktionswirtschaft Verwendung finden.
JIT steht ftir eine Abkehr yom alten Lagerhaltungsdenken hin
zur flexiblen Fertigung.3 Die Produktion solI sich verstarkt
an den Kundenwtinschen orientieren und diese erst dann erftil
len, wenn sie auftreten, d.h. Produktion und Absatz mtissen
starker synchronisiert werden.
Wichtiges Merkmal einer JIT-Fertigung ist somit zum einen,
daB Produktionsentscheidungen moglichst nahe an den Absatz
gertickt werden, d.h. der Zeitaspekt der Planung tritt starker
in den Vordergrund. Zum anderen muB die Veranderung der
Informationslage wahrend der Durchftihrung der Produktion an
tizipiert und in die Produktionsplanung eingebracht werden,
d.h. bei einer flexibilitatsorientierten Vorgehensweise muB
die Stochastik des Entscheidungsumfeldes Berticksichtigung
1 Vgl. Ihde, G.: Stand und Entwicklung der Logistik, Die
Betriebswirtschaft 6/1987, S. 703-716, hier S. 710.
2 Vgl. Schuh, G., Brandstetter, H., Melchert, M.: Produk
tion bestimmt Wettbewerbsfahigkeit, Management 6/1990, S.
27-29.
3 Vgl. Wildemann, H.: Just-in-Time-Losungskonzepte in
Deutschland, HARVARDmanager 1/1986, S. 36-48.
2
finden.4
CIM steht fUr eine Integration der verschiedenen Aufgabenge
biete der betrieblichen Planung, Steuerung und Kontrolle und
damit natUrlich auch der verschiedenen Aspekte der Produkti
onsplanung. Statt einer Optimierung der einzelnen Bereiche
muS eine Abstimmung der Teilplanungsgebiete mit dem Ziel der
Optimierung des Gesamtprozesses erfolgen.5
Ein illustratives Beispiel fUr diese Tendenz zur integrativen
VerknUpfung von Teilbereichen ist die Entwicklung des MRP II
(Manufacturing Resource Planning)- Konzeptes. Zunachst stand
lediglich die Materialbedarfsplanung (engl.: Material Re
quirements Planning) im Vordergrund (MRP) , dann wurden die
Kapazitatsplanung (closed loop MRP) und schlieBlich auch die
anderen betrieblichen Bereiche wie Budgetplanung, Absatzpla
nung, Finanzplanung und Produktionssteuerung integriert (MRP
II) .6
Aufgabe der betriebswirtschaftlichen Theorie ist es nun,
Schwachpunkte bestehender Planungssysteme aufzuzeigen und
Hinweise auf Verbesserungen zu geben. Hierbei ist insbeson
dere auf Flexibilitat und Integration der Planung zu achten.
Unter Flexibilitat wird in dieser Arbeit die Fahigkeit eines
Planungssystems verstanden, auf interne und externe storungen
entsprechend einem vorgegebenen Ziel reagieren zu konnen.7
Integration bezeichnet die Abstimmung zwischen verschiedenen
Planungsaspekten, d.h. die Einbeziehung anderer Planungsbe
reiche bei der Losung der eigentlichen Planungsaufgabe. Uber
tragen auf die Produktionsplanung, erfordert dies eine Ver
knUpfung der Teilbereiche in der weise, daB den einzelnen
4 Vgl. KUhn, M.: Flexibilitat in logistischen Systemen,
Heidelberg 1989, S.4.
5 Vgl. EidenmUller, B.: Just-in-Time Produktion ist
Voraussetzung fUr CIM, Management 6/1990, S. 34-37.
6 Vgl. Wight, 0.: Manufacturing Resources Planning: MRP II,
New York 1984.
7 Vgl. Maier, K.: Die Flexibilitat betrieblicher Leistungs
prozesse, Dissertation, Mannheim 1982, S. 107.