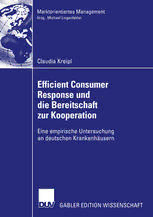Table Of ContentClaudia Kreipl
Efficient Consumer Response und
die Bereitschaft zur Kooperation
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Marktorientiertes Management
Herausgegeben von Professor Dr. Michael Lingenfelder
In dieser Schriftenreihe werden Entwicklung und Anwendung wissen
schaftlich fundierter Methoden und Modelle des marktorientierten
Managements thematisiert. Sie dient als Forum fUr praxisrelevante
Fragestellungen aus Handel, Dienstleistung und Industrie, die mit Hilfe
theoretischer und empirischer Erkenntnisse beantwortet werden.
Claudia Kreipl
Efficient Consumer Response
und die Bereitschaft zur
Kooperation
Eine empirische Untersuchung
an deutschen Krankenhausern
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Lingenfelder
Deutscher Universitats-Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Ober
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Dissertation Universitat Marburg, 2004, u.d.T.: Kreipl, Claudia: Efficient Consumer Response
(ECR): Determinanten der Bereitschaft zur Kooperation. Eine empirische Untersuchung an
deutschen Krankenhiiusern
1. Auflage September 2004
Aile Rechte vorbehalten
© Deutscher Universitats-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004
Lektorat: Brigitte Siegel/Sabine Scholler
Der Deutsche Universitats-Verlag ist ein Unternehmen von
Springer Science+Business Media.
www.duv.de
Das Werk einschliel3lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschOtzt.
Jede Vervvertung aul3erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verla.gs unzulassig und strafbar. Das gilt insbe
sondere fOr Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dOrften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN-13:978-3-8244-8206-1 e-ISBN-13:978-3-322-81843-0
001: 10.1007/978-3-322-81843-0
v
Geleitwort
Die vertikale Verknupfung von Wertschiipfungsstufen, die auf die Optimierung des
Konsumentennutzens abzielt, wird in Wissenschaft und Praxis als Efficient Consumer
Response (ECR) bezeicbnet. Erstaunlicherweise wurde bislang in der Forschungsliteratur das
Konstrukt ECR-Bereitschaft, also das AusmaJ3 der Intention, eine solche vertikale
Verknupfung mit vor- undJoder nachgelagerten Gliedem der Wertkette einzugehen, nicht
konzeptualisiert und empirisch ergriindet.
1m deutschen Gesundheitswesen wird von verschiedenen Akteuren seit etwa fiinf Jahren (mit
bislang miiBigem Erfolg) versucht, die Zusammenarbeit zwischen vor- und nachgelagerten
Anbietem durch elektronische Bestellsysteme, Belieferungssysteme etc. effizienter zu
machen. Umfangliche Konzepte im Sinne des ECR-Ansatzes sind aber bislang nicht oder
lediglich sehr bruchstuckhaft vorzufinden. Von daher lag es nahe, dass Frau Kreipl zuniichst
die Forschungslucke beziiglich der Konzeptualisierung der ECR-Bereitschaft zu schlieJ3en
trachtet und zugleich den deutschen Krankenhaussektor als empirisches Anwendungsfeld
ihrer Dissertation auswiihlt. Die vorliegende Arbeit liefert daher einerseits fUr die Debatte um
ECR wichtige AnstiiJ3e und andererseits fUr diese Branche wertvolle Anregungen fUr die
Etablierung von ECR-Partnerschaften.
Einen Schwerpunkt des Buches bildet die theoriegestutzte Konzeptualisierung eines Modells
der ECR-Bereitschaft. Auf Basis der Transaktionskostentheorie, des Resource-Dependence
Ansatzes und transaktionsspezifischer Investitionen werden drei Dimensionen dieses
Zielkonstruktes identifiziert, und zwar die Bereitschaft zu
-kooperativen Beschaffungsaktivitiiten,
-kooperativen Demand Side-Aktivitiiten und
-ECR -spezifischen Investitionen.
Darauf aufbauend werden personenbezogene bzw. individuelle, (krankenhaus-)inteme, mit
dem Umfeld eines Krankenhauses zusammenhangende und partnerschaftliche Determinanten
als relevante Treiber der ECR-Bereitschaft behandelt. Fiir jede Kategorie werden geeignet
erscheinende Theorien bzw. Konzepte und Befunde einschliigiger Untersuchungen im
Hinblick auf ihren Beitrag zur Bildung von explizit formulierten Hypothesen evaluiert.
Dariiber hinaus wird jeweils ein Messansatz - soweit vorhanden unter Einbeziehung von
Reliabilitiits-und ValiditiitsmaJ3en - vorgestellt.
Mittels einer Befragung von Krankenhausmanagem wird die ECR-Bereitschaft von
Krankenhiiusem im Spiegel empirischer Befunde beleuchtet. Letztlich vermag das
kausalanalytisch gebildete Modell 47% der ECR-Bereitschaft zu erkliiren, wobei die sog.
individuelle Grundhaltung, die ECR-Fiihigkeiten und die Beziehungszufriedenheit die
entscheidenden Determinanten des Zielkonstruktes bilden. Mittels eines Index werden
Krankenhiiuser mit hoher und so1che mit niedriger ECR-Bereitschaft identifiziert, um darauf
aufbauend mittels Diskriminanzanalyse nach den Ursachen hierfiir zu fahnden. Zudem wird
nach zentralen Moderatoren des ermittelten Wirkungsgeflechts gesucht.
VI
Die Arbeit enthiUt schlieBlich eine Reihe von Vorschlagen zur Umsetzung der Erkenntnisse in
die betriebliche Praxis. So wird z.B. mittels eines in Excel urnsetzbaren Tools ECR-SELECT
die Ermittlung der ECR-Bereitschaft von Krankenhausern m(jglich. Weiterhin werden
Optionen zur Steigerung der ECR-Bereitschaft thematisiert. DarUber hinaus wird die ECR
Bereitschaft eines Krankenhauses mit weiteren Kriterien verzahnt, urn die Partnerwahl zu
optimieren.
Alles in allem enthiUt das von Frau Kreipl vorgelegte Werk eine Fiille von Anregungen fUr
Wissenschaftler, die sich mit ECR und Health Care Management beschiiftigen, sowie fUr
Praktiker, die sich aufgrund von Preis-und Kostendruck intensiv mit Efflzienzsteigerung und
Kundenbindung im Distributionskanal befassen miissen.
Univ.-Prof. Dr. Michael Lingenfelder
VII
Vorwort
Veranderungen im Krankenhaussektor, u.a. Konzentrationsprozesse und neue Finanzierungs
formen, verweisen auf die wachsende Erfordernis, effizient zu agieren, um im Wettbewerb
bestehen zu konnen. Als einen moglichen Losungsweg wird in dieser Arbeit deshalb der An
satz vertikaler Kooperation in Form von Efficient Consumer Response (ECR) vorgestellt,
des sen Ziele eine Kongruenz zu diesen Anforderungen aufzuweisen scheinen. Bei der Imple
mentierung von ECR tritt die Ausgestaltung der Geschaftsbeziehung als erfolgskritisch her
vor; gerade der Partnerwahl komrnt eine prominente Bedeutung zu. Insbesondere die Bereit
schaft zu einer ECR-Kooperation wird als entscheidend fUr das Entstehen derartiger Aus
tauschbeziehungen eingestuft. Die zusatzliche Erkenntnis um Einflussfaktoren der ECR
Bereitschaft erlaubt zudem das Ableiten von Empfehlungen hinsichtlich der Vorgehensweise
in dieser initiierenden Phase. Daher wird in der vorliegenden Arbeit ein Modell zur Erkliirung
von ECR-Bereitschaft entwickelt und empirisch iiberpriift.
Eine Vielzahl an Personen begleitet den Entstehungsweg einer derartigen Arbdt. Ihnen ge
biihrt an dieser Stelle Dank.
Zunachst mochte ich meinem Doktorvater, Univ.-Prof. Dr. Michael Lingenfelder flir die Be
gleitung des Dissertationsprojektes danken. Der Freiraum, den er mir lieB, hat zum Gelingen
dieser Arbeit beigetragen. Frau Univ.-Prof. Dr. Ingrid Gopfert danke ich fUr die problemlose
Ubemahme des Zweitgutachtens und die Teilnahme an der Disputation. Univ.-Prof. Dr. Ul
rich Hasenkamp und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kerber schulde ich Dank fUr die Bereitschaft,
als Priifer an meiner Disputation teilzunehmen.
Mein Dank gilt zu dem all jenen Fiihrungskraften deutscher Krankenhauser, die im Rahmen
der empirischen Erhebung zum Generieren einer breiten Datenbasis beigetragen habcll. Insbe
sondere danke ich Frau Elke Freyenhagen, Herm Dr. Hans-Joachim Conrad und Henn Univ.
Prof. Dr. Klaus-Jochen Klose vom Klinikum der Philipps-Universitat Marburg, Frau Christa
Schrager-Schlosser und Herm Dr. Georg Kleinhans von den Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar so
wie Herm Heinz-Josef Reker von der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Duisburg, die
sich zur Teilnahme an einem Pre-Test bereit erkliirten und ihre praktischen Erfahrungen ein
brachten.
Ebenfalls danke ich den Kooperationspartnem der Studie, Frau Stefanie Hafer und Herm Dr.
Volker Wagner von der B.Braun Melsungen AG sowie Herm Achim Vogel und Heml Daniel
Breisacher von der Paul-Hartmann AG. Deren finanzielle Unterstiitzung hat die' Durchfiih
rung der empirischen Erhebung ermoglicht. Gesprache mit ihnen haben wertvolle Anregun
gen in den Elfenbeinturm gebracht.
Frau Helga Kreipl, Frau Dipl.-Kffr. Ines Bott und Frau Ursula Heik-Woll danke ich fur die
wertvolle Unterstiitzung beim Korrekturlesen.
VITI
Ein besonderes Dankeschiin gilt meinen ehemaligen Lehrstuhlkollegen. Insbesondere Herr
Dr. Peter Loevenich hat in der gemeinsamen Lehrstuhlzeit und damber hinaus immer wieder
durch eine Vielzahl an konstruktiven fachlichen Anregungen, verhalten-hiiflicher Kritik, aber
auch Gesprachen iiber Gott und die Welt und gemeinsamen Unternehmungen nicht nur maB
geblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen, sondern auch dazu, dass die Promotionszeit
stets unterhaltsam blieb. Weiterhin gilt mein Dank Frau Dipl.-Kffr. Ines Bott, Frau Inge
Trink!, Herrn Dipl.-Kim. Christian Ciesielski, Herrn Dipl.-Kfm. Bjorn Kahler, Herrn Dipl.
Kim. Clemens Jiittner, Herrn Dipl.-Kim. Martin Schulze, Herrn Dipl.-Kim. Karsten Schmidt
und Herrn Dipl.-Psych. Jan Wieseke fUr viele kulinarische Kaffeepausen und reichhaltige
Gelegenheiten, auch in frustrierenden Promotionsphasen das Lachen nicht zu verlieren.
Ebenso geht mein Dank an viele Freunde, die den Weg der Promotion begleitet haben. Sie
aile haben dafiir gesorgt, dass ich die Bodenhaftung nicht verlieren konnte. Hierzu zahlt be
sonders Herr Dr. Jasmin Bajric, der nicht nur hartnackig meine Fortschritte beobachtete, son
dern auch nachwies, dass es ein Leben nach der Promotion gibt. Stellvertretend fUr viele an
dere gebiihrt der Familie Breunig Dank fUr zahlreiche gemeinsame Grillabende und nach
mittaglichen Milchkaffee. Fiir eine Riickzugsmoglichkeit an der Ostsee danke ich der Familie
Jarck.
Vor allem gilt mein Dank den mir besonders nahe stehenden Menschen. Ich bedanke mich bei
meinem Lebensgefahrten Matthias Lorke, der mit unerlasslicher Geduld und Riicksichtnahme
den Riickhalt fUr die erfolgreiche Bewiiltigung dieses Projektes bot und dabei eigene (Frei
zeit-)Interessen oftrnals hinten anstellte.
Der groBte Dank gilt meinen Eltern, die mich von der ersten Stunde an vorbehaltlos unter
stiitzten und meinen akademischen Werdegang errnoglichten. Ihnen widme ich dieses Werk.
Claudia Kreipl
IX
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abbildungsverzeichnis XIII
Tabellenverzeichnis XV
Abkiirzungsverzeichnis XIX
A. Die Bedeutung von vertikaler Kooperation fUr eine
Effizienzsteigerung in Krankenhiiusern 1
1. Die spezifische Situation im Krankenhaussektor
2. Vertikale Kooperationen als ein Ansatz zur Effizienzsteigerung 5
2.1. Ausgestaltungsformen vertikaler Kooperationen im Krankenhaus 5
2.2. Die Identifikation relevanter Kooperationspartner fur Krankenhauser 10
3. Gang der Untersuchung 12
B. Elemente und strategische Erfolgsfaktoren von ECR 14
1. Grundlagen des ECR-Konzeptes 15
2. Die Ubertragbarkeit des ECR-Konzeptes auf den Krankenhaussektor 25
3. Die zentralen Erfolgsfaktoren von ECR 31
4. Die Wahl geeigneter Partner als Grundvoraussetzung einer erfolgreichen
Zusarnmenarbeit 35
5. Die Bereitschaft als eine zentrale Determinante des Zustandekommens einer
Partnerschaft 38
6. Zwischenfazit 41
x
C. Die Konzeptualisierung eines Modells der ECR-Bereitschaft 42
1. Die Eignung und Interdependenz der herangezogenen Theorien und Konzepte 42
2. Das Zielkonstrukt der ECR-Bereitschaft 44
2.1. Eine kooperationstheoretische Begrllndung der Dimensionen von ECR 44
2.2. Die Operationalisierung der ECR-Bereitschaft 52
3. Die Determinanten der ECR-Bereitschaft 56
3.1. Die theoretische Basis des Untersuchungsmodells 57
3.1.1. Eine motivationstheoretische Fundierung von Bereitschaft
als Vorstufe einer Handlung 57
3.1.2. Die Theorie des geplanten Verhaltens als Ausgangspunkt des Modells 58
3.1.2.1. Grundlagen und Ubertragung der Theorie des geplanten
Verhaltens 58
3.1.2.2. Anwendungsbereiche und Grenzen der Theorie
des geplanten Verhaltens 61
3.1.3. Der Beitrag des Interaktionsansatzes der IMP-Group 62
3.1.3.1. Die Erweiterung des Untersuchungsmodells mittels des
Interaktionsansatzes der IMP-Group 62
3.1.3.2. Grenzen des IMP-Modells 66
3.1.4. Uberwindung der Kritik am IMP-Ansatz 67
3.1.4.1. Eine Begrllndung der Determinantenauswahl durch
ausgewi!hlte Anslitze der Strategielehre und
des CID-Paradigmas 67
3.1.4.2. Eine Begrilndung des Einflusses organisationaler Variablen
auf die ECR-Bereitschaft mittels des Strategic Fit-Ansatzes,
der Dissonanz-und der Lerntheorie 70
3.2. Uberblick fiber die einbezogenen Determinanten 72
3.3. Konzeptualisierung und Operationalisierung der individuellen Determinanten 73
3.3.1. Die Einstellung zu einer Kooperation mit der Medizinprodukte-Industrie73
3.3.2. Die subjektive Norm 75
3.3.3. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 78
3.3.4. Eine Konzeptualisierung der individuellen Grundhaltung 80