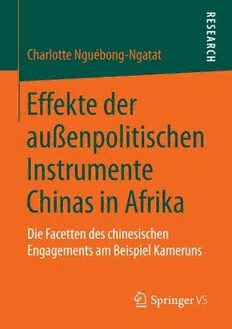Table Of ContentCharlotte Nguébong-Ngatat
Effekte der
außenpolitischen
Instrumente
Chinas in Afrika
Die Facetten des chinesischen
Engagements am Beispiel Kameruns
Effekte der außenpolitischen Instrumente
Chinas in Afrika
Charlotte Nguébong-Ngatat
Effekte der
außenpolitischen
Instrumente
Chinas in Afrika
Die Facetten des chinesischen
Engagements am Beispiel Kameruns
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Siegmar Schmidt
und Prof. Dr. Rainer Tetzlaff
Charlotte Nguébong-Ngatat
Ludwigshafen, Deutschland
Charlotte Nguébong-Ngatat, Universität Koblenz-Landau, 2016 u.d.T. Charlotte
Nguébong-Ngatat: „China in Afrika: Neokolonialismus oder „ pragmatische Zusam-
menarbeit“? Außenpolitische Instrumente Chinas und ihre politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Auswirkungen am Beispiel Kameruns.“
Die vorliegende Dissertation wurde durch den Fachbereich 6 der Universität
Koblenz-Landau zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der
Staatswissenschaften am 15.07.2016 angenommen.
ISBN 978-3-658-22027-3 ISBN 978-3-658-22028-0 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22028-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Für meine verstorbene Mutter Marie Chantal
Joël
Joëlle-Gloria
Nelson Noah
V
Geleitwort
Was wollen die Chinesen in Afrika? Was bewirkt Chinas präzedenzloses Wirtschaftsengage-
ment in Afrika? Wer profitiert von der chinesischen Charmeoffensive, mit der die kommunis-
tische Volksrepublik China Ländern wie Kamerun begegnet? Solche Fragen werden hierzu-
lande des Öfteren gestellt – und das nicht ohne Grund. Denn tatsächlich herrscht auch unter
Sozialwissenschaftlern/innen eine gewisse Unsicherheit darüber, wie Chinas Wirken in Afrika
beurteilt werden sollte. Eine erste mögliche Interpretation lobt China als selbstlosen Entwick-
lungspartner, der den afrikanischen Ländern mit Krediten, Direktinvestitionen, Stipendien und
Geschenken tatkräftig helfen würde, ihren Entwicklungsrückstand aufzuholen. Eine zweite In-
terpretation unterstellt Peking neokoloniale Absichten in dem Sinne, dass Chinas primäres In-
teresse der eigenen Versorgung mit afrikanischen Rohstoffen gälte und dass ihm dabei die öko-
logischen und politischen Folgen seiner Ausbeutungspolitik gleichgültig seien. Eine dritte In-
terpretation sieht China mit seinen Staatskonzernen in erster Linie als unfairen Wettbewerber,
der mit billigen Konsumwaren die Märkte afrikanischer Länder überschwemmen würde und
somit deren eigene Industrieproduktion zu ersticken drohe. Viertens fürchten andere wiederum
China als alternative globale Ordnungsmacht, die im Rahmen ihrer elitären Kulturoffensive
und ihrer globalen South-South-Kooperationspolitik der westlichen Hegemonie Paroli zu bie-
ten beabsichtigen und damit deren good governance-Ideale unterlaufen würde (zum Schaden
der großen Mehrheit der Bevölkerung).
Diese Unsicherheit in der Beurteilung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen ist auch dem
Umstand geschuldet, dass die Öffentlichkeit meistens nur sehr wenig über die genauen Kondi-
tionen erfährt, zu denen die Volksrepublik China ihre diversen Handels- und Hilfsangebote
präsentiert. Könnten die afrikanischen Partnerländer in naher Zukunft erneut in eine Schulden-
falle geraten, weil auch chinesische Kredite eines Tages zurückgezahlt werden müssen?
Daher ist es besonders zu begrüßen, dass sich eine Politologin mit afrikanischer Abstammung
auf den Weg gemacht hat, mittels Feldforschung in Kamerun, ihrem Herkunftsland - Licht in
das Dunkel zu bringen und eine Antwort auf die Frage nach den entwicklungspolitischen Aus-
wirkungen der chinesischen Handels- und Entwicklungskooperation zu versuchen. Besondere
Anerkennung verdient das originelle Vorgehen von Frau Nguébong-Ngatat bei der Beschaffung
ihrer Daten in Kamerun. Nicht jedem wäre es gelungen, in einer eher spröden, von Misstrauen
VII
gezeichneten Forschungslandschaft 26 Experteninterviews durchzuführen, um so unterschied-
liche Sichtweisen auf das chinesische Engagement in Kamerun und dessen Wirkung auf das
afrikanische Partnerland einfangen zu können. Ferner konnte sie durch teilnehmende Beobach-
tung und Besichtigung von drei chinesischen Hilfe-Projekten eigene Eindrücke über das Mitei-
nander von chinesischen und kamerunischen Projektmitarbeitern gewinnen. Sie beschreibt den
bunten Strauß wirtschaftspolitischer und entwicklungspolitischer Instrumente (Besuchs-Diplo-
matie, Handelspolitik, Investitionspolitik, Entwicklungshilfe (Projekthilfe), Militärhilfe (Aus-
bildung) und kulturelle Zusammenarbeit), mit denen China die Beziehungen zu seinen afrika-
nischen Partnerländern zu fördern versteht. Eine höchst willkommene Alternative zu den Prä-
missen der westlichen Partnerländern stellt für viele afrikanische Länder der chinesische
Grundsatz dar, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines (in dem Fall afrikanischen) Part-
nerlandes einzumischen (d.h. u.a. über Menschenrechtsverletzungen hinwegzusehen). Wenn-
gleich diese Alternative durchaus einerseits gewünscht und befürwortet wird, so beschreibt sie
das Verhalten Chinas andererseits dennoch auch partiell als "neokolonialistisch". Für sie steht
fest, dass Chinas politische Präsenz auf der afrikanischen Weltbühne als kommende Weltmacht
Nummer eins den politischen Handlungsspielraum afrikanischer Regierungen vergrößert hat.
Intensiv hat sich Frau Nguébong-Ngatat bemüht, die Auswirkungen des chinesischen Engage-
ments auf Beschäftigung, Wachstum, Lebensqualität der Bevölkerung sowie auf das Wertesys-
tem, auf Demokratie und Umwelt abzuschätzen, und zwar unter der zentralen Fragestellung, ob
der Beitrag Chinas für die Realisierung der Entwicklungsziele Kameruns maßgeblich gewesen
sei, - was für die meisten Themen bejaht werden konnte. Gleichwohl übersieht sie dabei nicht
die bestehenden Ambivalenzen einer Politik, die von einem politisch und wirtschaftlich so po-
tenten Partner wie China unweigerlich ausgehen. Einerseits werden die chinesischen Experten
und Entwicklungshelfer von fast allen Befragten aus der Zivilgesellschaft und aus dem Regie-
rungslager als „glaubwürdig, fleißig, diszipliniert, kämpferisch, belastbar, bescheiden, kreativ,
leistungsstark und zielstrebig mit qualitativ hohen Arbeitsergebnissen bewertet“, andererseits
werden chinesische Methoden der Durchführung von Entwicklungsprojekten als zu sino-zen-
trisch kritisiert.
Abschließend kommt sie zu dem Ergebnis, dass Chinas Engagement in Kamerun als pragma-
tisch, partnerschaftlich und für beide Seiten als nützlich anzusehen sei. In 15 von 26 Aspekten
ihrer exemplarischen Wirkungsevaluierung konnte sie eine positive Wirkung feststellen, vor
VIII
allem beim wirtschaftlichen Wachstum und auf dem Arbeitsmarkt. Diese relativ positive Ent-
wicklungsbilanz hätte weitaus strahlender sein können – meint die Autorin -, wenn sich nicht
in Staat und Verwaltung Kameruns die endemisch gewordene Korruption so stark ausgebreitet
hätte. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass das starke chinesische Engagement zu
politischen Anreizen geführt hätte, dringend notwendige Strukturreformen in den staatlichen
Verwaltungsbetrieben zu vertagen.
Es handelt sich also um eine originelle, lesenswerte Studie über Stärken und Schwächen chine-
sischer Entwicklungshilfe aus der Sicht einer gebürtigen Kamerunerin, die zu spannenden Dis-
kussionen Anlass geben dürfte.
Prof. Dr. Siegmar Schmidt
Prof. Dr. Rainer Tetzlaff
IX
Vorwort
Im Laufe der zwei vergangenen Jahrzehnte wurden viele Ölvorkommen, Erdgas, Eisenerz, Dia-
manten, Holz und andere Rohstoffe in verschiedenen Ländern Afrikas entdeckt. Diese neue
Entdeckungen, der rasante Aufstieg Chinas und Indien zu Weltmächten, die Krisen zwischen
den USA und den Ländern des Persischen Golfs, die Erweiterung terroristischer Netzwerke
vom Nahen und Mittleren Ost auf Afrika treiben diesen Kontinent progressiv ins Zentrum des
Interesses internationaler Akteure, die sich nun in ihrer Afrikapolitik neu festlegen müssen.
Dieses Gerangel um Rohstoffsicherung verleiht Afrika nicht nur eine neue strategische Bedeu-
tung für die globale Sicherheit, sondern auch eine neue weltwirtschaftliche Bedeutung, die da-
rauf gründet, dass der Raum im Norden vom Tschad bis nach Angola im Süden und im Westen
bis zum Golf von Guinea in den letzten Jahren praktisch als „west-afrikanisches Öldreieck"
fungierte.
Gerade das afrikanische Öl, das inzwischen ca. 12% der Weltreserven beträgt, ist aus verschie-
denen Gründen begehrt: Erstens sind die Erschließungs- und Produktionskosten im internatio-
nalen Vergleich relativ günstig. Zweitens entspricht das Erdöl nicht nur den geltenden Quali-
tätsstandards, sondern ist wegen seines niedrigen Gehalts an Sulfid sehr nachgefragt auf dem
Markt. Drittens ist das Erdöl aufgrund der geographischen Lage an der Atlantikküste leicht zu
transportieren, insbesondere für Frankreich und die USA. Viertens unterliegen die meistens
Staaten Afrikas mit der Ausnahme Nigerias keine enormen institutionellen Beschränkungen,
da sie keine Mitglieder der OPEC sind. Fünftens haben die betroffenen Staaten keine dichten
historischen Beziehungen, die eine Aggregation ihrer Interessen derart erleichtern könnte, dass
sie sich gemeinsam z.B. durch ein Embargo oder die Bildung eines Erdölkartells gegenüber
größeren Mächten behaupten könnten und sechstens trägt das Erdöl aus Afrika zur Verwirkli-
chung der Diversifizierungsstrategie vieler Länder wie China, die das Öl für die Industrie be-
nötigen. Doch die Frage bleibt, wie afrikanische Staaten wie Kamerun aus diesem Interesse
vieler internationalen Akteure Kapital schlagen, wie sie dem besonderen Stil Chinas Rechnung
tragen, mit postkolonialer Unterdrückung und Demütigung abrechnen und ihre Bevölkerung
eigenständig zur nachhaltigen Entwicklung führen können. Die vorliegende Arbeit geht daher
weit über die in der Literatur bestehende Polarisierung über das Engagement Chinas in Afrika
hinaus und legt sowohl für das Zielland Kamerun als auch für die Konkurrenten, China, Frank-
reich und der EU, Handlungsoptionen nahe.
XI
Dafür, dass eine solche Arbeit fertig gestellt werden konnte, habe ich meinem Doktorvater,
Herrn Prof. Dr. Siegmar Schmidt, für seine unermüdliche Unterstützung zu verdanken. Seine
Anregungen und sorgfältige Kritik waren mir stets eine unschätzbare Motivationsquelle, insbe-
sondere in den Phasen meiner Arbeit, in denen ich manche Rückschläge eingesteckt hatte. Ein
besonderer Dank gebührt ebenfalls meinem Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. Rainer Tetzlaff,
für seine beruhigenden Worte und die Orientierung, die er stets für mich hatte.
Ich danke weiterhin meinen Interviewpartnern und weiteren Informanten, die hier aufgrund der
Wahrung der Anonymität der Interviews nicht genannt werden können. Meine Anerkennung
geht an viele kamerunische Ministerien, insbesondere das Referat „Zusammenarbeit mit Asien
und Schwellenländern“ des Außenministeriums (MINREX) und das Referat „Zusammenarbeit
und Entwicklung“ des Ministeriums für Wirtschaft und Raumplanung (MINEPAT), an die Ge-
neraldirektion „Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung“ der EU sowie ihre Auslands-
vertretung in Kamerun, die chinesische Botschaft in Kamerun, die Tageszeitungen Mutations
und Le Messager, die Verbände Dynamique Citoyenne, ACDIC und GICAM. Mein besonderer
Dank gilt ferner dem emeritierten Kardinal Christian Tumi für das herzliche Gespräch und den
zugesprochenen Mut. Dank der Mitwirkung all dieser Institutionen und Persönlichkeiten konnte
ich auf ein vielseitiges Forschungsmaterial zugreifen und somit mehr Substanz für meine Ar-
gumentation gewinnen.
Für die kritische Lektüre und viele Anregungen danke ich Dr. Florentin Saha Kamta, Dr. Sou-
lemanou Pepouna, Michelle Kremmelbein, Elise und Collinet Finjap Njinga, Marie Chantal
und Olivier Nlend. Einen besonderen Dank bin ich meiner Familie und meinen Freunden in
Kamerun verpflichtet, die mich während meiner Feldforschung vor Ort aufgenommen, das nö-
tige Instrumentarium für mein Weiterkommen bereitgestellt sowie dank einer unerwarteten
Übernahme und Teilung meiner anderweitigen Pflichten meinen Aufenthalt bedeutend erleich-
tert und meine Konzentration auf die Forschung gefördert hatten. Hochachtung zolle ich hierfür
besonders Florence und Dominik Fopoussi, Lisette und Vincent Tsopghui, Nathalie und Ray-
mond Njenga Wanji, Jocelyn und Augustin Tchoffo, Marie und Boniface Foudjo, Leopoldine
und Gabriel Teigou, Sylvie Kamta, Parfait Tabapsi, Appolinaire Tchoffo, Annie Kapcheu und
Cristelle Pola.
Zu guter Letzt danke ich meinem Mann Joel für seine Sorgsamkeit, sein Interesse an meiner
Forschung, seine guten Ratschläge und seine tatkräftige Unterstützung insbesondere bei der
XII