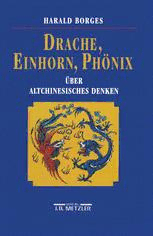Table Of ContentDrache, Einhorn, Phönix
Über altchinesisches Denken
Harald Borges
Drache, Einhorn, Phönix
Über altchinesisches Denken
J.
Verlag B. Metzler
Stuttgart · Weimar
Die Deutsche Bibliothek - CIP - Einheitsaufnahme
Borges, Harald:
/
Drache, Einhorn, Phönix : Über altchinesisches Denken
Harald Borges. -Stuttgart; Weimar : Metzler, 1993
ISBN 978-3-476-00841-1
ISBN 978-3-476-00841-1
ISBN 978-3-476-03415-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-03415-1
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 1993 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1993
EIN VERLAG DER SPEKTRUM FACHVERLAGE GMBH
Inhalt
Vorbemerkung
1
Einleitung
5
Frühe Schriften
Die vorkonfuzianischen Klassiker
17
Konfuzius
Ein Wanderleheer unter anderen
35
MoDi
Der Freund aller Menschen
55
Lao Zi
Der Alte auf dem Ochsen
79
Han Fei Zi
Politik statt Moral
103
Dang Zhongshu
Der vielleicht ein wenig wunderliche Liebhaber von
Katastrophen jeglicher Art
117
V
WangChong
Der Kritiker und Spötter
145
Chronologie
169
Anmerkungen
170
Nachbemerkungen/Literatur
176
VI
VORBEMERKUNG
Drachen, Einhörner und Phönixe wecken heitere Vorstellungen eines bun
ten, üppig bevölkenen Märchenzoos, und, wenn man die im altchinesischen
Denken ebenfalls oft bemühten Schildkröten hinzunimmt, vielleicht auch
verpönte kulinarische Gelüste. Doch das durch diese Fabelwesen heraufbe
schworene Bild eines friedlichen menschlichen Daseins in Harmonie mit ei
ner freigiebigen Natur täuscht gewaltig. Von Menschen, die in inniger, be
dachter Verbindung mit ihrer natürlichen wie gesellschaftlichen Umgebung
ein ausgeglichenes Leben gefühn und ein geradezu biblisches Alter erreicht
hätten, ist auch im alten China ebenso oft die Rede wie nicht die geringste
Spur zu finden. Unsere antiken Artgenossen waren weder besser noch weiser
oder gar glücklicher als wir, so gern man sich auch in die Traumbilder eines
Goldenen Zeitalters vor aller politischen Geschichte hineinphantasieren
möchte.
Statt dessen steht in den erhaltenen Texten seit etwa 3000 Jahren derwenig
poetische Kampf mit Hunger und Elend im Mittelpunkt. Bilder der mensch
lichen Gesellschaft wie des gesamten Kosmos trugen eher Züge einer univer
salen Verschwörung gegen den Menschen als eines traulichen Obdachs für
eine gelassene Existenz - was nicht weiter verwunden, wenn man bedenkt,
daß die Mehrheit unter erbärmlichsten, dem Sklaventurn nicht unähnlichen
Verhälrnissen ihr Leben zu fristen hatte. Hungerjahre, Kriege, Naturkatastro
phen und der alltägliche Terror ließen Angehörige fast aller Schichten in
nicht wenigen Zeugnissen die Utopie einer fernen, glückseligen Vergangen
heit heraufbeschwören und den Tod herbeisehnen. Wieviel literarische Ko
ketterie sich darin allerdings verbirgt, ist heute nicht mehr zu beuneilen.
Altchinesisches Denken ist, aus der Nähe betrachtet, weder weitabgewand
te Verinnerlichung noch esoterische Verklärung des Wahrgenommenen, son
dern ein ganz normaler Meilenstein der Geschichte der Menschheit in ihrem
Bemühen um Verstehen, Niederzwingen und Aneignen der Natur sowie um
humanere politische Verhältnisse.
Mißverständnissen sei hiermit vorgebeugt: Dieses Buch, für unvorbelastete
Leser geschrieben, handelt nicht nur vom gemeinhin als »klassisch« bezeich
neten chinesischen Denken in jener Epoche, die von den ersten schriftlichen
Dokumenten bis zur Einigung des Reiches -221 angesetzt zu werden pflegt.
Es greift vielmehr darüber hinaus bis ins +1. Jahrhunden, um die Verände
rung klassischen Denkens, als es eine politische Einrichtung wurde, darzustel
len, denn nur so sind die späte, geradezu märchenhafte Wirkung des Konfuzi
us, der von einem Wanderleheer unter vielen zum >>ungekrönten Kaiser Chi-
1
nas<< aufstieg, und die seltsame Position der gelehrten Beamten verständlich
zu machen. Diese posthume Karriere eines Denkers etwa drei Jahrhunderte
nach seinem Tod ist derart verblüffend verlaufen und auch für das westliche
Chinabild von so entscheidender Bedeutung, daß sie auf keinen Fall vom
Verständnis des klassischen Denkens zu trennen ist.
Es soll mit diesem Überblick nicht versucht werden, einen vollständigen
oder gar »gerechten<< Abriß altchinesischen Denkens zu geben im Sinne um
Objektivität bemühter ldeengeschichtsschreibung, die nie jemanden ausläßt,
sondern höchstens verschweigt. Im Mittelpunkt stehen vielmehr einzelne
Denker, die Richtungen tatsächlich begründeten oder als deren Ahnherren
betrachtet wurden, Gestalten, die auf jeden Fall als beispielhaft für verbreitete
Muster der Auseinandersetzung mit Lebenswirklichkeit gelten können. Ande
rerseits >>fehlen<< Autoren wie Xun Zi oder Zhuang Zi, die vielleicht unterhalt
samer oder philosophisch fruchtbarer sein mögen, aber im allgemeinen Be
wußtsein nie die Bedeutung eines Konfuzius oder eines Lao Zi erlangten.
>>Und ... in der Tat gälte es nur<<, wie Heimito von Doderer vermerkt, »den
Faden an einer beliebigen Stelle aus dem Geweb' des Lebens zu ziehen, und er
liefe durchs Ganze, und in der nun breiteren offenen Bahn würden auch die
anderen, sich ablösend, einzelweis sichtbar.«[!]
Dieses Buch handelt, wie es sich gehört, von nichts anderem als anderen
Büchern (die wesentliche Traditionen chinesischen Denkens begründet ha
ben), von einigen Männern, die sich beim erbarmungslosen Kampf für oder
gegen das Fortschreiten menschlicher Erkenntnis besonders beispielhaft her
vorgetan haben, und etlichen mehr oder weniger vielsagenden Legenden,
glückverheißenden Fabelwesen und schicksalsmächtigen Omen nebst dem
üblichen Inventar menschlicher Geschichte und Leidenschaften.
Aus dieser Perspektive vor allem auf die grundlegenden Denker ihrer Zeit,
deren Ruf nicht unbedingt ihrer tatsächlichen philosophischen Leistung ent
sprechen muß, und vor allem aus persönlicher Vorliebe für ihn steht Wang
Chong (+1. Jahrhundert) am Ende des Buches, der ebenso scharfzüngige und
respektlose wie geschwätzige Kritiker fast allen traditionellen Aberglaubens -
und nicht etwa deshalb, weil er in Europa trotz seiner aufklärerischen T en
denzen und umfassenden Gelehrsamkeit noch immer stiefmütterlich behan
delt wird; es geht wie gesagt nicht um posthume Gerechtigkeit. Wang Chong
lebte nach dem Aufstieg des Konfuzianismus zur Staatsdoktrin und seiner
gleichzeitigen Verbindung mit allen möglichen anderen, zum Teil äußerst ob
skuren Theorien, die den Jüngern des Konfuzius ihren Einfluß am Hofe und
in den Bildungseinrichtungen sicherten. Er schaute aus gebührendem Ab
stand auf die klassische Epoche und ihre Folgen zurück und machte sich dar
an, sie durchaus parteilich zu sichten und ihr als alleinstehende, herausragen
de und äußerst originelle Figur einige ihrer Inkonsequenzen höhnisch um die
2
Ohren zu hauen. So eignet er sich als Leitstern für eine etwas weniger gravitä
tische Sicht auf das eigentlich so ehrwürdige Altertum.
Und wie steht es nun mit Drachen, Einhörnern und Phönixen?
>>Ein Weiser wie Konfuzius kümmerte sich nicht ... [darum]. Wie wollen
dann gewöhnliche, für das Wunderbare voreingenommene Menschen etwas
darüber wissen, deren Kenntnisse mangelhaft sind und die nicht zu entschei
den vermögen, was möglich ist und was nicht?<<[2]
3
EINLEITUNG
I.
Vierhundert Gelehrte, bei eher mehr als minder lebendigem Leibe mit den
von ihnen so außerordendich verehrten eigenen Schriften oder solchen aus
der Vergangenheit beerdigt, stehen am Ende der klassischen Epoche chinesi
schen Denkens. Aber ihre Grablegung - sofern diese Beerdigung überhaupt
startgefunden hat, was nicht ganz unumstritten ist -war nicht nur eine histo
risch lange nachwirkende Mißhelligkeit, sondern markiert vor allem einen der
wichtigen Schnittpunkte chinesischer Geistesgeschichte: die gewaltsame Eini
gung der heterogenen chinesischen Einzelstaaten unter dem Herrscher der
Qin. Teile dessen, was heute als »China<< bezeichnet wird, waren um -221
zum ersten Mal seit legendärer Vorzeit ein nicht nur nominell einheitlich be
herrschtes Gebiet geworden.
Im Jahre -213 veranstaltete dieser Kaiser der Einigung, der legendäre Qin
Shi Huang Di, der sich jene berühmte, vieltausendköpfige Terracotta-Armee
in seine Grabanlage folgen ließ (ein Nachklang der schon damals wenigstens
in China anders als etwa in einigen Gegenden des Westens längst aus der
Mode gekommenen Sitte der Menschenopfer), ein Bankett anläßlich seines
Geburtstages. Er, der als erster ganz China nach jahrhundertelangen Kämpfen
zwischen einer Vielzahl von Kleinstaaten unter das Joch eines einzigen Herr
schers gezwungen harte und sich also mit einem gewissen Recht als »Erster
Kaiser« bezeichnete, war mit Unterstützung seines Kanzlers und wichtigsten
Beraters Li Si zu einer bis dato unbekannten Machtfülle gelangt. Aber er hatte
dabei auch bewußt von der teilweise traditionell-konfuzianischen Beatnten
und Gelehrtenschaft hochgehaltene Normen des gesellschaftlichen Umgangs
und der Regierungsführung verletzt -er trat nicht als Fortserzer und Bewahrer
der ruhmreichen Vergangenheit, sondern als radikaler Neuerer auf, der das
Herrschaftsmodell seines siegreichen Staates auf ganz China ausdehnen woll
te. Neben der uns heute erstaunlich modern und weitsichtig anmutenden
Regierungspraxis, welche die Vereinheitlichung der Maße, Gewichte, Schrift
zeichen und anderer technischer Normen unter dem Druck der Erfordernisse
einer zentralen Verwaltung dieses Riesenreiches einschloß, steht das Bild des
impulsiv grausamen Kaisers, das besonders durch die jenem Festakt folgenden
Vorfalle geprägt wurde. Daß Qin Shi Huang Di darüber hinaus abergläubisch
wie ein Waschweib war und wie eine ganze Reihe anderer Herrscher einer
Vielzahl von Scharlatanen Unsummen hinterherwarf, macht ihn aus unserer
Retrospektive zwar zu einer schillernden Persönlichkeit, war aber für die da-
5