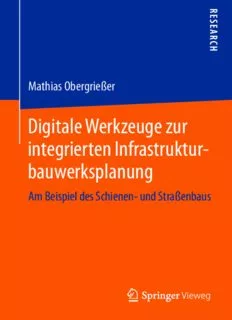Table Of ContentMathias Obergrießer
Digitale Werkzeuge zur
integrierten Infrastruktur-
bauwerksplanung
Am Beispiel des Schienen- und Straßenbaus
Digitale Werkzeuge zur integrierten
Infrastrukturbauwerksplanung
Mathias Obergrießer
Digitale Werkzeuge zur
integrierten Infrastruktur
bau werksplanung
Am Beispiel des Schienen und
Straßenbaus
Mathias Obergrießer
Regensburg, Deutschland
Dissertation Technische Universität München, 2016: Mathias Obergrießer: „Entwicklung von digi-
talen Werkzeugen und Methoden zur integrierten Planung von Infrastrukturbauwerken am Beispiel
des Schienen- und Straßenbaus.“
ISBN 978-3-658-16781-3 ISBN 978-3-658-16782-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-16782-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Vieweg
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem
Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren
oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige
Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Danksagung
Die vorliegende Arbeit entstand während meiner sechsjährigen Tätigkeit als wissenschaftlicher
MitarbeiteranderOstbayerischenTechnischenHochschule(OTH)Regensburg,FakultätBauin-
genieurwesensowieimZugemeinerkooperativenPromotionamLehrstuhlfürComputergestütz-
teModellierungundSimulationanderTechnischenUniversitätMünchen.VonAnfang2008bis
Ende 2010 entstand im Rahmen des von der bayerischen Forschungsstiftung finanzierten For-
schungsprojektes „ForBAU“ eine Vielzahl von Ideen, Konzepten und Forschungsergebnisse, die
ich in denletzten Jahren noch intensiver verfolgen undausarbeiten konnte.
An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit bei-
getragen haben. Meinen besonderen Dank gilt meinen Doktorvater Herrn Prof. Dr.-Ing. André
Borrmann, der mich in sein Forschungsteam aufnahm und mich bei vielen wissenschaftlichen
Fragestellungen, aber auch in anderen Situationen hervorragend unterstützte. Vor allem seine
Fähigkeit,komplexeThemenstellungenineinerverständlichenArtundWeisedarstellenzukön-
nen, begeisterte mich jedes Mal und ermöglichte mir, viele wissenschaftliche Fragestellungen
schnell lösen zu können. Trotz seiner Vielzahl an täglichen Terminen, nahm er sich immer Zeit
fürmich,ummitmirübermeinewissenschaftlichen,aberauchanwendungsorientiertenAnsätze
zu diskutieren. Dieses Engagement ist immer ein großer Anspornfür mich gewesen.
FürdieÜbernahmedesZweitgutachtens, sowie fürdiekonstruktiven Kritiken unddetaillierten
Hinweise zu meiner Arbeit, möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. U. Rüppel recht herzlich
bedanken.
Des Weiteren möchte ich mich bei meinem Drittgutachter und Betreuer von der OTH Regens-
burg, Herrn Prof. Dr.-Ing. Thomas Euringer für seine ständige Unterstützung während meiner
gesamten Forschungszeit bedanken. Er hat mich in vielen Bereichen sehr stark gefördert und
motiviert. Zudem hat er mir den nötigen Freiraum überlassen, der für die Bearbeitung meiner
wissenschaftlichenIdeenundKonzepteerforderlichwar.Besondershervorhebenmöchteichseine
Fähigkeiten, Probleme immer auf einen direkten Weg zu lösen sowie schwierige Situationen in
kürzester Zeit meistern zu können. Unsere langen und ausführlichen Diskussionen haben mich
in vielen Punktenmeiner Arbeitbestärkt.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Herrn Prof. Dr. rer. nat. Ernst Rank, der mich zu
Beginn meiner Promotionszeit betreute und mir den Einstieg in die kooperative Promotion an
seinemLehrstuhlComputationinEngineeringanderTechnischenUniversitätMünchenermög-
lichte.MeinenDankgiltauchHerrnProf.Dr.-Ing.AndreasMaurial,deralsDekanderFakultät
Bauingenieurwesen meine Arbeitan der OTH Regensburgförderte.
Außerdem möchte ich mich bei allen Kollegen an den beiden Lehrstühlen CMS und CiE sowie
an der OTH Regensburg für die familiäre Atmosphäre und das freundschaftliche Miteinander
bedanken. Besonderer Dank gilt jedoch Frau Hanne Cornils und Frau Monika Braunschläger,
die mit ihrem Verständnis und ihrem Einfühlungsvermögen einen wesentlichen Anteil an dem
sehr guten Arbeitsklima am Lehrstuhl bzw. der Fakultät haben. Besonders zu schätzen weiß
ichdiefachlichen GesprächemitdenverschiedenenKollegen. Diesermöglichte mir,Einblickein
VI
verschiedenetheoretische, aberauchpraxisorientierte AnsätzeundStandpunkte.Dabei möchte
ichvorallemmeinemlangjährigenZimmerkollegenYangJifürdiezahlreichenundinteressanten
Diskussionen danken.
Meinen Eltern Johann und Marille Obergrießer möchte ich für ihre ständige Unterstützung
während meines Studiums und meiner anschließenden Promotionszeit danken. Durch ihre Un-
terstützungkonnte ich mich voll auf meine wissenschaftlichen Aufgaben konzentrieren.
Ganz besondersbedanken möchte ich mich bei meiner Frau Stefanie Obergrießer, diemir wäh-
rend der gesamten arbeitsintensiven Promotionszeit zur Seite stand und mich stets bei meinen
Entscheidungenunterstützthat.NatürlichsollihrwertvollerRatbeiderKorrekturdieserArbeit
nicht unerwähntbleiben.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis VII
1 Einführung in die Thematik 1
1.1 AusgangspunktundMotivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Konventioneller und modellgestützter Planungsprozess im Infrastrukturbau 5
2.1 Status quo in derInfrastrukturplanung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.1 ProzesszurPlanungeinerInfrastrukturmaßnahmeimStraßen-undSchie-
nenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.1.1 Prozess der Vermessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1.2 Prozess der Trassenplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1.3 Prozesse der Baugrunduntersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1.4 Prozess der Ingenieurbauwerksplanung . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 Beurteilung des Planungsprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Verwandte Arbeiten - BIM im Hochbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1 Beurteilung der Einsatzfähigkeit von BIM im Infrastruktursektor . . . . . 18
2.3 PlanungsgrundlagenzurModellierungeinesparametrisch-assoziativenInfrastruk-
turinformationsmodells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.1 Datenschnittstellen im Infrastrukturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.2 Erforderliche Anpassungen im Planungsprozess der Baugrunderkundung,
der Trassenplanungundder geomechanischen Analyse . . . . . . . . . . . 23
2.3.2.1 Modellierungeines3D-Baugrundinformationsmodells–Ansätze,
Methoden unddigitale Werkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.2.2 Baugrund-spezifischeErweiterung des Trassenplanungsprozesses 32
2.3.2.3 Trassen-baugrund-spezifischerIntegrationsansatzzurUmsetzung
eines geomechanischen Analyseprozesses . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3 Grundlagen der geometrischen Modellierung 39
3.1 Definition verschiedener geometrischer 2D-/3D-Grundprimitive . . . . . . . . . . 40
3.1.1 Grundprimitivein R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.1.1 Punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.1.2 Kurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VIII Inhaltsverzeichnis
3.1.1.3 EignungvonB-Spline-KurvenzurKonstruktioneines3D-Trassen-
verlaufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1.2 Grundprimitivein R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2 Geometrische Modellrepräsentationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.1 Kantenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.2 Flächenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.3 Volumenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.3.1 Definition eines Boundary-Representation-Modells (BRep) . . . 51
3.2.3.2 Definition eines Constructiv-Solid-Geometry-Modells (CSG) . . 54
3.2.3.3 Definition eines Sweep-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.4 Vor- undNachteile der verschiedenen Repräsentationsformen . . . . . . . 56
3.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4 Parametrisch-assoziative Modellierungsansätze 59
4.1 Grundlagen zur assoziativen Modellkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.1 Historien-freie Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.2 Historienbasierte Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.3 Ansätze zur Umsetzung einer assoziativen Kopplung . . . . . . . . . . . . 62
4.2 Parameterdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3 Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.3.1 Constraints in R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3.1.1 Logische Constraints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3.1.2 Dimensionale Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.3.1.3 Algebraische Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.3.2 Constraints in R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.3.2.1 Indirekte3D-Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.3.2.2 Direkte 3D-Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.3.3 Parametrisierungszustand eines Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3.3.1 Beispiel eines parametrisch voll-bestimmten Modells in R2 . . . 84
4.4 Methode der direkten Freiheitsgradanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.1 Freiheitsgrade der geometrischen Primitive in R2 . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.2 Analyse der reduzierten Freiheitsgrade in R2 . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.4.3 Direkte Freiheitsgradanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.4.4 Beispiele der direkten Freiheitsgradanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.5 Methoden der constraint-basierten Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5.1 Prozedural-parametrischer Modellierungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.5.2 Variationaler Modellierungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.5.3 Hybrides Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.6 Constraint-Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.6.1 Algebraischer Ansatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.6.2 Regel-basierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.6.3 Theorem-proving Ansatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.6.4 Grafen-basierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.6.4.1 Analyse derFreiheitsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.6.4.2 Ansatz der Constraint-Propagation . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.6.4.3 Konstruktiver Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Inhaltsverzeichnis IX
4.6.5 Analyse der bestehendenVerfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.7 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5 Grundlagen zur Definition eines infrastruktur-spezifischen Modellierungs-
leitfadens 135
5.1 Allgemeine Modellierungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.1.1 Produkt-spezifischeModellierungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.1.2 Produkt-neutraleModellierungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.2 Aufbau einer infrastruktur-spezifischenModellstruktur . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.2.1 Steuerungsebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.2.2 Baugruppenebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2.3 Bauteilebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2.4 Teileebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.3 Automatisierung von Konstruktionsprozessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.3.1 Komplexität von Konstruktionsprozessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.3.2 Automatisierungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.3.3 Softwaretechnische Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.3.3.1 SystemunabhängigeKonstruktionssystem . . . . . . . . . . . . . 147
5.3.3.2 SystemgebundeneKonstruktionssystem . . . . . . . . . . . . . . 148
5.3.4 Beurteilung der Automatisierungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6 Konzepte zur Umsetzung des parametrisch-assoziativen Infrastrukturinfor-
mationsmodells 153
6.1 Komponenten des PIM-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.2 Konzepte zurModellierung eines Infrastrukturmodells . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.2.1 Allgemeingültige Modellierungskomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.2.2 Konzept zur Modellierung des 3D-Trassen-Baugrund-Modells . . . . . . . 160
6.2.2.1 AusführlicheBeschreibungdes automatisierten 3D-Trassen-
BaugrundModellierungskonzeptes . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2.2.2 Fazit des Automatisierungsansatzes . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.2.3 Konzept zurModellierungerdstabilisierender 3D-Bauwerks- undBaugru-
benmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.2.4 Konzept zur Modellierung des 3D-Brückenmodells . . . . . . . . . . . . . 176
6.2.4.1 Ausführliche Beschreibung des brücken-spezifischen Modellie-
rungskonzeptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
7 Anwendungsbeispiele aus der Praxis 193
7.1 Validierungdesinfrastruktur-spezifischenModellierungsleitfadensamBeispielei-
ner Straßentrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.1.1 Konzept zur automatisierten 3D-Trassen-Baugrundmodellierung . . . . . 194
7.1.2 Konzept zur geomechanischen Profilanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.1.3 Konzept zur 3D-Brückenbauwerksmodellierung . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.2 Validierung der Methode zur direkten Analyse der Freiheitsgrade am Beispiel
eines Rettungsschachtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
X Inhaltsverzeichnis
7.2.1 Konzept der direkten Freiheitsgradanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
7.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8 Zusammenfassung und Ausblick 215
8.1 ZusammenfassungderArbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Literaturverzeichnis 219
A Anhang 241
Description:Der Autor entwickelt neue digitale Werkzeuge und Methoden, die eine durchgängige und integrierte Planung einer Infrastrukturmaßnahme anhand eines föderierten Modells ermöglichen. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze vorgestellt, die eine Erweiterung der traditionellen Planungsprozesse vors