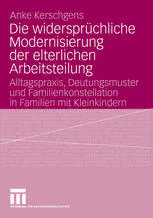Table Of ContentAnke Kerschgens
Die widersprüchliche Modernisierung
der elterlichen Arbeitsteilung
Anke Kerschgens
Die widersprüchliche
Modernisierung
der elterlichen
Arbeitsteilung
Alltagspraxis, Deutungsmuster
und Familienkonstellation
in Familien mit Kleinkindern
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
D.30
.
1.Auflage 2009
Alle Rechte vorbehalten
© VSVerlag für Sozialwissenschaften | GWVFachverlage GmbH,Wiesbaden 2009
Lektorat:Katrin Emmerich / Marianne Schultheis
VS Verlag für Sozialwissenschaften ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werkeinschließlichallerseiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohneZustimmungdes Verlags unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Satz:Anke Vogel,Ober-Olm
Druck und buchbinderische Verarbeitung:Krips b.v.,Meppel
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in the Netherlands
ISBN 978-3-531-16368-0
Danksagung
Zum Gelingen der Arbeit haben mehrere Personen in unterschiedlicher Weise
beigetragen. So möchte ich insbesondere meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. Hans
Bosse für seine vielfältigen Inspirationen, die langjährige Förderung, den eröffne-
ten Diskussionszusammenhang und seine wohlwollende Haltung Dank sagen.
Mein Dank gilt auch meinen Zweitgutachter Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, der ein
offenes Ohr hatte und mir mit seinen reflektierten Antworten an entscheidenden
Stellen weiterhelfen konnte. Bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Karin
Flaake, die kurzfristig bereit war ein weiteres Gutachten zu übernehmen. Beson-
ders Bedanken möchte ich mich weiterhin bei den Frauen meiner Arbeitsgruppe
und der Methoden-AG Dr. Marga Günther, Julia Jancso, Brigitte Kesseler, Sylvia
Mosler und Dr. Inge Schubert für die langjährige Zusammenarbeit, ihre Verläss-
lichkeit und die fruchtbaren Diskussionen. Mein Dank gilt darüber hinaus auch
den Teilnehmern des Forschungskolloquiums in der Anfangsphase der Arbeit und
hier insbesondere Prof. Dr. Vera King. Auch bei Prof. Dr. Annelinde Eggert-
Schmid Noerr möchte ich mich sehr bedanken dafür, dass sie mit kluger Gelas-
senheit und Humor den Abschluss der Arbeit begleitet hat. Nicht zuletzt möchte
ich Jan Jacobsen für seine Beständigkeit danken, die nicht nur das Zusammenle-
ben als Familie mit trägt, sondern auch den Kopf für die Arbeit freimacht.
Danken möchte ich auch allen Teilnehmern der Forschungsgespräche, die
mir einen Einblick in ihr Leben als Paar und Familie gewährt haben, mir von
dessen schönen, anstrengenden, bereichernden, leichten und komplizierten Seiten
erzählt haben und ohne die diese Forschungsarbeit nicht möglich gewesen wäre.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung.............................................................................................11
2 Arbeitsteilung in Familien – Zum Stand der Forschung.................15
2.1 Zum Verhältnis von Beruf und Familie.................................................16
2.1.1 Kontinuität und Wandel der Arbeitsteilung...........................................16
2.1.2 Zur weiblichen Doppelorientierung......................................................19
2.1.3 Männer zwischen Beruf und Familie....................................................23
2.1.4 Verhandlungsspielräume und -probleme...............................................27
2.2 Fallrekonstruktive Untersuchungen zur Arbeitsteilung.........................30
2.3 Psychoanalytische Ansätze zur Arbeitsteilung......................................40
2.4 Triadische Theorien der Familie und familiale Beziehungsstrukturen..45
2.4.1 Triangulierungsthemen und -konflikte von Eltern................................47
2.5 Diskussion und Zusammenfassung.......................................................56
3 Der Forschungsansatz.........................................................................57
3.1 Deutungsmuster.....................................................................................57
3.1.1 Theorie des Deutungsmusterkonzepts...................................................57
3.1.2 Deutungsmuster als Untersuchungskategorie........................................60
3.1.3 Deutungsmuster der elterlichen Arbeitsteilung.....................................62
3.2 Unbewusste Beziehungsmuster.............................................................68
3.2.1 Repräsentanzen und Identifikationen....................................................69
3.3 Diskussion und Verbindung: Individualität und Sozialität des nicht
bewussten und unbewussten Entwurfes................................................73
4 Forschungsmethode............................................................................77
4.1 Situierung der Ethnohermeneutik..........................................................77
4.2 Die Forschungssituation........................................................................78
4.3 Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion: Differenzierung und
Integration verschiedener Rekonstruktionsdimensionen.......................79
4.4 Situation der Forschung und Modifikation der Gesprächsmethode......84
8 Inhaltsverzeichnis
5 Fallrekonstruktionen..........................................................................87
5.1 Forschungssituation und Situierung der Forschungsteilnehmer............87
5.2 Familie Lehmann: Ein Entwurf mit traditionell-hierarchischer
Arbeitsteilung........................................................................................89
5.2.1 Zum Gesprächsinhalt.............................................................................89
5.2.2 Rekonstruktion der Initialszene.............................................................92
5.2.3 Rekonstruktion der Szene „Vaterrolle“...............................................101
5.2.4 Zusammenfassung und Diskussion: Der Lebensentwurf von
Familie Lehmann................................................................................112
5.3 Familie Bruckner: Ein Entwurf mit egalitärer und
familienzentrierter Arbeitsteilung.......................................................116
5.3.1 Zum Gesprächsinhalt...........................................................................116
5.3.2 Rekonstruktion der Initialszene...........................................................119
5.3.3 Erweiterte Initialszene: „Alltag und Entscheidung für die
Arbeitsteilung“....................................................................................128
5.3.4 Szenische Rekonstruktion...................................................................137
5.3.5 Zusammenfassung und Diskussion: Der Lebensentwurf von
Familie Bruckner.................................................................................142
5.4 Familie Hansen: Berufszentrierte Arbeitsteilung auf traditioneller
Basis....................................................................................................145
5.4.1 Zum Gesprächsinhalt...........................................................................146
5.4.2 Rekonstruktion der Initialszene...........................................................147
5.4.3 Rekonstruktion der Szene „Eltern von kleinen Kindern sein“............158
5.4.4 Zusammenfassung und Diskussion: Der Lebensentwurf von
Familie Hansen....................................................................................171
5.4.5 Ähnliche Muster..................................................................................175
5.4.5.1 Kurzportrait: Familie Berg..................................................................175
5.4.5.2 Kurzportrait: Familie Gerhards...........................................................178
5.5 Familie Baumeister/Schneiders: Integrationsbewegungen auf
Basis traditioneller elterlicher Arbeitsteilung......................................181
5.5.1 Zum Gesprächsinhalt...........................................................................181
5.5.2 Rekonstruktion der Initialszene...........................................................184
5.5.3 Rekonstruktion der Szene „Arbeitsteilung“........................................192
5.5.4 Zusammenfassung und Diskussion: Der Lebensentwurf von
Familie Baumeister/Schneiders...........................................................206
5.5.5 Ähnliche Muster..................................................................................210
5.5.5.1 Kurzportrait: Familie Moser................................................................210
5.5.5.2 Kurzportrait: Familie Diel-Frey/Frey..................................................213
5.5.5.3 Kurzportrait: Familie Andel................................................................216
5.5.5.4 Kurzportrait: Familie Elzenheimer/Koch............................................218
Inhaltsverzeichnis 9
6 Zur Widersprüchlichkeit der Modernisierung der elterlichen
Arbeitsteilung....................................................................................223
6.1 Diskussion der Einzelfälle als typische Muster...................................223
6.2 Ergebnisse...........................................................................................236
6.2.1 Die Modernisierung der gesellschaftlichen Deutungsmuster
elterlicher Arbeitsteilung.....................................................................237
6.2.2 Die Bedeutung des unbewussten Entwurfs.........................................239
6.2.3 Die triadische Balance und Zuweisung von Autonomie und
Bindung...............................................................................................240
6.3 Schluss: Altes und Neues....................................................................243
7 Literatur.............................................................................................245
1 Einleitung
Über die Arbeitsteilung in Familien wurde bereits vieles geschrieben und veröf-
fentlicht. Es besteht jedoch eine entscheidende Forschungslücke, die die vorlie-
gende Arbeit füllen möchte: In den vorwiegend soziologischen Analysen bleibt
die Arbeitsteilung als ein Thema des Paares und dessen Beziehung definiert und
es wird nicht die familiale Konstellation als Ganzes in den Blick genommen. Es
gilt jedoch, um das Phänomen der Arbeitsteilung zu verstehen, eine Perspekti-
ventriangulation vorzunehmen dahingehend, dass das Paar auch als Elternpaar
gesehen wird, dass nicht nur die Praxis, sondern auch die unbewusst verankerte
Beziehungskonstellation untersucht wird und dass in diesem Sinne Arbeitstei-
lung als elterliche Arbeitsteilung mit einer gesamtfamilialen Zuweisung be-
stimmter Positionen verstanden werden kann. Dabei gilt es, neben soziologi-
schen Erkenntnissen und Untersuchungsperspektiven auch psychoanalytische
Verstehensweisen einzubeziehen. Dies möchte ich im Folgenden näher erläutern.
Die elterliche Arbeitsteilung ist Teil des institutionell wie auch in Deutun-
gen und Bildern verankerten gesellschaftlichen und historisch gewachsenen, sich
wandelnden Geschlechterverhältnisses. Dieses bietet einen Handlungsrahmen für
die interaktive Aushandlung der Frage „Wer macht was?“ zwischen Mann und
Frau in einer Paarbeziehung. Die Untersuchung der elterlichen Arbeitsteilung
geht jedoch über die Betrachtung der Organisation von Erwerbsarbeitszeiten und
Hausarbeitsanteilen hinaus, denn neben dem Beziehungsverhältnis von Mann
und Frau werden auch die Positionen als Vater und Mutter gegenüber den Kin-
dern in der Familie als relevant für die Form der Arbeitsteilung erachtet. Es sind
also nicht nur kognitive Vorstellungen und innere Bilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit entscheidend dafür, wie die Erwerbs- und Familienarbeit im Rah-
men der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich bestimmten Handlungs-
möglichkeiten zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird. Vielmehr gilt es
auch, Bilder von Mütterlichkeit und Väterlichkeit und vor allem auch die lebens-
geschichtlich verankerte innere Haltung gegenüber dem Kind wie auch gegen-
über dem Beruf zu betrachten. Dabei geht es nicht allein um die Position der
Einzelnen oder des Paares, sondern diese Positionen sind im Sinne eines gemein-
samen elterlichen Familienentwurfes zu betrachten, der sowohl die bewussten
Einstellungen und Situationsdeutungen als auch die unbewusste familiale Kons-
tellation umfasst. Diese Konstellation ist triadisch zu verstehen in dem Sinne,
12 1 Einleitung
dass die Bindung und Beziehung zwischen zweien immer auch in Abhängigkeit
zur Position des Dritten steht, konkreter gefasst, der unbewusste Entwurf einer
Familie allen Familienmitgliedern eine spezifische Position zuweist und Bindung
und Autonomie dabei für alle Beteiligten in einer besonderen Weise konstruiert
und zugewiesen werden. Die Organisation der Alltagspraxis in einer Familie
kann somit nicht unabhängig von der inneren triadischen Beziehungsfigur bzw.,
auf das Paar bezogen, der elterlichen Beziehungskonstellation betrachtet werden.
Die Aufteilung und Gewichtung der Erwerbsarbeit und Familienarbeit ist viel-
mehr durch die inneren Bindungsmuster von Vater und Mutter an das gemein-
same Kind mitbestimmt.
Um das Zustandekommen einer bestimmten Lebens- und Arbeitsteilungs-
form eines Elternpaares zu verstehen, gilt es somit verschiedene Untersuchungs-
ebenen zu eröffnen und die unterschiedlichen Bedingungsfaktoren in ihrem Zu-
sammenwirken zu untersuchen: In welcher Form wirken gesellschaftliche
Strukturen und deren Deutung auf den familialen Entwurf? Wie sieht das Paar
sich selbst und seine Praxis und auf welchen Deutungen und Interpretationen
beruht diese Sicht? Welche inneren Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit,
Mütterlichkeit und Väterlichkeit entfalten ihre Wirkung? Welcher unbewusste
triadische Bindungs- und Autonomieentwurf bzw. welche familiale Konstellati-
on liegt dem zugrunde?
Über den Einzelfall hinausgehend, stellt sich die Frage, welche inneren und
äußeren Handlungsspielräume Paare bzw. Familien heute im Kontext widersprüch-
licher Modernisierungsprozesse des Geschlechterverhältnisses bei der Gestaltung
ihres alltagspraktisch verankerten Lebensentwurfes haben. Dabei ist von entschei-
dendem Interesse, wie äußere – gesellschaftliche – und innere – lebensgeschicht-
lich bestimmte – Modernisierungs- und/oder Retraditionalisierungsprozesse zu-
sammenwirken oder gegenläufig sind und wie das gerade in Bezug auf die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung oft konstatierte ambivalente Verhältnis von
Wandel und Reproduktion alter Verhältnisse zustande kommt. Gesellschaftliche
Modernisierungsprozesse können grundsätzlich einerseits individuelle Entwick-
lungsräume eröffnen, andererseits können die oftmals widersprüchlichen Struktu-
ren des gesellschaftlichen Wandels individuelle Neubildungsprozesse verhindern.
Es geht somit um die auf die Arbeitsteilung bezogene Untersuchung der Verwo-
benheit von individuellen, familialen und kollektiven Sinnbildungsprozessen. Aus-
gehend von einem solchermaßen differenzierten Blick auf Modernisierungsprozes-
se, sollen äußere, gesellschaftliche Modernisierungsprozesse gleichzeitig mit der
Möglichkeit innerer Modernisierung, d.h. der Starrheit oder Entwicklungsfähigkeit
von die Arbeitsteilung ebenso bestimmenden unbewussten Familienentwürfen
untersucht werden.
1 Einleitung 13
Die hier aufgeworfenen Fragen sind Gegenstand der vorliegenden For-
schungsarbeit. In deren Mittelpunkt steht die ethnohermeneutische Rekonstrukti-
on von zehn Einzelfällen der in Forschungsgesprächen festgehaltenen Lebens-
entwürfe von Familien mit jeweils einem Kind im Kleinkindalter. Alle Familien
stammen aus einem gebildeten Mittelschichtsmilieu und können als Gruppe
insofern prinzipiell zunächst als Befürworter von modernisierten Gleichheitsvor-
stellungen wie auch einer partnerschaftlich verstandenen Arbeitsteilung gelten.
Von daher sind diese Familien für die Untersuchung des komplexen Verhältnis-
ses von Stagnation und Wandel besonders interessant. Eltern eines Kleinkindes
zu sein, bringt zudem besondere Betreuungsnotwendigkeiten wie auch Bin-
dungsanforderungen mit sich, dies verschärft die Frage der Arbeitsteilung zwi-
schen den Eltern, weswegen auch dieses Merkmal der Forschungsteilnehmer sie
für eine Untersuchung besonders interessant macht. Die Alltagspraxen der be-
fragten Familien reichen von der parallelen Elternzeit, bei der beide Eltern in
Teilzeit berufstätig sind, bis zum klassischen Modell mit einem männlichen
Ernährer und einer Hausfrau. Dabei kann gerade in der mehrdimensionalen Re-
konstruktion die jeweilige Doppelsinnigkeit und Vielschichtigkeit der einzelnen
Entwürfe deutlich werden und, damit verbunden, können auch latente Gemein-
samkeiten und Differenzen zwischen den zunächst ähnlich oder auch unter-
schiedlich erscheinenden Entwürfen zum Vorschein kommen.
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:
In Teil 2 erfolgt zunächst eine Zusammenstellung von Forschungsergebnissen
zur Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, die vor allem die gesellschaft-
liche wie subjektive Konstitution des Verhältnisses der Bereiche Beruf und Fa-
milie herausstellt. Dieser Überblick geht der Frage nach, in welcher Weise das
Verhältnis von Wandel und Stagnation, bezogen auf die gesellschaftliche Orga-
nisation von Beruf und Familie, heute bestimmt ist und welche Möglichkeiten
oder gar Notwendigkeiten sich für Männer und Frauen in Hinblick auf die all-
tagspraktische und innerlich verankerte Vermittlung beider Bereiche bieten.
Daran schließt sich eine kritische Diskussion relevanter, vor allem fallrekon-
struktiver Forschungsarbeiten zum Thema an, anhand derer Forschungslücken
und Anknüpfungspunkte für die interdisziplinäre Herangehensweise der vorlie-
genden Untersuchung erkennbar werden. Insbesondere geht es um die Frage, wie
unterschiedliche gesellschaftliche und subjektbezogene Untersuchungsebenen
differenziert und aufeinander bezogen werden. Es folgt eine Sichtung der psy-
choanalytischen Literatur zur elterlichen Arbeitsteilung und insbesondere auch
zur Triangulierung, um ein Verständnis für die in der soziologischen Forschung
weitgehend vernachlässigte Sicht auf die familiale, unbewusste Beziehungskons-
tellation zu eröffnen.