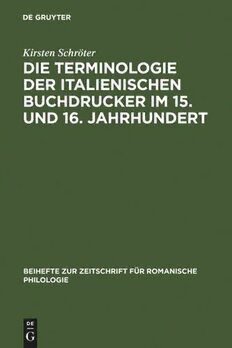Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
FORTGEFÜHRT VON
WALTHER VON WARTBURG UND KURT BALDINGER
HERAUSGEGEBEN VON MAX PFISTER
Band 290
KIRSTEN SCHRÖTER
Die Terminologie der
italienischen Buchdrucker
im 15. und 16. Jahrhundert
Eine wortgeschichtliche Untersuchung mit
besonderer Berücksichtigung von Venedig
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1998
D 291
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
[Zeitschriftför romanische Philologie / Beihefte]
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie. - Tübingen : Niemeyer
Früher Schriftenreihe
Reihe Beihefte zu: Zeitschrift für romanische Philologie
NE: HST
Bd. 290. Schröter, Kirsten: Die Terminologie der italienischen Buchdrucker im 15. und 16.
Jahrhundert. - 1998
Schröter, Kirsten:
Die Terminologie der italienischen Buchdrucker im 15. und 16. Jahrhundert : eine wortge-
schichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung von Venedig / Kirsten Schröter. -
Tübingen : Niemeyer, 1998
(Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie ; Bd. 290)
ISBN 3-484-52290-9 ISSN 0084-5396
© Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 1998
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in
Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten
Einband: Industriebuchbinderei Norbert Klotz, Jettingen-Scheppach
Inhalt
0. Vorwort VII
1. Einleitung l
1.1. Die Druckkunst im 15. und 16. Jahrhundert l
l .2. Die Vorläufer der Druckkunst 2
l .3. Ausgangspunkt und Zielsetzung der Arbeit 4
1.4. Die Druckerfachsprache im 15. und 16. Jahrhundert 5
1.5. Ein Vergleich mit Wolf 7
l .6. Die Dokumente 8
1.7. Die Artikel 10
1.8. Der sachgeschichtliche Hintergrund 11
1.8.1. Die Herstellung der Typen 11
1.8.2. Die verwendeten Metalle 12
1.8.3. Der Satz 12
1.8.4. Der Aufbau der Druckpresse 12
1.8.5. Der Druckvorgang 13
1.8.6. Die Drucküberwachung 14
1.8.7. Die Druckerschwärze 14
1.8.8 Der Bedruckstoff 15
1.8.9. Das Format 15
1.8.10. Der Buchschmuck 16
1.8.11. Der Aufbau des Buches 17
1.8.12. Die Schriftarten 17
1.8.13. Das Buch 18
2. Glossar 20
3. Anhang 264
4. Bibliographie 330
4.1. Primärliteratur 330
4.2. Sekundärliteratur 334
V
0. Vorwort
Die Idee zu dieser Arbeit lieferte eine Untersuchung der Fachsprache der Drucker
in der Renaissance fiir den französischen Sprachraum von Lothar Wolf. Mein
Lehrer, Prof. Max Pfister, brachte mich auf den Gedanken, eine ähnliche Unter-
suchung für das italienische Sprachgebiet anzustellen.
Meine Literaturrecherche führte mich u.a. in die Spezialbibliothek des
Gutenberg-Museums in Mainz, die Spezialbibliothek des Deutschen Buch- und
Schriftmuseums der Deutschen Bücherei in Leipzig und die Bibliothek der
Scuola Normale Superiore in Pisa. Von besonderer Bedeutung war ein Aufenthalt
in Venedig, in dessen Verlauf ich Gelegenheit hatte, in der Biblioteca Nazionale
Marciana und der Bibliothek der Fondazione Scientifica Querini Stampalia zu
arbeiten.
Die Untersuchung wurde dann mit Hilfe der Arbeitsmaterialien des LEI
fertiggestellt. Dies betraf insbesondere die verschiedenen Wörterbücher, die im
LEI ausgewertet sind und die das Material zu der sogenannten Komplettierung
liefern.
Daß diese Arbeit entstanden ist, verdanke ich v.a. den hilfsbereiten Mit-
arbeitern der Bibliotheken, in denen ich gearbeitet habe. Ich möchte dabei ins-
besondere Frau Reuschel von der Deutschen Bücherei in Leipzig danken, die mir
in zuvorkommender Weise das Material ihrer Bibliothek erschlossen hat. Zu
Dank verpflichtet bin ich auch Gabriella De Mitri-Eljojo, die meine Arbeit
Korrektur gelesen hat und v.a. die italienischen Passagen überprüft hat. Gleich-
zeitig möchte ich die unterstützende Arbeit von Marcus Hahn aus Saarbrücken
hervorheben, der alle für mich anfallenden technischen Probleme in vorbildlicher
Weise gelöst hat.
Den größten Dank möchte ich allerdings meinem Lehrer, Max Pfister, zollen,
der meine Arbeit sehr zielgerichtet geleitet hat und dem meine Hochachtung gilt.
Kirsten Schröter
VII
l. Einleitung
1.1. Die Druckkunst im 15. und 16. Jahrhundert
Arn 18. September 1469 wird dem Deutschen Giovanni da Spira ein Privileg über
fünf Jahre zur ausschließlichen Ausübung des Druckhandwerks gewährt (Lowry
7). Dieses Privileg steht am Beginn einer Entwicklung, die Venedig zum führen-
den Zentrum in der Produktion gedruckter Bücher macht1. Bis zum Ende des 15.
Jahrhunderts hatten in Venedig 150 Druckereien 4000 Bücher herausgebracht,
d.h. doppelt so viel wie Paris. Die Produktion in Venedig machte in jener Zeit
zwischen 1/8 und 1/7 des gesamten europäischen Outputs aus (ib. 7 u.f.).
Venice may not have been even the first city in Italy to establish a printing industry: but the
amazing expansion of that industry, once established, leaves no doubt that Venice was the
first city in the world to feel the full impact of printing, and to experience the most important
revolution in human communications between the development of letter-symbols some time
in the fourth millennium before Christ and the emergence of electronic mass-media in our
own age (ib. 8; siehe zur Buchproduktion in Venedig und den übrigen Zentren des Buch-
drucks in Italien TrovatoStorLinglt 20-22).
Die Blüte der italienischen Druckkunst währte bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts,
ein Zeitpunkt, der gekennzeichnet war vom Niedergang der deutschen und italie-
nischen Typographie und dem Aufstieg der Druckkunst in Frankreich und den
Niederlanden (Steinberg 17).
Die Mitte des 16. Jahrhunderts kennzeichnet eine weitere Veränderung, nun
in bezug auf die technischen und organisatorischen Aspekte der Druckkunst: in
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts waren im Gegensatz zur folgenden Zeit die Aufgaben von Schriftgießer,
Drucker, Herausgeber, Korrektor und Buchhändler noch nicht so stark geschie-
den. Dieselbe Person oder derselbe Gesellschafter übte alle oder mehrere dieser
Tätigkeiten gleichzeitig aus (SantoroStampaltaliaCinquecento 4 n4). Ebendiese
Tatsache - nur in einen weiteren zeitlichen Rahmen gefaßt - erklärt auch die
Berechtigung einer Festlegung der zeitlichen Grenze des vorliegenden Betrach-
tungszeitraums auf das Ende des 16. Jahrhunderts (siehe Wolf 9). Fahy,Santoro-
StampaltaliaCinquecento 312:
' Zur Kontroverse über Nutzen und Schädlichkeit der Druckkunst in der Renaissance siehe
Lowry 24-38. Interessant die Aussage von Rizzo 69: «II libro a stampa non era insomma per
gli umanisti nient'altro ehe un codice scritto con tecnica diversa, <novo scribendi genere>...».
l
II Cinquecento segno la fine del periodo eroico della storia tipografica, e vide il consolidarsi
della nuova industria su solide basi economiche, con 1'avvento della specializzazione nella
fabbricazione dei caratteri, originariamente intrapresa dagli stessi tipografi, e con la tendenza
verso la delimitazione sempre piu netta dei mestieri di tipografo, editore e libraio2.
1.2. Die Vorläufer der Druckkunst
Entgegen einer vordergründig einleuchtenden Idee ist die Herstellung von Bü-
chern mit beweglichen Lettern nicht eine Erfindung, die von der Technik des
Holzschnitts inspiriert ist (Audin,GutJb 13). Vielmehr kamen die Anregungen zu
den zentralen Neuerungen, die den Buchdruck prägen, aus dem Bereich der
Goldschmiede und Münzprägung (ib. 15; siehe dazu auch AudinSommetyp I,
134—184 und FebvreMartin 12). Sprachlich ist dies zu erkennen an der Tatsache,
daß literarisch zahlreiche Termini technici der Buchdruckkunst chronologisch
zeitgleich auch für die Bereiche der Goldschmiedekunst und der Münzherstellung
belegt sind3.
Die drei zentralen Erfindungen des Buchdrucks, die beweglichen Lettern, die
Druckerschwärze und die Druckpresse, sind also nicht aus dem Bereich des
Holzschnitts übernommen, sondern haben ihre Basis in den beiden erwähnten
Künsten. Zu der Verbindung zwischen Holzschnitt und Buchdruck in bezug auf
die Druckerschwärze und die Druckpresse meint FebvreMartin 43:
II libro stampato non puo, dunque, essere considerate un perfezionamento della silografia.
Fatti caratteristici: l'inchiostro grasso tipografico, nero e nitido, non sembra abbia sostituito
in silografia il vecchio inchiostro a base di nerofumo, generalmente bruno e troppo fluido, se
non dopo l'apparizione del libro a stampa. Analogamente, soltanto dopo l'invenzione della
stampa il torchio sostituisce neH'industria silografica l'antico sistema del tampone, ehe
permetteva di stampare il foglio su una facciata sola4.
2 Siehe dazu auch Tinto 20: «L'acquisto di caratteri di fonderia,..., segna quindi un primo,
timido inizio di passaggio dalla fase artigianale dell'officina tipografica...a quella industria-
le»; siehe auch Orcutt 15.
3 Siehe dazu auch die Tatsache, daß führende Vertreter der Buchdruckkunst zuvor in diesen
verwandten Bereichen tätig waren, so war Gutenberg Goldschmied (siehe dazu Ruppel 38
u.f.; Gerhardt 43 u.f.; Saroglia 5), und Nicolas Jenson, der später in Venedig als Drucker zu
großem Ansehen kam, war königlicher Münzstempelschneider am Hofe Karls VII (Wolf 5).
4 Zu den Vorläufern der Druckpresse siehe Schulte,GutTb 56: «Nach allem diesem darf man
nicht sagen, daß die Presse des Papiermachers das Vorbild der Druckerpresse war, vielmehr
gehen beide zurück auf die alte, im italienischen Weinbau seit der Römerzeit gebräuchliche
Spindelkelter, abgeändert bzw. weiterentwickelt für die besonderen Zwecke dieser beiden
neuen Berufe. Alle drei Pressen vereinigten sich in der Person des Handwerkers, der sie
schuf und die gewonnenen Erfahrungen und etwaige Verbesserungen bei Neuanfertigung
von der einen auf die andere übertragen konnte». Zu der Beziehung zwischen der Druck-
presse und der Weinpresse, Tuchpresse und Schraubenpresse siehe die Untersuchung von
Moran 19-21. Grundlage der Untersuchungen zu der Druckpresse sind die zahlreichen
Illustrationen von Druckerwerkstätten, die aus dem 15. und 16. Jahrhundert überliefert sind.
Siehe dazu Moran 24: «We rely for evidence as to what the earliest printing presses were like