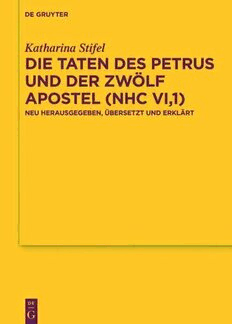Table Of ContentKatharina Stifel
Die Taten des Petrus und der zwölf Apostel (NHC VI,1)
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Texte und Untersuchungen
zur Geschichte der
altchristlichen Literatur
(TU)
Archiv für die Ausgabe der Griechischen Christlichen
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
Begründet von
O. von Gebhardt und A. von Harnack
Herausgegeben von
Christoph Markschies
Band 182
Katharina Stifel
Die Taten des Petrus
und der zwölf Apostel
(NHC VI,1)
Neu herausgegeben, übersetzt und erklärt
Herausgegeben durch die
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
von Christoph Markschies
ISBN 978-3-11-055942-2
e-ISBN (PDF) 978-3-11-055999-6
ISSN 0082-3589
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Names: Stifel, Katharina, editor, translator.
Title: Die Taten des Petrus und der zwölf Apostel : (NHC VI,1) / Katharina
Stifel ; neu herausgegeben, übersetzt und erklärt.
Other titles: Acts of Peter and the Twelve Apostles. German
Description: Boston ; Berlin : De Gruyter, 2018. | Series: Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur Band/volume ;
182 | Includes bibliographical references and index.
Identifiers: LCCN 2018030270 (print) | LCCN 2018045061 (ebook) | ISBN
9783110559996 (electronic Portable Document Format (pdf) | ISBN
9783110559422 (print : alk. paper) | ISBN 9783110559996 (e-book pdf)
Subjects: LCSH: Acts of Peter and the Twelve Apostles.
Classification: LCC BT1392.A37 (ebook) | LCC BT1392.A37 G37 2018 (print) |
DDC 229/.925--dc23
LC record available at https://lccn.loc.gov/2018030270
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
www.degruyter.com
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist die für den Druck leicht veränderte und mit Registern verse-
hende Fassung meiner Dissertation, die im Sommersemester 2016 von der Theologi-
schen Fakultät zu Berlin als Promotionsschrift angenommen wurde.
Ohne die fachliche – und auch persönliche – Begleitung vieler Menschen hätte
diese Arbeit nicht entstehen können. An erster Stelle möchte ich meinem Doktorva-
ter Prof. Dr. Hans-Gebhard Bethge danken. Während des Studiums hat er mich für
die koptische Sprache begeistert. Jeden Mittwoch bot er eine Übersetzungsübung an
und Studierende der Theologie, Ägyptologie und Geschichte haben sich gemeinsam
sukzessive eine Nag-Hammadi-Schrift und die koptische Grammatik er-schlossen. Ich
denke sehr gern an diese Zeit zurück. Die vorliegende Arbeit hat er all die Jahre in ihrer
Entstehung begleitet: durch regelmäßige Gespräche, das Vermitteln von Kontakten
und schließlich durch das Erstgutachten. Auch die Tatsache, dass meine Tochter Kar-
lotta während unserer Gespräche durch sein Büro krabbeln und mit dem Spielzeug
seiner Enkel spielen durfte, war ein großes Geschenk.
Mein herzlicher Dank gilt auch Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies, an
dessen Doktorandencolloquium ich teilnehmen durfte. Die Forschungsprojekte aus
dem weiten Feld der Kirchengeschichte waren für mich eine Bereicherung und regten
mich dazu an, über den eigenen fachlichen Manuskriptrand hinaus zu blicken.
Sehr glücklich bin ich darüber, dass Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies
das Zweitgutachten für diese Arbeit übernommen hat. Sein fachlich-kritischer Blick
hat diese Arbeit sehr befördert und er setzte sich für ihre Aufnahme in die Reihe „Texte
und Untersuchungen“ ein.
Vielen Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für koptisch-gnostische Schriften
bin ich dankbar verbunden. Tagelang vergrübelte Knoten der koptischen Gramma-
tik wusste Dr. Uwe-Karsten Plisch kompetent und schnell zu lösen und auch PD Dr.
Ursula Ulrike Kaiser war bei Fragen stets ansprechbar. Konrad Schwarz verdanke ich
viele hilfreiche Tipps zu koptischen Schriftsätzen, literarischen Gattungen und erster
Hilfe bei Kinderkrankheiten.
Ohne die Förderung der Konrad-Adenauer-Stiftung hätte diese Arbeit nicht ent-
stehen können. Natürlich bin ich für die finanzielle Förderung sehr dankbar, aber
bereichert hat mich gerade auch der wissenschaftliche Austausch mit den anderen
Promovierenden. Besonders Prof. Dr. Notger Slenczka danke ich für sein Engagement
als Vertrauensdozent und die Begleitung in der Promotionszeit. Er bot unserer Hoch-
schulgruppe ein Plenum für fachlichen Austausch und sorgte mit kulturellen Angebo-
ten und Ruderausfahrten für Abwechslung im Arbeitsalltag.
Für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Verlag Walter de Gruyter und
besonders Stefan Selbmann bin ich zu Dank verpflichtet.
Und schließlich: Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie. Meine Eltern
haben mir immer wieder Freiräume geschaffen. Meine Mutter, Renate Schwarz, erkun-
dete mit meiner Tochter bereitwillig die Berliner Spielplätze, damit ich in Ruhe arbei-
https://doi.org/10.1515/9783110559996-201
VI Vorwort
ten konnte. Mein Mann, Jonas Stifel, hat mich immer wieder ermutigt, wenn ich an mir
und meiner Arbeit gezweifelt habe. Und meine Tochter Karlotta hat diese Arbeit auf
ihre eigene Weise unterstützt: Schon mit 18 Monaten konnte sie maau zu mir sagen –
das koptische Wort für Mutter.
Berlin, Pfingsten 2018 Katharina Stifel
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
I Einführung in die Schrift
1 Eine ungewöhnliche Erzählung 3
2 Die Überlieferung der Erzählung in Codex VI der Schriften von
Nag Hammadi 4
2.1 Äußeres Erscheinungsbild und Material 4
2.2 Schreibung und Sprache 5
2.3 Die ActPt als Teil von Nag-Hammadi-Codex VI 9
2.4 Die Schreibernotiz und die Auftraggeber des Code 11
3 Historische Einordung der „Taten des Petrus und der zwölf Apostel“ 13
3.1 Datierung und Lokalisierung 13
3.2 Verfasser 17
3.3 Religionshistorische Verortung 18
4 Forschungsüberblick 22
4.1 Faksimile-Ausgabe und Editionen des koptischen Textes 22
4.2 Erster Forschungsschwerpunkt: Redaktions- und
Quellentheorien 22
4.2.1 Drei-Quellen-Modelle 22
4.2.2 Zwei-Quellen-Modelle 24
4.3 Zweiter Forschungsschwerpunkt: Textverständnis und intertextuelle
Bezüge 25
4.4 Ein „hybrider Großtext“? Die Frage nach der Gattung der ActPt 26
4.4.1 Die Klassifizierung als Apostelgeschichte 26
4.4.2 Ein heterogener Text 27
4.4.3 Jenseits der neutestamentlich geprägten Gattungen 28
4.4.4 Eine fiktionale Erzählung zwischen Apostelgeschichte und
Dialogevangelium 30
4.4.5 Die ActPt: Eine Parabel 30
VIII Inhaltsverzeichnis
II Textedition
1 Erläuterung zu Textedition, Übersetzung, kritischem Apparat und
Register 37
2 Text und Übersetzung 40
3 Register 62
3.1 Koptische Wörter 62
3.2 Koptische Wörter griechischen Ursprungs 85
3.3 Eigennamen 88
3.4 Satzmuster 88
3.5 PTN-Determinatoren 94
III Kommentar
1 Zur Methodik 101
1.1 Aufbau des Kommentars und zugrundeliegende Methodik 101
1.1.1 Analyse des Erzähltextes 101
1.1.2 Analyse der Symbolik 103
2 Bezüge zu anderen Schriften 107
2.1 Die Beziehungen zu den kanonischen Evangelien 108
2.1.1 Das Petrusbekenntnis 108
2.1.2 Gott als Vater 109
2.1.3 Jesus als Königssohn und Herr 109
2.1.4 Die Herrschaft der Himmel 109
2.1.5 Das Symbol der Perle 110
2.1.6 Schlussfolgerung 111
2.2 Der „Brief des Jakobus“ (NHC I,2) 111
2.2.1 Der Mensch als Stadt 112
2.2.2 Bekleidungsmetaphorik 113
2.2.3 Erzählchronologie 113
2.2.4 Schlussfolgerungen 113
2.3 Der Himmelabstieg in der Epistula Apostolorum 114
2.4 Die Thomasakten 115
2.4.1 Christus und Thomas als Ärzte und die Heilung der Seele 116
2.4.2 Die Perle als anthropologisch-soteriologisches Symbol 117
2.4.3 Die Askese und der vielgestaltige Christus 117
2.4.4 Schlussfolgerungen 118
2.5 Aphrahat und seine bilderreiche Sprache 118
Inhaltsverzeichnis IX
2.5.1 Das Bauwerk des Glaubens als Wohnstätte Christi 119
2.5.2 Bildreiche Christologie, Askese und medizinische Metaphorik 119
2.5.3 Schlussfolgerungen 120
2.6 Der Liber Graduum 121
2.6.1 Vervollkommnung des Menschen auf dem spirituellen Weg in die Stadt
Christi 121
2.6.2 Ekklesiologie und Spiritualität 122
2.6.3 Körperliche und seelische Heilung 123
2.6.4 Schlussfolgerungen 123
2.7 Die kostbare Perle des Lebens in den Schriften des Pseudo-
Makarios 124
2.8 Lukians unglaubliches Spiel mit dem Leser 125
3 Einführung in die Erzählung 128
3.1 Die Erzählwelt 128
3.2 Die Erzählzeit 129
3.3 Die Handlungsträger 130
3.3.1 Lithargoel 130
3.3.2 Die Bedeutung des Namens „Lithargoel“ 131
3.3.3 Der Arzt 132
3.3.4 Jesus Christus 132
3.3.5 Petrus und die Jünger 133
3.3.6 Die Menschen in der Stadt „Wohne“ 133
3.3.7 Nebenfiguren 134
3.3.8 Schlussfolgerungen aus der Figurenkonstellation 135
3.4 Wichtige Symbole der Erzählung 135
3.4.1 Die Städte-Symbolik 135
3.4.2 Der Weg 141
3.4.3 Die Perle als Symbol der Vollkommenheit 142
3.5 Die Christologie der Erzählung 146
3.5.1 Lithargoel 146
3.5.2 Der Arzt 149
3.5.3 Der offenbare Jesus Christus 150
3.5.4 Jesus Christus als Vorbild der Bewährung 151
3.5.5 Doketistische Christologie? 151
3.5.6 Jesus Christus als Rollenspieler 152
3.6 Petrus – Anführer mit Ambivalenzen 153
3.7 Heil und Heilung 155
3.7.1 Medizin, Ärzte und Heilung in den ActPt 155
3.7.2 Die Verbindung von Heilung und Verkündigung 158
3.7.3 Heilung durch Jesus Christus, den Arzt 158
3.7.4 Die Sünde als Krankheit der Seele 160
X Inhaltsverzeichnis
3.7.5 Die Abgrenzung von der weltlichen Medizin 160
3.7.6 Die Jünger als Nachfolgende 162
3.7.7 Heilung für Körper und Seele 162
4 Kommentierung durch die Abschnitte der Schrift 163
Anhang
Abkürzungen 335
Literaturverzeichnis 336
Namens-/Sachregister 348
Stellenregister 351