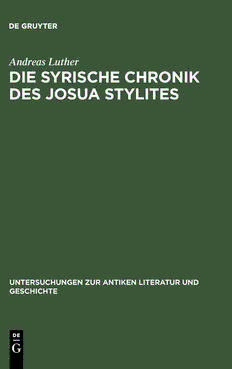Table Of ContentAndreas Luther
syrische Chronik des Josua Stylites
w
DE
G
Untersuchungen zur
antiken Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Winfried Bühler, Peter Herrmann und Otto Zwierlein
Band 49
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1997
Die syrische Chronik
des Josua Styütes
von
Andreas Luther
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1997
® Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Luther, Andreas:
Die syrische Chronik des Josua Stylites / von Andreas Luther. —
Berlin ; New York : de Gruyter, 1997
(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte ; Bd. 49)
Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1995
ISBN 3-11-015470-6
NE: Josua < Stylites > : Die syrische Chronik des Josua Stylites; GT
© Copyright 1997 by Walter de Gruyter & Co., D-10785 Berlin
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Druck: Arthur CoUignon GmbH, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer, Berlin
Ούδέν γαρ ταις φιλοπευθέσν ψυχαΐς
ενεστιν ιστορίας έπαγωγότερον.
Theophylakt.
Vorwort.
Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung meiner Dissertation,
die im Dezember 1995 am Fachbereich Geschichtswissenschaften (FMI) der
Freien Universität Berlin eingereicht wurde.
An dieser Stelle möchte ich all denen Dank sagen, die mir auf vielfältige
Weise zur Seite gestanden haben. Vor allem danke ich meinem Lehrer, Herrn
Prof. Dr. A. Demandt, der stets Anteil daran nahm, quid Seres et regnata Cyro
Bac tra parent Tanaisque discors - sein lebhaftes Interesse am Orient war der
Anlaß für die Entstehung dieser Arbeit. Ferner danke ich den Herren Professo-
ren E. Baltrusch, W.-W. Ehlers, V. Fadinger, P. Schäfer, B. Seidensticker und
P. Spahn sowie Herrn PD Dr. H. Leppin und Herrn Dr. R. Nauta für consilium
et auxilium vor und während meines Promotionsverfahrens. Den Herausgebern
der UaLG\ insbesondere Herrn Prof. Dr. P. Herrmann, danke ich für die Auf-
nahme in diese Reihe. Zu Dank verpflichtet bin ich der Studienstiftung des
Deutschen Volkes sowie dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in
Rom, Herrn Prof. Dr. A. Esch, für die Ermöglichung eines Studienaufenthaltes
an der Vatikanischen Bibliothek im April 1994. Ebenso danke ich der Biblio-
teca Apostolica Vaticana für die freundliche Erlaubnis, Teile des Codex Zuq-
ninensis (Cod. Vat. Syr. 162) im Anhang dieses Buches reproduzieren zu dür-
fen. Schließlich danke ich auch folgenden Freunden und Kommilitonen, die
mir ihre freundliche Unterstützung bei der Entstehung dieser Arbeit zuteil
werden ließen: M. Feig (Houston), K. Feld, N. Frische, T. Gerhardt, M. und A.
Goltz, U. Hartmann, V. Junker, P. Kruschwitz, J. Lißner, C. Motschmann und
M. Redies.
Ermutigung und Trost in meiner Aufregung am Vormittag des 9. 2. 1996
fand ich in den Losungstexten der Herrnhuter Brüdergemeine (1. Könige 2,2-3:
ΓΡ^ΓΠ npTIT). 2. Timotheus 4,5: Σύ δέ νηφε έν πάσιν, κα-
κοπάθησον). Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, die mich in einer heilen
Welt aufwachsen ließen und immer für mich da waren.
Berlin im Dezember 1996 Andreas Luther.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
1. Einführung
l.a. Einleitung 1
1 .b. Die Chronik des Josua Stylites
l.b.l. Die Forschungssituation 4
1 .b.2. Der Verfasser der Chronik 10
1 .b.2.a. Die Notiz des Mönches Elisaeus 11
l.b.2.b. Autor und Text 16
1 .b.2.c. Der Adressat der Chronik 19
1 .b.2.d. Die Abfassungszeit der Chronik 21
1 .b.2.e. Das Problem des religiösen Milieus 22
1 .b.3. Die Quellen der Chronik 29
I.e. Vorbemerkungen zu Übersetzung und Kommentar 31
2. Übersetzung 33
3. Historischer Kommentar 96
Anhang A. Zeittafel 221
Anhang B. Glossar 224
Anhang C. Karten
C.a. Mesopotamien 225
C.b. Edessa-Urfa 226
Anhang D. Abbildungen
D.a. Abbildungen aus Cod. Vat. Syr. 162 228
D.b. Photographien 236
Anhang E. Die Konzeption der Chronik
E.a. Das Phänomen Geschichte 245
E.b. Das historiographische Konzept 252
Anhang F. Literaturverzeichnis
F.a. Abkürzungsverzeichnis 256
Vili Inhaltsverzeichnis
F.b. Quellen
F.b. 1. Editionen und Übersetzungen der Chronik des
Josua Stylites 258
F.b.2. Verzeichnis der Quellen
F.b.2.a. Quellen in griechischer und lateinischer
Sprache 258
F.b.2.b. Quellen in syrischer Sprache 262
F.b.2.c. Quellen in arabischer und persischer
Sprache 265
F.b.2.d. Quellen in armenischer Sprache 266
F.c. Sekundärliteratur 267
Register 292
1. Einführung
l.a. Einleitung
Die sogenannte Chronik des Josua Stylites, entstanden zu Beginn des 6.
Jahrhunderts in Edessa, ist eines der ältesten erhaltenen Zeugnisse der Ge-
schichtsschreibung in syrischer Sprache1. Die Chronik gehört zu den Texten,
die der europäischen Forschung von Joseph Simonius Assemanus erschlossen
wurden, dem Begründer der neuzeitlichen Orientalistik.
Am 30. Juni 1715 war Assemanus2, syrischer Maronit und zu damaliger
Zeit scríptor für orientalische Handschriften an der Vatikanischen Bibliothek
in Rom, zu einer Reise aufgebrochen, die ihn für anderthalb Jahre nach Ägyp-
ten und in die Levante führen sollte3. Papst Clemens XI. hatte ihn beauftragt,
im Orient für die Erweiterung des Bestandes der Vaticana orientalische Hand-
schriften zu erwerben. Mehrfach zuvor, in den Jahren 1706 und 1707, war der
Vatikan durch die Berichte reisender Kleriker auf die Bedeutung einer Biblio-
thek hingewiesen worden, die sich im syrisch-orthodoxen Kloster der Maria
Deipara4 befand, einem der Klöster der Nitrischen (oder Sketischen) Wüste,
des Wâdï Natrün in Ägypten. Ein Großteil der Bestände an syrischen Hand-
schriften, die dieses Kloster besaß, stammte aus einer Sammlung, die durch
den Abt Moses von Nisibis im Jahre 932 aus Mesopotamien nach Ägypten
Früheren Entstehungsdatums sind allerdings mehrere Zeugnisse aus dem Mischbereich der
Hagiographie, etwa die Vita des edessenischen Bischofs Rabulas.
Assemanus (* Tripolis 27.7.1687, "f Rom 13.1.1768, arab. as-Sim'änl, Lt-ft-.ii.il) war späterhin
Erster Custos der Vatikanischen Bibliothek und Erzbischof von Tyrus. Das maronitische
Kolleg in Rom, wo Assemanus seine letzte Ruhe fand, ist aufgelöst worden, doch das Gebäu-
de existiert noch heute im Vicolo dei Maroniti in der Nähe des Tritone. Über Assemanus:
Darauni 1-3.
Assemanus gibt einen Reisebericht im Vorwort (Kap. XI) zu seiner Bibliotheca Orientalis Bd.
1.
Ein beträchtlicher Teil der heutigen Bestände an syrischen Handschriften in den europäischen
Bibliotheken stammt aus diesem Konvent. Er spielt somit für die Übermittlung syrischer Lite-
ratur eine herausragende Bedeutung. Heute existiert dieses Kloster im Wâdî Natrün unter dem
Namen ad-Dayr as-Suryäni (^LomJljjaJI). Dieses 'Syrische Kloster', das in unmittelbarer
Nähe des Anbä-Bisoy-Klosters liegt, wird heute (1989) von der koptischen Kirche verwaltet
und von koptischen Mönchen bewohnt. Zum Deipara-Kloster und seiner Bibliothek vgl.
Wright (1872) i-xvii.
2 Einführung
gebracht worden war. Assemanus hoffte nun, vor allem in diesem Konvent
fündig zu werden. Zwar traf er in der verwahrlosten Bibliothek des Klosters
eine größere Anzahl von Codices in syrischer Sprache an, etwa 200 Bände,
doch konnte er die ansässigen syrischen Mönche nur zum Verkauf von weni-
gen Exemplaren bewegen.
So brachte Assemanus im Januar 1717 aus diesem Konvent neben anderen
seltenen Manuskripten5 einen beschädigten Kodex nach Rom, der den Text
einer Universalchronik in syrischer Sprache trägt, die von der Erschaffung der
Welt bis zum Jahre 1087 sei. (775-6) reicht, dem Jahr, in dem die Abfassung
beendet wurde6. Der Name des Verfassers ist unbekannt. Assemanus identifi-
zierte diese Chronik irrtümlicherweise mit einem verlorenen Werk des jakobi-
tischen Patriarchen Dionysius von Tel-Mahre (geweiht 819, f845), von dem
spätere syrisch schreibende Autoren wie Barhebräus berichten, er sei der Ver-
fasser einer vielgerühmten Chronik gewesen7. Heute hält man diese Chronik
für die Kompilation eines anonymen Klerikers aus der Gegend von Amida in
Mesopotamien (syrisch Ämed, heute Diyarbakir in der südöstlichen Türkei),
wahrscheinlich aus dem nahegelegenen Kloster von Zuqnin8. So spricht man
Darunter befand sich u.a. die einzige erhaltene Handschrift der Edessenischen Chronik.
Der Chronist schrieb bereits im Verlauf des Jahres 1086 sei. (Ps.-Dionysius 2,146), das
offenbar nachträglich verfaßte Vorwort datiert jedoch aus dem Jahre 1087 sei. Witakowski
(1987) 90 setzt die Abfassungszeit in den September 775. Zur Seleukidenära (abgekürzt mit
sei.) vgl. Abschnitt 1 .c.
Barhebräus flicht in seine beiden Chroniken (CS und CE) mehrfach Zitate aus dem Werk des
Dionysius ein. Vgl. auch die Benutzung des Dionysius in später gefundenen (also für Asse-
manus unbekannten) syrischen Chroniken wie Michael Syrus und dem Anonymus ad a. 1234
pertinens. Zum literarischen Schaffen des Patriarchen Dionysius vgl. Baumstark (1922) 275.
Abramowski 126-9 (auch mit einer Übersicht der erhaltenen Fragmente). Bereits Assemanus
bemerkte, daß die ihm bekannten Fragmente des Dionysius nicht in dem von ihm aus Ägyp-
ten mitgebrachten Text auftauchten. In der Überzeugung, dennoch ein Werk des Dionysius
vor sich zu haben, Schloß Assemanus aber, daß es sich bei dem vorliegenden Text um eine
Kurzfassung der eigentlichen Chronik handeln müsse: 'Scripsit Annales (..) quorum duplex
editio apud Syros circumfertur: Alii enim prolixiores sunt, & in modum historiae Ecclesiasti-
cae Eusebii (..) compositi. (..) Alii breviores, et Chronici Eusebiani instar, in annos digesti,
quorum exemplar pervetustum in Scetensi Deiparae Syrorum monasterio nacti sumus' (BO
2,98).
Es gab offenbar zwei Klöster des Namens Zuqnin. Das in der Umgebung von Amida befind-
liche ist seit dem 5. Jh. sicher bezeugt (Johannes v. Asien, Vitae 558, vgl. 37). Im 7. und 8. Jh.
stellten Mönche dieses Klosters mehrfach Bischöfe von Amida (Ps.-Dionysius 2,190. 210.
246. Vgl. Michael Syrus 755-60 passim). Die Vita der heiligen Behnam und Sara nennt gar
bereits für die Regierungsperiode des Kaisers Julian 'das große Kloster von Zuqnin' (AMS
2,398). Über dieses Kloster Witakowski (1987) 91-2. Ein zweites in der Spätantike belegtes
Kloster Zuqnin, das nach einem heiligen Johannes benannt war (Documenta 146), lag ver-
mutlich im Hinterland Antiochiens, vgl. Honigmann (1921) 20-1 mit den Ergänzungen von
Littmann 183. Die genaue Lage beider Klöster ist leider unbekannt.