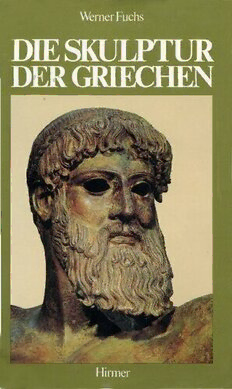Table Of ContentREISE UND STUDIUM
WERNER FUCHS
Die
Skulptur
der
Griechen
Aufnahmen von Max Hirmer
HIRMER VERLAG
MÜNCHEN
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Fuchs, Werner:
Die Skulptur der Griechen / Werner Fuchs. Aufn.
von Max Hirmer. — 2., überarb. Aufl. — München:
Hirraer, 1979.
(Reise und Studium)
ISBN 3-7774-2990-2
2. überarbeitete Auflage 1979
© 1969 by HIRMER VERLAG MÜNCHEN GmbH · Lithos: Chemi-
graphia Gebr. Czech, München · Papier: Papierfabrik Scheufeien, Ober-
lenningen · Satz: Kastner & Callwey, Gebr. Herzer, Max Vornehm, alle
München · Druck: Graphische Anstalt Ernst Wartelsteiner, Garchmg
ISBN 3-7774-2990-2
ZUR EINFÜHRUNG
»Alle Kunst ist menschlich und nicht griechisch« — diese Worte
gegen die übertriebene Griechenbegeisterung des späten 18. Jahr-
hunderts, die vor allem von Johann Joachim Winckelmann ausgelöst
wurde, notierte sich vor 1780 Wilhelm Heinse in sein Tagebuch
(Werke VIII 1,94). Dabei war Heinse selbst ein großer Verehrer
griechischer Form, der täglich im Homer las, die Tragiker wohl
kannte und ein tiefes Kunstverständnis hatte, das sich so kräftig in
seinem Ardinghello (1787) äußert, dieser sinnlich-übersinnlichen
Huldigung an Griechenland. Um so überraschender ist Heinses Aus-
spruch, der auch für uns noch sein Gewicht besitzt: nur insofern die
griechische Kunst uns als Menschen etwas zu sagen hat, ist sie für
uns wichtig. Das übrige geht lediglich den Altertumsforscher an.
Und gerade das ist das Wesentliche an der griechischen Skulptur:
daß sie ganz und gar auf den Menschen ausgerichtet ist, daß in ihr
der Mensch nicht bloß in griechischem Gewände, sondern zugleich
als Mensch an sich erscheint und dargestellt wird. Griechische Kunst
ist die erste wahrhaft große menschliche Kunst, nicht Kunst für die
Ewigkeit wie in Ägypten oder im alten Orient, sondern Kunst für
den Menschen im Hier und Jetzt, in seinem Dasein.
Die griechische Skulptur hat sich seit ihren Anfängen in der
geometrischen Zeit des 9. und 8. Jahrhunderts bis zu ihrem Ende im
späthellenistischen 1. Jahrhundert getreu den ihr innewohnenden
Gesetzen entwickelt, Gesetzen, die zugleich den Maßstab für jede
spätere Kunstentwicklung bilden: aus einfachen ursprünglichen Ge-
staltungsversuchen entsteht der großartige, zugleich offene und in
sich geschlossene Kosmos der archaischen Kunst, dem Anruf des
Seins verhaftet. Bereits in der spätarchaischen Zeit selbst zeichnet
sich das grundlegende neue Element ab, das den Höhepunkt der
griechischen Skulptur in der klassischen Zeit des 5. Jahrhunderts
bestimmt: die Daseinsform, die den Menschen ganz auf sich selbst
beschränkt und doch zugleich über sich hinaushebt, die den großen
Rhythmus findet, der alle Teile einer Gestalt durchzieht und in einer
neuen Einheit ordnet, die vom Geist, vom Willen und von der Seele
bestimmt wird. Mit dieser klassischen Leistung der Griechen in der
Spiegelung des Makrokosmos der Welt im Mikrokosmos des Men-
schen entsteht eine einmalige neue Prägung des Menschenbildes, die
jede archaische Gebundenheit hinter sich läßt, und zum ersten Mal
in der Weltgeschichte der Kunst den Menschen als Menschen ent-
deckt, sein Bild festhält, den archaisch gefügten Körper gefügig
machend und aufnahmebereit zum Träger des Ausdrucks. Die
archaische Kostbarkeit des einzelnen Teiles mußte preisgegeben
werden; denn jeder Fortschritt ist mit Verlust erkauft. Die sakrale
Gebundenheit archaischer Gestaltung löst sich in einer freien
Religiosität.
Das Erscheinungsbild, die Darstellung von Pathos und Leiden-
schaft, von Kraft und Anmut wird das Ziel der späten Klassik und
des Hellenismus. In der hellenistischen Kunst wird die Daseinsform
zur Wirkungsform. Hier erobert die Skulptur den ganzen Raum
menschlicher Gestaltungsmöglichkeiten und prägt einmalige Körper-
gebärden, die aller späteren Kunst, der römischen, der frühchrist-
lichen, der byzantinischen, selbst dem Mittelalter und vor allem der
Renaissance als anwendbare Formeln verfügbar sind. Die eindring-
liche Kraft des griechischen Körperverständnisses formt die gesamte
spätere Kunst, selbst da, wo das Vorbild der Griechen verleugnet
wird. Wie ist das möglich? Was steckt in den Griechen, daß sie die
erlösenden und entscheidenden Worte sprechen können, ehe sie
eigentlich schon völlig verstanden werden?
Dabei, und das ist das Geheimnis, vollzieht sich der Umbruch in
der Stille. Archaische Figuren können lauter und strahlender vom
ihrem Sein künden als klassische Gestalten, archaische Kuroi stehen
fester auf dem Boden der Erde als der Speerträger oder der Diar
dumenos des Polyklet, die ganz in sich gesammelt und dabei zu-
gleich ruhig in sich bewegt sind. Daß die ergreifendere Bewegung
in schlichter Stille möglich ist, vielleicht nur da überhaupt ent-
stehen kann, das zeigt sich als das Wunder der Natürlichkeit in der
klassischen griechischen Skulptur: Menschen und Götter leben und
atmen im Marmor und selbst im Metall, Statuen scheinen von sich
zu sprechen und zugleich von sich zu schweigen — nicht die Ewigkeit
des Seins, sondern das ewige Rätsel des Menschseins zwischen Sprache
und Schweigen, zwischen Tat und Untat, zwischen Glück, Genuß
und Beherrschung wurde von den griechischen Bildhauern im 5. Jahr-
hundert zum ersten Mal und zugleich für immer gestaltet. Nicht daß
diese Menschen und Götter griechisch reden, sondern daß sie so sind,
wie sie ihrer Natur nach sein sollen, daß sie selbst allgemein zu Vor-
bildern des Menschseins werden können, das ist hier mit der Ent-
deckung des Menschen in der griechischen Kunst der Klassik gemeint.
Die Entwicklung in der griechischen Kunst vollzieht sich nicht
einfach und pflanzenhaft, sondern geistig; sie geschieht in Gegen-.
sätzen, die oft bis zum Zerreißen gespannt sind und nur von den
großen Künstlern gebändigt werden. Die einfache, natürliche Ruhe
einer klassischen Gestalt ist in Wahrheit auf überaus komplizierten
Voraussetzungen aufgebaut, ist erstritten, nicht geschenkt. Seit der
geometrischen Zeit hatten die Griechen als das bildkräftigste Volk
der Erde eine Heerschar bedeutender, bekannter und unbekannter
Künstler, die sich immer wieder mit der Grundtatsache der mensch-
lichen Gestalt auseinandersetzten. Sie bauten unbedenklich auf der
Kenntnis ihrer Vorfahren und ihrer nichtgriechischen Nachbarn auf,
nahmen, was sie brauchten, verwarfen, was sie nicht gebrauchen
konnten. In Platons Epinomis 987 D—E ist dies gültig formuliert:
»Was auch immer wir Griechen von den Barbaren übernommen
haben, verwandelten wir am Ende zu etwas Schönerem.« Formeln
werden weitergereicht, aber jeder Meister hat die Distanz zum
Werk, durch die allein es grundsätzlich zur immer neuen Ausein-
andersetzung um das Bild des Menschen wird, um das nicht nur die
Künstler, sondern ebenso die Dichter und Politiker, Sophisten und
Philosophen ringen: was ist es, das dem Menschen die Arete
(αρετή) gibt, wodurch »taugt« er, was macht ihn zum Menschen,
wo sind seine Grenzen, wodurch wird er vollkommen Mensch?
Diese grundsätzliche Einstellung, dieses Fragen über Alkiphron und
Sokrates hinaus zum Menschen als Menschen, zeichnet die Griechen
aus, und sie wären nicht die Griechen, wenn nicht der Mensch, der
sterbliche und hinfällige, im Hinblick auf die Götter, die unsterb-
lichen und ewigseienden, bestimmt würde. Daß der Mensch teilhat
am Göttlichen, daß Leib und Geist in Menschen wie Göttern eine
große Einheit bilden, ist Urbekenntnis des Griechentums und als
solches hinzunehmen. Weil der Leib göttlich ist, wird die erfüllte
und erfühlte Bildung des menschlichen Körpers in immer neuen
Gestalten möglich.
In der Frühzeit prägt die männliche Gestalt auch die Auffassung
des weiblichen Körpers, erst die späte Klassik des Praxiteles erfühlt
die Formen der Frau. Immer aber geht es den Griechen um Wahrheit
in der Gestaltung des Körpers, um Aletheia (αλήθεια), um Unver-
borgenheit. Obwohl im täglichen Leben Sitte und Anstand weit ver-
breitet waren und strikt beachtet wurden, Scham (Aidos: αιδώς)
selbst eine gewichtige Göttin ist, scheuen sich die Griechen nicht, den
männlichen Körper bei den Wettkämpfen und in der Palästra un-
verhüllt zu zeigen. Die Statuen künden ebenso davon: der wahre
Mann hat nichts zu verbergen, auch nicht im Angesicht der Gottheit
— man vergleiche die diametral entgegengesetzte Auffassung der
jüdisch-orientalischen Religionen oder selbst die der Römer, die in
diesem Punkte ganz anders dachten.
Aus dieser strengen Suche nach der Wahrheit stammt die unver-
gleichliche Kraft griechischer Skulptur: die Erfassung des Körpers
bis ins letzte Detail, die Darstellung des Bewegungsprozesses im
Körper selbst, das Spiel und Gegenspiel der Glieder, Sehnen und
Muskeln, die Gestaltung von Angespanntem und Entspanntem, die
Einheit in der Harmonie der Gegensätze, oder griechisch gesprochen,
der Rhythmos und die Symmetria, wobei unter Symmetria nicht
unsere spiegelbildliche Entsprechung, sondern vielmehr die Ausge-
wogenheit der Teile und Kräfte im Ganzen zu verstehen ist.
Hinter allem griechischen Gestalten und Bilden steht die Frage
nach dem Menschen. Der Mensch hat seine Gestalt von den Göttern
empfangen, die wiederum nach dem Bilde des Menschen gestaltet
werden: die Göttlichkeit der Welt und die Menschlichkeit der Götter
sind so innig miteinander verflochten, daß das eine ohne das andere
gar nicht denkbar ist und erst irn späteren 5. Jahrhundert von so
radikalen Fragern wie Euripides bezweifelt werden kann, von frü-
herer philosophischer Kritik (Xenophanes) abgesehen.
Gemäß dieser Verflochtenheit von Göttern und Menschen wird
im folgenden die Entwicklung der griechischen Skulptur nicht nach
Epochen gegliedert, sondern als Problemgeschichte vorgetragen: wie
lösen der geometrische, der archaische, der früh-, hoch- und spät-
klassische sowie der hellenistische Künstler das Problem der Dar-
stellung des stehenden Mannes, sei es als Sieger- oder Götterbild, als
Kämpfer oder Beter? Wie äußert sich die Aktivität der Bewegung
in archaischer, in klassischer oder in hellenistischer Zeit? Wie wandelt
sich das Frauenbild? Wie werden Gruppen dargestellt? Welcher Aus-
druck teilt sich den Köpfen mit? Wie wandeln sich die Formen im
Rumpf und in den Gliedmaßen?
Gerade aus der Untersuchung der Details wird dem Betrachter
deutlich, wie tief in der griechischen Skulptur das Kleinste mit dem
Größten verbunden ist, wie sehr alles in sich zusammenhängt und
sich dem allgemeinen Stilgesetz unterwirft. Die Freiheit, der Eigen-
wille des Künstlers ist geringer als in der neueren Kunst, aber des-
halb sind die großen Meister wie Phidias und Polyklet nicht minder
groß. Im Gegenteil: falls die Ausprägung der attischen Hochklassik
zwischen 450 und 430 einem Manne nahezu alles verdankt, so ist
hier der Name des Phidias zu nennen.
Alle Skulptur ist immer Auseinandersetzung von Körper und
Raum oder, abstrakter gesprochen, von Masse und Leere. Jedes
plastische Gebilde nimmt einen Bezug zum umgebenden Raum auf,
selbst da, wo dieser Bezug absichtlich negiert wird oder auch da, wo
er noch nicht als künstlerisches Problem besteht. Mit der Ausbildung
der Form wird die Masse des ursprünglichen Materials — Ton, Holz,
Elfenbein, Stein, Marmor, Bronze oder anderes Metall — infolge des
Zeitprozesses zur Gestalt verarbeitet. Die griechische Entwicklung
strebt, und das ist schon früh angelegt und bereits im Geometrischen
erkennbar, zur Erfassung der Gestalt in der Funktionalität der
Formen. Dies erreicht jedoch erst die klassische Kunst im 5. Jahr-
hundert, die sich damit über die gesamte auf der archaischen Stufe
verharrende Kunst der Mittelmeerwelt sowie Asiens und Europas
erhebt. Die frühe Klassik tritt in ihrer ersten Phase, dem sogenannten
Strengen Stil, durchaus als alle Formen revolutionierende Bewegung
auf: Klassik selbst ist bei ihrem Auftreten das Gegenteil von dem,
was reaktionär-klassizistische Kunstgesinnung aus ihr gemacht hat.
Wohl kann man sagen, daß im klassischen Menschenbilde die latenten
Bewegungsmöglichkeiten, die im archaischen Kuros als Typus liegen,
aktualisiert worden sind unter Einbezug des Zeitmomentes. Aber
diese Aktualisierung der starren archaischen Form ist zugleich ihre
Revolutionierung: ein Flüssig- und Beweglichmachen des bis dahin
objektiv Festen.
Diese Zeilen über die griechische Skulptur versuchen vor allem
dem Vorurteil zu begegnen, das von der Kunst der klassischen Antike
als einer ununterschiedenen Einheit im Gegensatz zur neueren Kunst
redet. In Wirklichkeit hat die griechische Kunst ebenso ihre scharf
abgesetzten Epochen wie die neuere Kunst. Sie entwickelt sich von
den urtümlichen Anfängen der geometrischen Epoche über die eher
zeitlose Seinsauffassung der archaischen Zeit, die im 7. Jahrhundert
etwa mehr mit den gleichzeitigen oder älteren Formen der orienta-
lischen Nachbarvölker gemein hat als mit der späteren hellenisti-
schen Kunst, hin zur Daseinsform der Klassik in einer Vielfalt und
einem Reichtum verschiedener, gelegentlich sogar entgegengesetzter
Antworten auf die Frage nach dem Bild des Menschen, so daß jede
spätere Zeit die Möglichkeit hat, die ihr entsprechende Phase in der
fast tausendjährigen Geschichte der griechischen Kunst zu finden.
Es steht außer Zweifel, daß heute die frühgriechischen Formen der
geometrischen und früharchaischen Kunst des 8. und 7. Jahrhunderts
in ihrer kühnen Abstraktion den modernen Künstlern mehr zu sagen
haben als etwa die Athena Parthenos des Phidias, die wir dazu fast nur
durch geringwertige römische Nachbildungen kennen. In den Jahren
um und nach 1910 war es wohl die reif archaische und frühklassische
Kunst, welche die Künstler erregte — man denke an die Giebel des
Zeustempels von Olympia —, während die 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts einmal im hellenistischen Barock des großen Altars von
Pergamon und zum anderen im Hermes des Praxiteles ihre antike
Formvorstellung fand. Ohne zu übertreiben kann man sagen, daß
jede Zeit die ihr entsprechende Antike gesucht und meistens auch
gefunden hat. Aus dieser Erkenntnis wird deutlich, daß die griechi-
sche Kunst in ihrer Gesamtheit uns den Maßstab für Kunstentwick-
lung und für Kunst überhaupt an die Hand geben kann.
Hegel und der Historismus haben uns gelehrt, jede Epoche als
unmittelbar, als Wert in sich zu verstehen. Keineswegs ist es unsere
Absicht, die geometrische und archaische Kunst der Griechen nur als
Vorbereitung für die einzigartige klassische Leistung zu begreifen,
wenn auch im Aristotelisch-Hegelschen Sinn erst die vollkommene
Gestalt, die ihre wahre Entelechie erreicht hat, alles enthält. Der
historische Sinn verbietet eine zu einfache Wertung. Gleichwohl
sollte aber nicht verkannt werden, daß es eben nur die klassische
Form und klassische Statuen sind, die im späten Hellenismus seit
der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts als vorbildhaft empfunden und
anerkannt und durch Reproduktionstätigkeit neuattischer und an-
derer Ateliers in der römischen Welt verbreitet werden. Es ist, als
ob sich die archaische Form selbst gegen jede Reproduktion sträubte
und verschlösse, wenn man von der Sonderform der archaistischen
Kunst absieht, die seit etwa 400 die Kunstentwicklung als eine
Unterströmung begleitet, gleichsam eine künstliche Folie für die
eigentlichen Lösungen der spätklassischen und hellenistischen Zeit
bildend.
Da die archaischen Statuen in sich selbst so vollkommen und ab-
geschlossen sind, können sie eigentlich nicht »mechanisch« reprodu-
ziert werden; die klassischen Statuen hingegen erhalten ihr Leben aus
dem Geiste, sie suchen die allgemeinen Ideen von der Schönheit, Be-
wegung und Vollkommenheit zu verkörpern und sind oft nur mehr
oder weniger Stellvertreter dieser Ideen; auch aus diesem Grunde
sind sie einfacher zu kopieren und nachzubilden. Aber natürlich ist es
vor allem die freie und gelöste klassische Daseinsform, die die spä-
teren Zeiten interessiert. Diese allgemeine Aussage hat auch einen
sehr realen Hintergrund: der Arbeitsprozeß in archaischer Zeit war
ohne den laufenden Bohrer bei Marmorarbeiten so mühsam, daß ein
archaischer Künstler sehr viel Zeit für eine Statue oder ein Werk
brauchte und im Laufe eines langen Lebens kaum mehr als fünfzig
Werke fertigstellen konnte, während für Lysipp, den Bildhauer und
Erzgießer der spätklassischen und frühhellenistischen Zeit — der Jahre
von 390 bis 310 — überliefert ist, daß er etwa 1500 Werke in seinem
Leben geschaffen habe. Selbst wenn diese Zahl übertrieben sein sollte,
so ist sie doch für einen archaischen Künstler undenkbar. Der Arbeits-
prozeß war damals viel zu mühsam, der Zeitaufwand — und damit
der Zeitumsatz — viel intensiver, so daß eine Makellosigkeit der
Einzelform erreicht wurde, die heute noch jedes archaische Fragment
zu einem in sich abgeschlossenen, in sich vollkommenen Gebilde
macht, wohingegen das Fragment einer klassischen Statue oft nicht
dem entspricht, was einst die ganze Gestalt ausgedrückt hat: die
abgegrenzte Einzelform ist aufgegeben und in der Gesamtheit auf-
gegangen. Aus diesen Gründen ist es viel leichter, aus erhaltenen
Fragmenten eine archaische Gestalt zu rekonstruieren als eine klas-
10