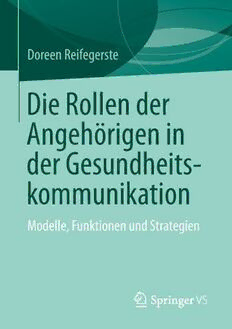Table Of ContentDoreen Reifegerste
Die Rollen der
Angehörigen in
der Gesundheits-
kommunikation
Modelle, Funktionen und Strategien
Die Rollen der Angehörigen in der
Gesundheitskommunikation
Doreen Reifegerste
Die Rollen der
Angehörigen in
der Gesundheits
kommunikation
Modelle, Funktionen und Strategien
Doreen Reifegerste
Kommunikationswissenschaft
Universität Erfurt
Erfurt, Thüringen, Deutschland
ISBN 978-3-658-25030-0 ISBN 978-3-658-25031-7 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25031-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen
im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und
daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt
sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Verantwortlich im Verlag: Barbara Emig-Roller
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Der Mensch ist des Menschen Medizin.
Walter H. Lechler
Vorwort
Für einen Wissenschaftler gibt es solche Themen, die man selbst zielstrebig anvi-
siert (und die man dann vielleicht mangels Förderung nicht umsetzen kann) und
dann gibt es Themen, die unverhofft aber doch hartnäckig an die Tür klopfen.
Wie ein heimatloser Hund, der einen treuherzig anschaut, kommen sie zu einem
und bleiben dann (mit nassem Fell und Flöhen!) vor dem Ofen liegen und wollen
untersucht werden. Die Angehörigen in der Gesundheitskommunikation kamen in
den letzten Jahren immer wieder zu allen möglichen und unmöglichen Zeitpunk-
ten (Urlaub, Feiertage, Bahnfahrten…) zu mir und haben eingefordert, dass ich
Wissen über sie schaffe. Sie haben mich herausgefordert, ihr Verhalten mit meinen
sozialwissenschaftlichen Mitteln zu beschreiben, zu verstehen und zu erklären.
Die Reaktionen der Forschergemeinschaft und der Praktiker aus dem Gesund-
heitswesen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Einige konnten durch
meine Berichte eine völlig neue Ebene sehen, waren froh, dass endlich jemand
das Thema angehe und fanden das „total wichtig“. Häufig verbunden auch mit
der Frage, wie denn nun mit den Angehörigen umzugehen sei, welche Strategien
es denn für sie gebe. Dagegen fanden andere die Kommunikation mit den Ange-
hörigen wenig relevant („erst mal die Patientenprobleme klären“), wenig interes-
sant („schon alles bekannt“), zu umfassend („ein ganzes Forschungsgebiet“) oder
schlicht zu selbstverständlich, um erforscht zu werden. Dennoch hatten viele oft
mehr als eine Anekdote aus dem privaten Kontext der Gesundheitskommunika-
tion zu bieten, was dann doch auf eine gewisse Relevanz schließen lässt. Immer
wenn ich von den pessimistischen Reaktionen demotiviert war, kamen wieder
die Angehörigen und haben mir von ihren Aufgaben, enttäuschten Erwartungen,
Ängsten und vielfältigen Kommunikationserfahrungen berichtet. Besonderen Ein-
druck haben bei mir die verwitweten Krebsangehörigen und pflegende Angehö-
rige in der ambulanten Intensivtherapie hinterlassen. Sie haben nicht nur Wissen
VII
VIII Vorwort
geschaffen, sondern mir auch zur kostenfreien Weiterbildung in Weisheitsdimen-
sionen wie Empathie, Perspektivwechsel und der Überwindung von Kontrollillu-
sionen verholfen.
Neben der Relevanzdiskussion hat mir auch die Komplexität und der relati-
onale, transaktionale, multiperspektivische oder auch systemische Charakter
des Themas immer wieder Kopfzerbrechen bereitet (z. B. Wo fängt man in der
Kausalanalyse an?; Was ist das relevante Zielkriterium? und Wer ist die relevante
Zielperson?). Auch hier waren die Reaktionen des Fachpublikums unterschied-
lich. Während die einen (vor allem Mediziner) das Thema für zu komplex hielten,
war den Soziologen meine (notwendigerweise zum Teil reduzierende) Herange-
hensweise noch nicht komplex genug. Als Kommunikationswissenschaftlerin
erschreckte mich zumindest der relationale Charakter nicht, ist er doch Definiti-
onsmerkmal der Kommunikation. Aber selbst der Rechtswissenschaftler Thomas
Klie meint im Pflegereport 2015: „Das Leben wäre unvollständig gedacht, wenn
es nur von der Fähigkeit zur Selbstbestimmung her gedacht, wertgeschätzt und
verstanden wird. Autonomie in einem tieferen Sinne erwerben wir immer aus der
Relationalität, aus der Beziehung zu anderen“ (S. 9). Ich folgte schließlich der
Empfehlung der Kommunikationswissenschaftlerin Janice Krieger, die meint,
dass die Umarmung der Komplexität die einzig mögliche Bewältigungsstrategie
für die Integration der Angehörigen wäre.
Diese Einstellung brachte allerdings auch eine Akzeptanz der Vielfalt der theo-
retischen und methodischen wissenschaftlichen Zugänge mit sich. Die kommuni-
kationswissenschaftliche Perspektive ist aufgrund ihrer Integrationsfähigkeit zwar
prädestiniert dafür, dennoch führen derartige Rand- und Mischthemen zum Teil
ins „Niemandsland der Disziplinen“, für die sich gleichermaßen jeder und keiner
zuständig fühlt. Hier unbeirrt den Fokus auf die Kommunikation mit den Ange-
hörigen zu behalten, war Herausforderung und Anliegen zugleich, bietet sich
dadurch doch die Möglichkeit quer Einblicke in ganz unterschiedliche Ansätze
und Denkweisen zu erhalten.
In diesem Sinne möchte ich all meinen sozialen (und parasozialen) Motiva-
toren und Demotivatoren, Begleitern, Tröstern, Ratgebern, Gatekeepern, Relais,
instrumentellen (finanziellen) Unterstützern u. ä. für Anregungen in Form von
Wissen, Fragen, Zweifeln und Anekdoten danken, die mit ihren Reaktionen mir
(und den Angehörigen) weitergeholfen haben. Sie zeigen, dass auch meine Arbeit
von vielen Unterstützern und Unterstützerinnen in meinem formellen und infor-
mellen Netzwerk abhängig ist.
Vorwort IX
Zur besseren Lesbarkeit wird im Übrigen weitgehend auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Dennoch gel-
ten sämtliche Personenbezeichnungen gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
Letztlich hoffe ich, dass das Forschungsfeld der Angehörigenkommunikation
(mit seinen vielen bunten Hunden) auch zahlreiche Studierende und Forschende
aus Kommunikationswissenschaft, Medizin, Psychologie, Gesundheits- und
Pflegewissenschaften, Soziologie und angrenzenden Feldern sowie Praktiker in
sozialen, pflegerischen und medizinischen Berufen inspiriert und sie zu weiterer
Wissensschaffung, Perspektivwechseln und vor allem zu konstruktiver Kommu-
nikation anregt. Ebenso freue ich mich über Hinweise und Ergänzungen, die der
Weiterentwicklung der Angehörigenkommunikation dienen.
Doreen Reifegerste
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................. 1
1.1 Relevanz der Angehörigenkommunikation ................... 1
1.1.1 Funktion der Angehörigen für Patienten ............... 1
1.1.2 Funktionen der Angehörigen für das
Gesundheitssystem ................................ 3
1.1.3 Effekte für die Gesundheit der Angehörigen ............ 5
1.2 Begriffsklärungen ....................................... 6
1.2.1 Merkmale der Angehörigen ......................... 6
1.2.2 Angehörigenkommunikation ........................ 10
1.3 Zielstellung ........................................... 12
1.4 Aufbau der Arbeit ...................................... 13
Literatur ................................................... 15
2 Modelle der Angehörigen kommunikation ...................... 19
2.1 Theorien der sozialen Unterstützung ........................ 20
2.1.1 Dimensionen sozialer Unterstützung .................. 20
2.1.2 Bewertung sozialer Unterstützung .................... 22
2.1.3 Implikationen für die
Angehörigenkommunikation ........................ 25
2.2 Rollentheorien ......................................... 27
2.2.1 Rollenkonzepte ................................... 28
2.2.2 Rollenprobleme .................................. 35
2.2.3 Implikationen für die
Angehörigenkommunikation ........................ 38
XI
XII Inhaltsverzeichnis
2.3 Modelle der triadischen Entscheidungsfindung ................ 40
2.3.1 Beteiligung an der medizinischen
Entscheidungsfindung ............................. 41
2.3.2 Wirkungen der Angehörigenbeteiligung ............... 44
2.3.3 Implikationen für die
Angehörigenkommunikation ........................ 46
2.4 Two-Step-Flow of Support ................................ 47
2.4.1 Adaption des Two-Step-Flow ........................ 47
2.4.2 Implikationen für die
Angehörigenkommunikation ........................ 51
2.5 Modelle der Gesundheitskompetenz ........................ 52
2.5.1 Gesundheitskompetenz der Patienten ................. 53
2.5.2 Gesundheitskompetenz der Angehörigen ............... 55
2.5.3 Implikationen für die
Angehörigenkommunikation ........................ 59
Literatur ................................................... 62
3 Kommunikationsrollen der Angehörigen ....................... 75
3.1 Differenzierung der Angehörigenrollen ...................... 75
3.2 Informationelle Unterstützungsfunktionen ................... 79
3.2.1 Übermittler ...................................... 81
3.2.2 Gatekeeper ...................................... 85
3.2.3 Repräsentant ..................................... 86
3.2.4 Vermittler ....................................... 88
3.3 Emotionale Unterstützungsfunktionen ....................... 90
3.3.1 Begleiter ........................................ 92
3.3.2 Tröster ......................................... 95
3.3.3 Motivator ....................................... 97
3.4 Unterstützungsrollen in der Entscheidungsfindung ............. 99
3.4.1 Ratgeber ........................................ 100
3.4.2 Interessenvertreter ................................ 103
3.5 Rollen der instrumentellen Unterstützung .................... 106
Literatur ................................................... 111