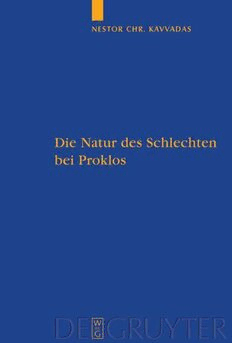Table Of ContentNestor Chr.Kavvadas
Die Natur des Schlechten bei Proklos
≥
Quellen und Studien
zur Philosophie
Herausgegeben von
Jens Halfwassen, Dominik Perler,
Michael Quante
Band 93
Walter de Gruyter · Berlin · New York
Die Natur des Schlechten
bei Proklos
Eine Platoninterpretation
und ihre Rezeption
durch Dionysios Areopagites
von
Nestor Chr. Kavvadas
Walter de Gruyter · Berlin · New York
Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung
für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein
(cid:2)(cid:2) GedrucktaufsäurefreiemPapier,
dasdieUS-ANSI-NormüberHaltbarkeiterfüllt.
ISBN 978-3-11-021230-3
ISSN 0344-8142
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschen
Nationalbibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternet
überhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
(cid:2)Copyright2009byWalterdeGruyterGmbH&Co.KG,D-10785Berlin
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungenunddieEinspeicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
PrintedinGermany
Einbandgestaltung:ChristopherSchneider,Berlin
DruckundbuchbinderischeVerarbeitung:Hubert&Co.,Göttingen
(cid:789)(cid:920)(cid:915)(cid:1023)(cid:918)(cid:561)(cid:903)(cid:915)(cid:913)(cid:905)(cid:999)(cid:918)(cid:561)(cid:912)(cid:915)(cid:921),(cid:561)(cid:793)(cid:917)(cid:987)(cid:919)(cid:920)(cid:915)(cid:561)(cid:781)(cid:901)(cid:902)(cid:902)(cid:901)(cid:904)(cid:954)(cid:561)(cid:910)(cid:901)(cid:992)(cid:561)(cid:787)(cid:901)(cid:913)(cid:901)(cid:903)(cid:909)(cid:1039)(cid:920)(cid:901)(cid:561)(cid:787)(cid:915)(cid:1022)(cid:916)(cid:907)(cid:561)
Danksagung(cid:561)
Dieses Buch ist die geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation,
die im Sommersemester 2007 von der Fakultät für Philosophie und Ge-
schichte der Eberhard-Karls Universität Tübingen angenommen wurde.
An erster Stelle möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.
Thomas Alexander Szlezák für die langwierige Betreuung dieser von ihm
angeregten Arbeit danken; Ihm habe ich darüber hinaus zu verdanken,
dass mir durch die jahrelange Teilnahme an seinen Seminaren und Kollo-
quien ein vorher ungeahnter Zugang zum Platonismus erschlossen und
das genaue Interpretieren antiker Texte erstmals bekannt gemacht wurde.
Großer Dank gebührt den Herren Prof. Dr. Bernd-Jochen Hilberath,
Prof. Dr. Hans-Reinhard Seeliger und PD Dr. Dr. Bernhard Nitsche, die
mir vor allem während der letzten Phase der Arbeit an dieser Dissertation
unschätzbar geholfen haben.
Meinen Eltern, ohne deren ständige Unterstützung diese Arbeit – neben
vielen anderen Dingen – nicht zustande gekommen wäre, ist das Buch
gewidmet; ein vom Herzen ausgesprochener Dank geht außerdem an Chry-
santhi Poupi, Tasoula Kavvada, Ourania Kavvada und Giorgos Poupis.
Bedanken möchte ich mich ebenso bei Marius Gnauk, Dr. Benjamin
Gleede und Florian Jäckel, die die sprachliche Gestalt der Arbeit mit zeit-
aufwendigen Bearbeitungen verbessert haben, sowie bei Marcus Schaaf,
der die mühevolle Aufgabe der Formatierung des Buches übernahm; fer-
ner, bei den Herren Prof. Dr. Georg Wieland, Prof. Dr. Johannes Brach-
tendorf und Prof. Dr. Friedrich Hermanni für ihre Bereitschaft, die weite-
ren Gutachten zu erstellen, und bei Dr. Konstantinos Garitsis und Dr.
Vasileios Tsakiris.
Für den großzügigen Druckkostenzuschuß bin ich der Geschwister
Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften zu Dank ver-
pflichtet. Schließlich danke ich den Herren Prof. Dr. Jens Halfwassen, Prof.
Dr. Dominik Perler und Prof. Dr. Michael Quante für die Aufnahme der
Arbeit in die Reihe „Quellen und Studien zur Philosophie“.
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung........................................................................................................1
1. Vorstellung des Themas.................................................................................1
1.1. Der Text...........................................................................................1
1.2. Zum Aufbau der Schrift................................................................2
2. Zum Stand der Forschung..............................................................................3
2.1. Die Schrift De malorum subsistentia als Quelle der
areopagitischen Theorie des Schlechten.............................................3
2.2. Die Schrift De malorum subsistentia als Kritik der
plotinischen Theorie des Schlechten...................................................5
2.3. Die Schrift De malorum subsistentia als eigenständiger
Gegenstand der Forschung...................................................................8
3. Ziel der Arbeit................................................................................................14
B. Das Verhältnis von Schlechtem und Materie....................................17
1. Der Materiebegriff Plotins...........................................................................17
1.1. Die geistige Materie.....................................................................18
1.1.1. Die Notwendigkeit der geistigen Materie...............19
1.1.2. Die Entstehung der geistigen Materie....................19
1.1.3. Die Bezeichnungen der geistigen Materie..............20
1.2. Die Materie der Sinnendinge......................................................21
1.2.1. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins der
Materie der Sinnendinge......................................................21
1.2.2. Die Erzeugung der Materie der Sinnendinge........22
1.2.3. Die Materie und die Entstehung der
Sinnendinge...........................................................................23
1.3. Die Merkmale der Materie der Sinnendinge und die
Univozität des Materiebegriffs..........................................................24
2. Der Materiebegriff bei Proklos....................................................................26
2.1. Die Stellung der Materie in der ontologischen
Hierarchie von Proklos.......................................................................26
2.2. Die Notwendigkeit der Existenz von Materie........................27
2.3. Die Entstehung der Materie.......................................................27
2.3.1. Das Problem der zeitlichen Präexistenz der
Materie vor der Schöpfung.................................................28
X Inhaltsverzeichnis
2.3.2. Ist die ewige Materie auch ontologisch
unerzeugt?..............................................................................29
2.3.3. Die Erzeugung der Materie aus dem Einen
und der ersten Unbegrenztheit...........................................30
2.4. Materie und Werden....................................................................33
2.4.1. Die Unterscheidung dreier Bedeutungen von
Materie....................................................................................33
2.4.2. Die Materie als Notwendigkeit ((cid:934)(cid:913)(cid:931)(cid:903)(cid:910)(cid:907)) und
Aufnahmeort ((cid:1024)(cid:916)(cid:915)(cid:904)(cid:915)(cid:923)(cid:967)) der Entstehung der
Sinnendinge...........................................................................34
2.4.3. Die Formung und die Beseelung der
Sinnenwelt..............................................................................36
2.5. Die ontologische Abstufung zwischen der Materie und
der ersten Unbegrenztheit..................................................................37
2.6. Bezeichnungen der Materie........................................................37
2.7. Aristotelische Elemente im Materiebegriff..............................38
2.8. Der Materiebegriff und seine Beziehung zum Schlechten
bei Proklos und Plotin........................................................................39
3. Die Identifikation der Materie mit dem Schlechten-an-sich durch
Plotin und der Versuch einer Widerlegung dieser Identifikation
durch Proklos......................................................................................................41
3.1. Die These und die Argumentation der Schrift „(cid:916)(cid:905)(cid:917)(cid:992)(cid:561)(cid:920)(cid:915)(cid:1030)(cid:561)
(cid:920)(cid:991)(cid:913)(cid:901)(cid:561)(cid:910)(cid:901)(cid:992)(cid:561)(cid:916)(cid:1009)(cid:908)(cid:905)(cid:913)(cid:561)(cid:920)(cid:932)(cid:561)(cid:910)(cid:901)(cid:910)(cid:931)“...................................................................41
3.1.1. Die Möglichkeit einer Erkenntnis des
Schlechten..............................................................................42
3.1.2. Die Verortung des Schlechten im
Wahrnehmbaren und seine Identifikation mit der
Materie....................................................................................43
3.1.3. Das Problem des „Wesens“ des Schlechten..........44
3.1.4. Die Notwendigkeit des Schlechten.........................44
3.2. Proklos’ Antwort auf die These Plotins (De malorum
subsistentia 30-37)..................................................................................45
3.2.1. Vorstellung der Stellungnahme Plotins..................45
3.2.2. Das ontologisch-monistische Argument gegen
die Identifikation der Materie mit dem ersten
Schlechten (31, 5-18)............................................................46
3.2.2.1. Überprüfung der Gültigkeit des
Arguments...............................................................49
Exkurs: Die Art des Gegensatzes zwischen
Gutem und Schlechtem........................................50