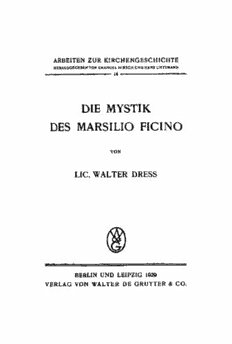Table Of ContentARBEITEN ZUR KIRCHENGESCHICHTE
HERAUSGEGEBEN VON EMANUEL HIRSCH UND HANS LI ETZMANN
14
DIE MYSTIK
DES MARSILIO FICINO
VON
LIC. WALTER DRESS
BERLIN UND LEIPZIG 1929
VERLAG VON WALTER DE GRUYTER & CO.
Druck von Walter de Gruyter ft Co., Berlin V 10
... Kol ditfjXöov tca8d>( elirtv aöxoti teal eOpov
aöri)V rpönov nvd ouv&el>£|iivr]v Tf} OTOPTI).
Acta Pauli et Theclae 19.
MEINER MUTTER
Vorwort
Die vorliegende Arbeit, abgefaßt im Herbst 1926, hofft,
das Studium der Renaissance-Philosophie, das sich lange Zeit
im allgemeinen in überlieferten Bahnen bewegt hat, dadurch
zu beleben, daß sie es an einigen großen Gesichtspunkten zu
orientieren sucht, die sie in ihren Hauptproblemen zu finden
meint.
Den Ausgangspunkt der Arbeit, der zugleich die leitenden
Linien festlegt, bildet die bisher immer übersehene, ja kurz-
weg geleugnete Tatsache, daß es sich bei der Renaissance-
Philosophie um Theologie, um scholastisch bestimmte Theolo-
gie, handelt. Eine erfreuliche Bestätigung dieser Ansicht,
die sich mir am eindrucksvollsten aus einer genauen Unter-
suchung des viel zitierten, aber niemals im einzelnen ge-
prüften sogen. Paulus- (genauer Römerbrief-) Kommentars
des Ficino ergeben hat, finde ich in dem vor kurzem er-
schienenen Buch Emst Cassirers über »Individuum und
Kosmos in der Philosophie der Renaissance«1: »Die
Philosophie des Quattrocento ist und bleibt, gerade in ihren
bedeutendsten und folgereichsten Leistungen, wesentlich
Theologie«
») Studien der Bibliothek Warborg X, 1927.
Ebda. S. 4; vgl. S. 1 und S. 65 der »Versuch der Restauration
der scholastischen Gedankenformen gewinnt in ihr allmählich mehr und
mehr an Ausbreitung und Stärke« usw. Zu S. 75 wäre in diesem Zu-
sammenhang zu bemerken, daß die innere Verbindung des »dogma-
tischen Gedankenkreises des Christentums« mit der Überwindung
»jeder dogmatischen Enge« (durch die Idee der allgemeinen Religion),
wie sie bei Ficino durch die apologetische Verwendung dieser Idee
hergestellt ist, leider nicht heraustritt. Vgl. oben S. 125 A. 2.
VI Vorwort
Auf der anderen Seite freilich scheint mir gerade dieses
Buch die Notwendigkeit von Einzeluntei'suchungen auf dem
in Frage stehenden Gebiet dringend nahe zu legen. Besonders
die These von der Bedeutung des Cusaners für die Philosophie
der Renaissance ist doch wohl durch die geistvolle, großzügige
Schrift Cassirers noch nicht weit genug geklärt. Ich habe
deshalb versucht, so weit wie möglich Ficino selbst reden zu
lassen, um zunächst einmal ein wirklich deutliches Bild seines
Denkens zu gewinnen.
Dabei ergab sich bald, daß ein Kampf gegen drei Fronten,
die sich teilweise berühren und überschneiden, teilweise aber
auch einander durchaus entgegengesetzt sind, zu führen war.
Einmal war sehr bald klar, daß die verbreitete Meinung —
die a priori schon verdächtig einfach klingt —, in dem Re-
naissance-Platonismus einfach einen erneuerten Neuplatonis-
mus feststellen zu können, einer sehr weitgehenden Einschrän-
kung und Modifizierung bedarf. Dann wurde es nötig, den
schnell populär gewordenen Satz von der kirchlich unabhän-
gigen, an den paulinischen Briefen (vor der Reformation)
selbständig sich erbauenden Frömmigkeit des Florentiner
Platonikers vom tatsächlichen Textbefund aus völlig umzu-
stoßen. Endlich mußte ich mich von der Unrichtigkeit der An-
sicht überzeugen, daß Ficino dem Dogma von der Offenba-
rung der christlichen Religion den Gedanken der allgemeinen
Religion bewußt habe entgegensetzen wollen.
Man sieht, die drei zu bekämpfenden Fronten laufen teils
miteinander, teils gegeneinander, teils durcheinander. Daher
glaubte ich, die Ergebnisse meiner Untersuchung der Klar-
heit wegen möglichst zuspitzen zu müssen. Ich hoffe indessen,
eine Überspitzung vermieden zu haben.
Die richtigen Beobachtungen, die der ersten und dritten
der drei gekennzeichneten Auffassungen zugrunde liegen,
müssen in anderer Hinsicht verwendet werden, als ihre Ver-
treter meinen, und erhalten dadurch dann freilich auch einen
anderen Sinn. Die Schwierigkeit liegt darin, daß Ficino in
Wirklichkeit nicht war, was er sein wollte und zu sein glaubte.
Vorwort VII
Es ist nur zu selbstverständlich, daß diese Arbeit, wenn
sie heut neu geschrieben werden könnte, in mancher Beziehung
anders gestaltet wäre. Das liegt in der Natur der zwischen
Niederschrift und Druck liegenden Zeitspanne und einer da-
durch bedingten Entfremdung.
Sachlich finde ich, auch nach Berücksichtigung der in-
zwischen erschienenen Literatur, nichts zu ändern und glaube
daraus das Recht zur Veröffentlichung herleiten zu dürfen.
Berlin-Lichterfelde, im Juli 1929.
W. Dreß.
Inhalt
Seite
I. Die Voraussetzungen der Arbeit des Ficino 1—23
Die geistige Situation des italienischen Humanismus
in der Frührenaissance 1—2
Florenz und die Medici 2
Die Autorität Piatos 3—5
Die Bedeutung des Neuplatonismus : philosophia
perennis 5—6
Aristoteles der Weg zu Plato 6—8
Das Christentum: Die Autorität Augustins 9—11
Die zeitgeschichtlichen Voraussetzungen: Alexan-
drismus und Averroismus 11—13
Die Aufgabe Ficinos eine apologetische: die Geltung
des göttlichen = mosaischen und christlichen Gesetzes
durch die platonisch-neuplatonische Philosophie zu
erweisen 13—17
Unsere Aufgabe eine historische und eine systemati-
sche: Ist der »Piatonismus« des Ficino dem mittel-
alterlichen Piatonismus gegenüber etwas Neues ?
Wie wird er dem Christentum gerecht ? 18—23
II. Die Mystik des Marsilio Ficino 24—150
1. Welt und Gott 24—48
Die Voraussetzungen griechischen Denkens 24—26
Das Weltsystem Ficinos 26—32
Sein Ausgangspunkt im Unterschied von Neuplato-
nismus und Scholastik 32—35
Entwicklung des Gottesbegriffs (Gott als immanentes
Weltelement) 35—48
2. Die Bedeutung der Seele 48—60
Ihre Mittelstellung als Angelpunkt der Welt 48—51
Drei Seelenarten 51—52
Konzentrierung des Interesses auf die menschliche
Seele 52—54
Drefl, Mareillo Ficino. b
X Inhalt
Seit«
Die Seele als Mikrokosmos 54—59
Die Seele stellt den Erkenn tniszusammenhang her 59—60
3. Der Weg zu Gott durch den Intellekt 60—89
Ficinos Erkenntnistheorie 60—67
Sein »Ontologismus» und seine Übernahme neu-
platonischer Mystik 67—76
Die menschliche Seele als Trägerin des Erkenntnis-
zusammenhangs 76—79
Der Mensch Deus in terris 79—82
Die auf die Erkenntnis der Schöpfungsmethode
Gottes begründete Kongenialität des Menschen .... 82—89
4. Der Weg zu Gott durch das Gefühl 89—114
Die in der Erkenntnis liegende Lust ist in der voluntas
begründet 89—90
Rückwirkung auf den Gottesbegrifi 91—92
Neuer Schöpfungsbegrifi 93—99
Gott und Welt durch die Schöpfungslust verbunden 99—104
Neue Bestimmung des Verhältnisses des Menschen
zu Gott, das im lustbetonten Gefühl gegeben ist. Der
fcVoluptarismus« des Ficino 104—114
5. Ficinos Auffassung der Religion 114—150
Übernahme christlicher Gedanken? 114—117
Gott ist käuflich 117—118
Die Religion als gegenseitige Freundschaft zwischen
Gott und Mensch wie zwischen Gleichgestellten .... 118—123
Die Religion als Fundament der Unsterblichkeit des
Menschen 124
Folglich dem Menschengeschlecht angeboren 125—128
Die Religion als Genuß Gottes, d. h. als GenuB der
eigenen Unsterblichkeit 128—129
Liberum arbitrium, kein Sündengefühl 129—136
Religion und Philosophie 136—137
Die Eigenart des Christentums kann nur auf ethische
Vorzüge gegründet werden 137—143
Die neuplatonischen Gedanken von der Gefangen-
schaft der Seele als Rückschlag auf die Vergötterung
des irdischen Menschen 143—145
Das Verhältnis Ficinos zur Scholastik 145—146
und zum Neuplatonismus 146—148
Seine mystische Religiosität eine neue, aus dem Geist
der Renaissance heraus geborene Konzeption 148—150
III. Der Römerbriefkommentar des Ficino 151—216
1. Formale Probleme 151—183