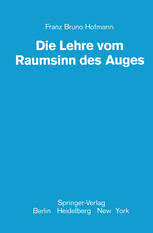Table Of ContentFranz Bruno Hofmann
Die Lehre yom
Raumsinn des Auges
Reprint
Springer-Verlag Berlin· Heidelberg· New York 1970
Reprint aus "Handbuch der gesamten Augenheilkunde" (GRAEFE/SAEMISCH)
2. Auf!. Band III (Physiologische Optik),
Kap. XIII -Teil1 (1920) und Teil 2 (1925)
Verlag von Julius Springer Berlin
ISBN-13: 978-3-642-86307-3 e-ISBN-13: 978-3-642-86306-6
001: 10.1007/978-3-642-86306-6
Das Werk ist urheberrechtiich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte. insbesondere die der Ubersetzung. des
Nachdrucks. der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung. der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ahnlichem
Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben. auch bei nur auszugsweiser Verwertung vorbehalten.
Bei Vervielfiiltigungen fiir gewerbliche Zwecke ist gemaB §54 UrhG eine Vergiitung an den Verlag zu zahlen. deren Hohe
m~ dem Verlag zu vereinbaren ist.
© Copyright 1919 and 1925 by Julius Springer in Betin
Softcover reprint ofthe hardcover 2nd edition 1925
Library of Congress Catalog Card Number 79-104041
Helnummer 1175
Kapitel Xlll
Die Lehre yom Raumslnn
Von F. B. Hofmann
Mit 155 Figuren im Text und 1 Tafel
Erster Teil
l'Ieite
L Einleitung . . . . . . . . 1
lI. Die relative Lokalisation im eben en Sehfeld 8
1. Die Irradiation. • . • . . . 8
2. Das Auflosungsvermogen des Auges. . 19
a) Allgemeines und Methodik . . . . . 19
bj Die Wahrnehmung einzelner Punkte und Linien. 23
c) Sonderung mehrerer Punkte, Linien und Fllichen voneinander 28
d) Sehschiirfe und Formensehen. . . • . . . . . . . . 34
el Die Abhiingigkeit der Sehschiirfe von der Beleuchtung 38
f} Das Auflosungsvermogen tier Netzhautperipherie. . . 48
g) Die Sehschiirfe des SchieJauges. . . . . . . . . . . 53
3. Die Feinheit des optischen Raumsinns nach Hohe und Breite. 55
4. Die Beziehungen der Raumschwelle und des Auflosungsvermogens zu
den Elementen des Perzeptionsapparates 58
5. Vergleich von Richtungen und Winkeln 71
6. Das Augenma13. . . . . . . 81
7. Das Formensehen . . . . . . . . . 92
8. Die Gestaltwahrnehmungen
a) Allgemeines und Metamorphopsien 104
b) Die geometrisch·optischen Tiiuschungen . 112
Ubersicht der wichtigsten Tiiuschungen 113
Erkliirungsversuche. . . . . . . . . 123
A. Annahme peripheren Ursprungs der geometrisch -optischen
Tiiuschungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
B. Annahme zentraler Ursachen der geometrisch -optischen
Tiiuschungen. . . . . . . . . . . . . . , . . . . 130
9. EinfluB der Erfahrung auf die Lokalisation im ebenen Sehfeld. 142
10, Die Verteilung der Raumwerte auf der Einzelnetzhaut 164
11. Die Ausfiillung des blinden Flecks. 190
Literatur .............. , 198
Zweiter Teil
III. Netzhautkorrespondenz ....... . 215
1. Das binokulare Sehfeld. . . . . . . . . 215
2. Bestimmung der korrespondierenden Netzhautstellen 217
3. Der Horopter. , . . . . . 225
4. Die Sehrichtungen . . . . . . . . . . . 230
o. Theorie der Korrespondenz . . 236
6. Unterscheidbarkeit rechts- und links1iugiger Eindriicke 255
IV InhaItsverzeichnis.
Selte
IV. Augenbewegungen . . . . . . . . . . . . . 259
1. Allgemeines. Der Drebpunkt des Auges. . . 259
2. Das Listingsche Gesetz der Augenbewegungen 265
3. Die Wirkung der einzelnen Augenmuskeln . 279
4. Das Blickfeld. . . . 289
o. Innervation der Augenmuskeln . . . 296
a) Aligemeines . . . . . . . . . . . 296
b) Die Zentren der Blickbewegungen. 304
c) Fusionseinstellung und Fusionsbewegungen 312
dl Echte Reflexe und Tonus der Augenmuskeln 320
e) Die Regulierung der Augenbewegungen 343
V. Die Ricbtungslokalisation 361
VI. Die Tiefenlokalisation. . . . . . . . 411
1. Die relative Tiefenlokalisation 411
2. Die Abstandslokalisation (absolute Tiefe) 466
3. Sehferne und SebgroBe. . . . . . . . 489
4. Haploskopie und Stereoskopie. . . . . 520
VII. Bewegungssehen und Gestalttheorie . 537
VIII. Der optische Raumsinn im Verband des Gesamtorganismus 592
Litera tur . . . . 613
Berichtigungen. 663
Sachverzeichnis 664
I. Einleitnng.
Alltaglich konnen wir uns davon iiberzeugen, daB wir die Gegenstande
unserer Umgebung durchaus nicht immer in der Form und in der raum
lichen Anordnung sehen, die ihnen nach der Gesamtheit unserer Erfah
rungen »wirklichc zukommt. Besonders auffallende Unterschiede ergeben
sich daraus, daB uns aIle Dinge, wenn wir sie aus sehr groBer Entfernung
sehen, viel kleiner erscheinen, als in der Nahe. An Objekten, die sich
weit nach der Tiefe zu erstrecken, stimmen infolgedessen auch die sicht
baren GroBenverhaltnisse der einzelnen Teile nicht mit den wirklichen iiber
ein. So ragen ferne Bergriesen iiber die nahen Vorberge scheinbar nur
ganz wenig hinaus, obwohl sie sie in Wirklichkeit an Hohe weit iibertreffen.
Daher sehen wir die Formen eines nahen Gebirgszuges yom Tale aus ganz
falsch. Die Schienenstrange einer langen geraden Eisenbahnstrecke, auf
der wir stehen, scheinen gegen die Ferne zu zusammenzulaufen usf. Wir
miissen demnach einen Unterschied machen zwischen den wirklichen Ob
jekten und den Gesichtswahrnehmungen, die durch sie hervorgerufen wer
den, und die wir nach HERING die »Sehdingec 1) nennen. Die Gesamt
heit aller gleichzeitig wahrgenommenen Sehdinge bildet den subjektiven
Sehraum oder das Sehfeld. Ihm entspricht im objektiven Raum das
Gesichtsfeld, d. i. jener Teil des wirklichen Raums, der uns bei einer
gegebenen Augenstellung gleichzeitig sichtbar ist.
Der Unterschied zwischen den raumlichen Eigenschaften des auBeren
Objekts und des ihm entsprechenden Sehdings, zwischen dem objektiven
Gesichtsraum und dem subjektiven Sehraum, reicht aber noch weiter, als
es die oben angefiihrten Beispiele zeigen, die bloB die vielfachen Wider
spriiche zwischen beiden veranschaulichen. Wenn wir einen MaBstab an
ein Objekt anlegen und seine Ausdehnung messen, so kennen wir zwar das
objektive MaB des Gegenstandes, aber damit ist gar nichts dariiber aus
gemacht, wie groB wir nun den MaBstab und das mit ihm gemessene Ob
jekt subjektiv sehen. Beide konnen uns je nach den Umstanden ver-
l) Eine sehr eingehende Zergliederung dieses Begriffes findet man bei H. HOF-
1I1ANN (!!O). Die damit zusammenhangenden erkenntnistheoretisehen Fragen gehBren
nieht mehr zu unserem Thema.
Hofmann, Physioiogische Optik !Raumsinn). I.
2 Physiologische Optik.
schieden groB erscheinen. Man blicke mit einem Auge, wahrend das andere
geschlossen ist, gegen ein mehrere Meter entfemtes Fenster und halte nun
einen Finger so nahe vor das sehende Auge, daB man angestrengt auf ihn
akkommodieren muB. Sob aId man dies tut, schrumpft das Fenster zu
sammen und erscheint viel kleiner, als wenn man es ohne Akkommodations
anstrengung betrachtet. Gerade so verhalt sich natiirlich auch ein MaB
stab, der gleichzeitig an das Fenster angelegt ist. Das objektive MaB des
Fensters sagt uns also nichts dariiber, wie groB uns sowohl der MaBstab,
als das mit ihm gemessene Objekt - das Fenster - subjektiv erscheint,
d. h. das raumliche MaB der Objekte gibt uns noch keineswegs zugleich
ain Mall fiir die GroBe der Sehdinge. Daher wissen wir auch nicht, ob
andere Menschen diE\ Gegenstande alle gleich groB sehen, wie wir, oder
ob sie ihnen etwa alle stets groBer oder kleiner erscheinen, als uns. Ware
das letztere der Fall, so wiirden wir es in keiner Weise merken. Was von
anderen Menschen gilt, trifft natiirlich auch fUr den Vergleich mit dem
Sehen der Tiere zu. Man hat friiher das leichte Scheuen der pferde darauf
zuriickfUhren wollen, daB sie alle Gegenstande viel groBer sahen, als der
Mensch, aber diese Erklarung ist ganz unhaltbar (vgl. v. MADAY (~2).
S. ~ 5 ff.).
Nachweisbar sind bei uns, wie an Anderen, nur Anderungen im sub
jektiven MaBstabe des Sehfeldes. An uns selbst konnen wir sie subjektiv
durch Vergleich mit friiheren Erfahrungen feststeIIen, wie in dem oben an
gefiihrten Versuch mit dem Fenster. Bei Anderen sind wir im allgemeinen
ebenfalls auf solche Vergleiche und die Aussagen der Personen dariiber
angewiesen. Manchmal auBert sich die Anderung des subjektiven GroBen
maBstabes aber auch objektiv, z. B. beim Schreiben. Nehmen wir an, eine
Person sehe zeitweilig alle Gegenstande betrachtlich groBer als vorher, soo
werden ihr auch die Buchstaben beim Schreiben, die mit dem friiher ge
wohnlich gebrauchten AusmaB von BewegungsgroBe ausgefiihrt sind, jetzt
viel zu groB erscheinen. Um sie wieder auf die gewohnte scheinbare GroBe
zu bringen, muB sie dieselben nunmehr kleiner machen, als vorher, mit der
Makropsie ist eine Mikrographie verbunden. Voraussetzung dafiir ist aller
dings, daB sich die Person beim Schreiben mehr vom Gesichtssinn lei ten
liiBt, als von den Sinneseindriicken, die sie von der schreibenden Hand
empfangt. In dieser Beziehung sind besonders belehrend die von A. PICK (23),
FISCHER (48,49), LIEBSCHER (24) und SITTIG (24; hier weitere Literatur) mit
geteilten FaIle von Makropsie mit Mikrographie bei Hysterischen. Es liiBt
sich voraussehen, daB dieselben Erscheinungen, wie beim Schreiben, auch
beim Zeichnen in natiirlicher GroBe und bei plastischen Nachbildungen, iiber
haupt bei allen ,. Herstellungsarbeiten auftreten wiirde, freilich nur dann,
c
wenn der Gesichtssinn bei der Ausfiihrung leitend ist, und wenn sie sich
auf die Wiedergabe von Gegenstanden aus dem Gedachtnis beschranken.
I. Einleitung. 3
Bei der Nachbildung von Gegenstiinden der sichtbaren Umgebung stimmt
ja der subjektive MaBstab fUr die Vorlage und die Nachbildung miteinander
iiberein. Diese wiirden also richtig wiedergegeben werden, trotzdem sie
der Person im angefiihrten FaIle von Makropsie zu groB erscheinen. Solcbe
Untersuchungen, die meines Wissens noch nicbt angestellt worden sind,
wiirden die hier besprochenen Zusammenhiinge zwischen scheinbarer und
»wirklicherc GroBe sebr gut veranschaulichen. Sie wiirden namentlicb an
schaulicb die Beschriinkung aufzeigen, die uns in bezug auf das Erkennen
der RaumgroBen auferlegt ist. Ne hmen wir an, ein anderer batte von
jeher alles viel groBer geseben, als wir, so wiirden ihm auch seine Be
wegungen entsprechend groBer erseheinen, er wiirde sich gewohnt haben, mit
einem kleineren AusmaB von Bewegung die Vorstellung einer viel groBeren
Strecke zu verkniipfen 1). Wir wiirden also die abweichende GroBen
sehatzung aus seinen Bewegungen nicht erkennen, und aueh sonst konnte
er es uns in keiner Weise mitteilen, daB ihm alles viel groBer erscheint,
als uns. Die GroBe der Sehdinge ist also eine subjektive Reaktion unseres
Sehorgans auf den auBeren Reiz, die individuell variieren kann und ob
jektiv nicht meBbar ist.
Nach dem Gesagten ist ein Vergleich der absoluten GroBe der Seh
dinge mit einer gedacbten »wirklichenc GroBe der Objekte unmoglichj wir
konnen nur die GroBenverhaltnisse der Sehdinge und ihre gegenseitige
Lage vergleichen mit den GroBenverhaltnissen und der gegenseitigen Lage
der ihnen entsprechenden auBeren Objekte. Wir bezeichnen die scheinbare
gegenseitige Lagerung der Sebdinge, in der aucb die scheinbare Form
und die GroBenverhaltnisse derselben mit inbegriffen sind, als die relative
optische Lokalisation.
Unter den Sehdingen zeiehnen sich die sichtbaren Teile unseres eigenen
Korpers dadurch aus, daB sich in ihnen die riiumlichen Daten, die wir vom
Gesichtssinn erhalten, mit denen der Hautsinne, der Sensibilitat der tiefen
Teile und vom statisehen Organ zum Vorstellungsbilde unseres Leibes ver
bind en. Dieser unterscheidet sich ferner von allen iibrigen Sehdingen dadurcb,
daB seine Lage und Bewegung ganz unmittelbar an ·unsere willkiirlichen
Innervationen gekniipft sind. Dadureh hebt er sich als das .Iche von der
fremden Umgebung abo
Das leibliehe Ieh nimmt als Objekt einen bestimmten Platz im wirk
lichen Raum ein. Wir konnen es zum Anfang eines rechtwinkeligen raum-
4) Solange sieh diese gegenseitige Anpassung noeh nieht hergestellt hat,
konnen allerdings die optisehe und die taktile GroJ3ensehatzung voneinander dif
ferieren. Beachtenswert ist in dieser Beziehung besonders die Angabe mehrerer
operierter Blindgeborener, daJ3 ihnen die siehtbaren Gegenstaode im Anfang auf
fiUlig groB ersehienen.
*
1
4 Physiologisehe Optik.
lichen Koordinatensystems machen, wobei wir zuniichst den einfachsten Fall
zugrunde legen, daB sich Rumpf und Kopf in aufrechter Lage befinden und
der Kopf geradeaus nach vorn - in der sogenannten Primiirslellung -
stehl. Als erste Ebene des rechtwinkeligen Koordinatensystems nehmen wir
dann die gemeinsame sagittale Medianebene des Kopfes und Rumpfes,
die in diesem Falle vertikal steht und die im wirklichen Raume nach rechts
und links gelegenen Objekte voneinander scheidet. Als zweite Koordinaten
ebene nehmen wir die durch die Drehpunkte der beiden Augen gelegte
Horizontalebene. Wir nennen sie die horizontale Hauptebene oder den
Augenhorizont. Sie trennt die im objektiven Raum nach oben und nach
unten von unseren Augen befindlichen Gegenstiinde. Die dritte Koordinaten
ebene ist die durch die Drehpunkte der beiden Augen gelegte Vertikal
ebene, die frontale Hauptebene. Sie trennt im objektiven Raum die
vor und hinter uns liegenden Gegenstiinde voneinander. Da sich das bin
okulare Gesichtsfeld beim Blick geradeaus nach auBen hin gewohnlich nur
wenig iiber 90° erstreckt, verliiuft die frontale Hauptebene dicht an der
hinteren Grenze desselben und die allermeisten sichtbaren Gegenstiinde Jiegen
nach vorn von ihr. Rechts und links von der Medianebene Hegen die ihr
parallel verlaufenden seitlichen Sagittalebenen, nach oben und unten yom
Augenhorizont die ihm parallelen Horizontalebenen, nach vorn von der fron
talen Hauptebene die frontalparallelen Ebenen.
Von diesen Ebenen im wirklichen Raum unterscheiden wir nun die
subjektiven Sagittal-, Horizontal- und frontalparallelen Ebenen im Seh
raum. Die subjektive Medianebene, der subjektive Augenhorizont und die
Frontalebene, in der uns unser Kopf zu Hegen scheint, Hefern uns ein
Bezugssystem, das im Sehfeld ebenso zur Orientierung dient, wie das ent
sprechende objektive Koordinatensystem im wirklichen Raum. Wir bezeich
nen die Lokalisation der Medianebene, des Augenhorizontes und der Frontal
ebene unseres Kopfes, sowie die Lagebestimmung der Sehdinge in bezug
auf diese Ebenen als die a b sol ute L 0 k a lis a t ion 1). Wie zwei Seh
dinge gegeneinander gelagert sind, ist also nach dieser Definition eine
Frage der relativen optischen Lokalisation. Ob aber ein Gegenstand gerade
vor uns in der Medianebene, oder nach rechts oder links von ihr - in
AugenhOhe oder darunter oder daruber zu Hegen scheint, ob er nahe
vor uns oder weit weg erscheint, das alles fallt unter die absolute Lo
kalisation.
i) Der Ausdruek absolute Lokalisation bezieht sieh hier aussehlieJ3lich auf die
Orientierung im subjektiven Sehraum und hat niehts zu tun mit der Frage naeh
der .Existenz eines wirkliehen .absoluten Raumes«. Auch ist bei den obigen Aus
einandersetzungen immer ruhige aufreehte Korperbaltung und Primlirstellung des
Kopfes vorausgesetzt. Wie sieh die optisehe Lokalisation bei anderen Lagen des
Kopfes und bei Bewegungen verhlilt, wird spater zu bespreehen sein.
I. Einleitung. 5
Absolute und relative Lokalisation hangen eng mileinander zusammen.
Das zeigt sich, wie wir spater sehen werden, besonders in der Lokalisation
nach der Tiefe. Der gleiche innige Zusammenhang besteht aber auch
zwischen der absoluten und relativen Lokalisation nach Hohe und Breite,
ja in gewissen Fallen lassen sich absolute und relative Lokalisation nach
Hohe und Breite sogar schwer voneinander trennen. Wenn wir unter
suchen, unter welchem Winkel sich zwei Striche schneiden miissen, um als
rechtwinkeliges Kreuz zu erscheinen, so ist das eine Frage der relativen
Lokalisation, denn es handelt sich dabei bloll um das gegenseitige Lage
verhaltnis der Sehdinge untereinander. Wenn wir aber fragen, wie ein
Strich liegen mull, um uns vertikal, und wie ein anderer verIaufen mull,
um uns horizontal zu erscheinen, so bewegen wir uns im Gebiete der abso
luten Lokalisation. Wenn nun aber die Striche, die uns horizontal und
vertikal erscheinen, in Wirklichkeit keinen rechten Winkel miteinander bil
den, so ist dies gleichzeitig auch eine Angelegenheit der relativen Lokali
sation.
Vergleichen wir die absolute Lokalisation im Sehraum mit der Lage
rung der Objekte im wirklichen Raum, so konnen wir, so we it es sich um
den Abstand der Nebenebenen des Bezugssystems von den Hauptebenen
desselben handelt, aueh hier nur GrollenverhaItnisse feststellen. Das
Bezugssystem selbst aber ermoglicht dariiber hinaus zu vergleichen, ob
die wirkliche Lage der Hauptebenen durch den Gesichtssinn richtig wieder
gegeben wird, oder niehl. Wir konnen demnach bestimmen, ob wir die
in der wirklichen Medianebene liegenden Gegenstande auch gerade vor
uns sehen. Wenn dies nicht der Fall ist, so konnen wir die Ebene im
objektiven Raum feststellen, die uns subjektiv median zu liegen scheint.
Wir nennen sie die seheinbare Medianebene. Ihre Abweichung von der
wirklichen Medianebene konnen wir objektiv messen, und wir erhalten da
durch ein wirkliches Mall fiir die Abweichung der scheinbaren von der
wirklichen Medianebene im objektiven Raum. Das Gleiche gilt vom sehein
baren und wirklichen Augenhorizonl.
Wir werden uns im Folgenden zunachst mit der relativen Lokalisation
nach Hohe und Breite beschiiftigen, wahrend wir die Lokalisation nach der
Tiefe erst spater erortern wollen. Bei den Untersuchungen der Hohen
und Breitenlokalisation miissen wir aber wegen des Einflusses, den die
Tiefenlokalisation auf die scheinbare GroBe der Objekte ausiibt, den schein
baren Tiefenabstand der Gegenstande vom Beobachter mit beriicksichtigen
Wir untersuchen daher die Lokalisation nach Hohe und Breite zunachst in
dem einfachen Falle, dall die Gegenstande, die wir zur Untersuchung be
niitzen, in einem eben en , frontalparallelen Sehfelde zu liegen scheinen.
Das wird beim binokularen Sehen dann erreicht, wenn sich die sichtbaren
GegensUinde im Langshoropter befinden. Dieser bildet aber nur bei einer
6 Physiologische Optik.
gewissen mittleren Entfemung eine ebene FUiehe, diesseits und jenseits
dieses Mittelwertes sieht eine wirklieh ebene FUiehe gekriimmt aus. Soweit
dies einen Fehler verursaeht, kann man ihm dadureh entgehen, daB man
bloB mit einem Auge beobaehtet. Beim einaugigen Sehen treten die em
pirisehen Motive der Tiefenlokalisation in den Vordergrund. In diesem
Falle Mnnen wir daher die optisehe Lokalisation in gleiehen Tiefenabstand
dadureh siehem, daB wir die dem einen Auge allein siehtbaren Objekte
auf einer frontalparallelen ebenen Flaehe anbringen. Nur muB dann aueh
der Hintergrund, von dem sie sieh abheben, als frontalparallele Ebene ge
sehen werden, die Flaehe darf also nicht etwa infolge einseitig absehat
tierter Beleuchtung schrag zu liegen scheinen.
Die Moglichkeit, die Sehdinge an verschiedene Orte des Sehraums
zu lokalisieren, ist dadurch gegeben, daB das von den auBeren Objekten
ausgehende Licht als Reiz auf differente Stellen eines raumlieh ausge
dehnten Sinnesapparates einwirkt, zunachst auf das flachenhaft ausgebreitete
Sinnesepithel der Netzhaut, dessen Erregungen durch die angeschlossene
nervose Leitung den zugehorigen Himteilen zugefiihrt werden. Den einzel
nen Orten des subjektiven Sehfeldes korrespondieren also riiumlich ge
sonderte Stell en des optischen Sinnesapparates - nieht bloB der Netz
haut -, deren Gesamtheit wir mit HERING als das somatische Sehfeld
bezeichnen. Wenn wir daher den Beziehungen zwischen den raumlichen
Verhii.1tnissen im wirklichen oder objektiven Gesichtsfeld und der subjek
tiven Lokalisation im Sehfeld nachgehen wollen, so werden wir zunachst
irhmer das Verhiiltnis der Lage der auBeren Objekte zu den Teilen des
somatischen Sehfeldes zu beriicksichtigen haben. Auch hier besprechen
wir wiederum zuerst die einfaehsten Verha1tnisse, die beim Sehen mit einem
Auge in bezug auf die Lokalisation Bach Hohe und Brehe im ebenen Seh
feid obwalten.
Dabei sind im allgemeinen beziiglich des Zusammenhanges zwischen
dem Lichtreiz, den Vorgangen im somatischen Sehfeid und den damit ein
hergehenden BewuBtseinsvorgangen, dem Sehen von Gegenstanden, folgende
Satze der Nervenphysiologie zu beachten. Man hat zunachst streng zu
unterscheiden den auBeren Reiz und den durch ihn im Nerven ausgelosten
Vorgang der Nervenerregung. Es ist nicht zulassig zu sagen, der Reiz
pflanze sich im Nerven fort, vielmehr ist de:r Vorgang, der im Nerven forl
geleitet wird, wie wir heute mit gutem Grunde annehmen, ein Stoffweehsel
prozeB, der mit dem auBeren Reiz nichts Gemeinsames hat. Aueh wird
dabei nieht die Energie des Reizes nach konstanten Aquivalenten in die
des Erregungsvorganges umgesetzt. Es erscheint also im Sehorgan nicht
etwa die Energie des Liehtstromes oder eines Teiles desselben nach der
Reizung in Form einer hypothetischen »Nervenenergie c wieder, vielmehr
lost der auBere Reiz den ProzeB der Nervenerregung bloB aus. fibrigens