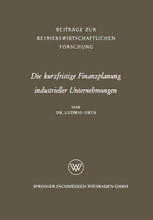Table Of ContentBeiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
Herausgegeben von
Prof. Dr. E. Gutenberg, Prof. Dr. W. Hasenack, Prof. Dr. K. Hax
und Prof. Dr. E. Schäfer
Band 13
Dr. Ludwig Orth
Die kurzfristige Finanzplanung
industrieller U nternehmungen
SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH
1961
ISBN 978-3-663-06104-5 ISBN 978-3-663-07017-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-07017-7
Verlags-Nr. 023213
Alle Rechte vorbehaltcn
© Springer Fachmeclien Wiesbaden 1961
Urspriinglich erschienen bei Westdeutscher Verlag 1961
Gesamtherstellung: Stalling AG, Oldenburg
v
Geleitwort
In der Praxis der Unternehmungs führung setzt sich immer stärker der Gedanke
der vorausschauenden Planung durch. Deshalb überrascht es nicht, daß sich die
betriebswirtschaftliche Literatur in den letzten Jahren bevorzugt mit Fragen der
Planung und der Planungsrechnung beschäftigt. Allerdings behandeln die ein
schlägigen Veröffentlichungen durchweg sehr spezielle Probleme aus den ver
schiedenen Bereichen der unternehmerischen Planung, während man Unter
suchungen vermißt, die einen Gesamtüberblick über die einzelnen Teilplanungen
der Unternehmung vermitteln.
Von diesen Teilplanungen gebührt der Finanzplanung deshalb besonderes
Interesse, weil die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes zu den vor
dringlichsten Aufgaben der Unternehmungsführung gehört. Da nun die Fragen
der langfristigen Finanzplanung in der Finanzierungslehre relativ intensiv erörtert
worden sind, bleibt die vorliegende Arbeit bewußt auf eine Gesamtdarstellung der
kurzfristigen Finanzplanung beschränkt.
Der Verfasser geht dabei von dem Gedanken aus, daß man die Finanzplanung
als einen Entscheidungsprozeß aufzufassen hat. Dieser Prozeß beginnt mit einer
Vorschaurechnung, die Auskunft über den zu erwartenden Finanzbedarf oder
Finanzüberschuß gibt. Im Anschluß daran sind die Maßnahmen, die zur Deckung
des Geldbedarfs oder zur Verwendung des Überschusses erforderlich sind, fest
zustellen und unter dem Aspekt der finanzwirtschaftlichen Zielsetzung zu ana
lysieren. Als Ziel der kurzfristigen Finanzplanung bezeichnet der Verfasser die
optimale Liquidität, d. h. jene Zahlungsbereitschaft, bei der unter Wahrung der er
forderlichen Sicherheit ein maximaler Gewinn erzielt wird. Dieses Ziel ist maßge
bend für die Bestimmung des Optimums aus der Gesamtzahl der möglichen Finanz
maßnahmen und damit für die den Planungsprozeß abschließende Entscheidung.
Bei der Darstellung der einzelnen Phasen der kurzfristigen Finanzplanung geht
der Verfasser jeweils auf die in der Praxis üblichen Methoden ein. Darüber hinaus
verwertet er die neueren Erkenntnisse aus den Bereichen der Entscheidungs-und
Ungewißheitstheorie. Neben praktischen Problemen werden also auch theore
tische Grenzfragen in die Erörterung einbezogen. Gerade die Auseinandersetzung
mit diesen Grenzfragen, die im deutschen Schrifttum bisher kaum diskutiert
wurden, ist von grundsätzlichem Interesse und für den Praktiker schon deshalb
wertvoll, weil dabei die Einfiußfaktoren, welche die unternehmerische Entschei
dung bestimmen, besonders deutlich hervortreten.
Frankfurt (Main), im August 1961 Kar! Hax
VII
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ................. ,.,..................... . . . . . . . . . . . . . . 1
I . Der Zusammenhang zwischen Finanzwirtschaft und Finanzplanung . 1
II. Problemstellung und Aufbau der Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Erster Teil
Die Grundlagen der kurzfristigen Finanzplanung
I. Die Finanzplanung im System betriebswirtschaftlicher Planung . . . . . . . 13
1. Begriffliche Klarstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
a) Der allgemeine Planungsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
b) Der Begriff der Finanzplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Die Zielsetzung der Finanzplanung ............................ 22
a) Die optimale Liquidität als Hauptziel der Finanzplanung ....... 22
1) Die Ableitung der optimalen Liquidität aus der unternehmeri-
schen Zielsetzung ...................................... 22
aa) Die unternehmerische Zielsetzung. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
bb) Die Konkretisierung der unternehmerischen Zielsetzung
im Hinblick auf die Finanzplanung ................... 29
2) Das Wesen der optimalen Liquidität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
b) Die mit der Finanzplanung verbundenen Nebenzwecke........ 33
1) Rationalisierung der betrieblichen Finanzwirtschaft. . . . . . . .. 33
2) Lenkende Funktionen .................................. 36
3) Koordination und Vervollständigung der Unternehmungs-
planung ............................................... 36
3. Der Prozeß der Finanzplanung und seine Stufen ..... . . . . . . . . . . .. 38
11. Die Voraussetzungen der Finanzplanung .......................... 40
1. Änderungen der finanzwirtschaftlichen Daten im Zeitablauf ....... 40
2. Die Möglichkeit der Informationsbeschaffung ................... 41
a) Informationen über die zukünftigen Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
b) Informationen über die unternehmerische Zielsetzung ......... 42
VIII Inhaltsverzeichnis
3. Die Möglichkeit der Informationsverwertung 42
III. Grundsätze für die Gestaltung der Finanzplanung .................. 44
1. Der Grundsatz der Vollständigkeit und das Postulat gegenseitiger
Planabstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45
2. Die Grundsätze der Regelmäßigkeit und Kontinuität . . . . . . . . . . . .. 48
3. Der Grundsatz der Elastizität ................................. 49
4. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51
IV. Die Abgrenzung von kurzfristiger und langfristiger Finanzplanung ... 53
1. Die Planungsperiode als Entscheidungsproblem ................. 53
2. Die Bestimmung der Fristigkeit im Hinblick auf die Finanzprognose 56
3. Die Bestimmung der Fristigkeit im Hinblick auf die finanzwirtschaft
liche Alternativplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57
Zweiter Teil
Die Ermittlung des voraussichtlichen Finanzbedarfs bzw. -überschusses
(Die kurzfristige Finanzprognose)
I. Die Verfahrenstechnik bei der Aufstellung kurzfristiger Finanzprognosen 63
1. Die Methoden zur Ermittlung des voraussichtlichen Finanzbedarfs
bzw. -überschusses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63
a) Die Verfahren der Kapitalbedarfsrechnung ................... 64
b) Die isolierte Schätzung .................................... 68
c) Die Ableitung aus anderen Teilplanungen ................... , 71
2. Die Darstellungsform der Finanzprognose ...................... 74
11. Die Planung des Mindestbestandes an liquiden Mitteln und ihr Einfluß
auf die Finanzprognose ......................................... 76
1. Die Bestimmungsgründe der Kassenhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
a) Die Unsicherheit als alleiniger Bestimmungsgrund . . . . . . . . . . . .. 77
b) Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv ........... . .. 78
2. Die Festlegung des Mindestbestandes an liquiden Mitteln ........ 81
a) Die Bestimmung des Mindestbestandes an Transaktionsmitteln .. 81
b) Die Bestimmung der Höhe des Sicherheitsbestandes .. . . . . . . . .. 82
1) Die theoretische Bestimmung des Sicherheitsbestandes ...... 83
2) Die Bestimmung des Sicherheitsbestandes in der Praxis. . . . .. 86
c) Die Bestimmung des Mindestbestandes an Spekulationsmitteln .. 87
Inhaltsverzeichnis IX
3. Die Einbeziehung des geplanten Mindestbestandes an liquiden Mitteln
in die Finanzprognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88
HI. Die Ungewißheit der Erwartungen als Problem der Finanzprognose . . .. 89
1. Die Ungewißheit in der Finanzprognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89
2. Die Berücksichtigung der Ungewißheit bei der Aufstellung der
Finanzprognose ............................................. 90
a) Die Einrechnung von Sicherheitsspannen ................... 90
1) Gewißheitsäquivalente und Sicherheitsspanne .............. 91
2) Das Verfahren der Einrechnung von Sicherheitsspannen .... 93
b) Die flexible Gestaltung der Prognose ........................ 94
3. Ergänzende Maßnahmen zur Erhöhung der Prognosegewißheit .... 96
IV. Das Ergebnis der kurzfristigen Finanzprognose 97
Dritter Teil
Die Alternativplanung im Rahmen der kurzfristigen Finanzplanung
I. Vorbemerkungen ............................................... 101
H. Die Alternativplanung bei erwartetem Finanzüberschuß ............. 105
1. Feststellung und Analyse der Alternativen ...................... , 105
a) Die Anlage in Depositen .................................. 105
b) Die Anlage in Effekten ................................... 106
c) Die Bildung eines Wechselportefeuilles ....................... 108
d) Die vorzeitige Tilgung von Krediten ........................ 109
e) Sonstige Verwendungsmöglichkeiten ........................ 110
2. Die Bestimmung der optimalen Alternative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
a) Vorbemerkungen ......................................... 111
b) Die Bestimmung des Optimums bei einwertigen Gewinnerwar-
tun gen .................................................. 112
c) Die Bestimmung des Optimums bei mehrwertigen Gewinnerwar-
tungen .................................................. 120
1) Die Verwendung allgemeiner Regeln der Wertpapieranlage zur
Bestimmung des Optimums ............................. 121
2) Die Anwendung der allgemeinen Theorie der Wirtschaftlich-
keitsrechnung zur Bestimmung des Optimums .............. 124
3) Die Bestimmung der optimalen Mittelverwendung nach der
Ungewißheitstheorie von Shackle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128
4) Die Bestimmung der optimalen Mittelverwendung nach der
Theorie der "portfolio selection" von Markowitz .......... 132
x Inhaltsverzeichnis
aa) Die Grundzüge der Theorie von Markowitz ........... 133
bb) Ein numerisches Beispiel für die Theorie der "portfolio
selection" ......................................... 143
cc) Kritische Würdigung der Theorie von Markowitz ...... 148
dd) Die Möglichkeit einer praktischen Anwendung ......... 151
IH. Die Alternativplanung bei erwartetem Finanzbedarf ................. 155
1. Feststellung und Analyse der Alternativen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 155
a) Die Aufnahme von Krediten ............................... 156
b) Die Auflösung vorhandener Liquiditätsreserven . . . . . . . . . . . . . .. 159
c) Sonstige Maßnahmen ...................................... 161
2. Die Bestimmung der optimalen Alternative ...................... 162
Schluß. Die Entscheidung für das Optimum als Abschluß der kurzfristigen
Finanzplanung .............................................. 169
Literaturverzeichnis ................................................ 171
Abkürzungsverzeichnis ............................................. 186
Einleitung
I. DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
FINANZWIRTSCHAFT UND FINANZPLANUNG
Gesamtwirtschaftlich gesehen besteht die Aufgabe der industriellen Unterneh
mungen darin, die Versorgung mit knappen Gütern oder Diensten zu verbessern
und hierdurch zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse beizutragen. Bei der
Erfüllung dieser Aufgaben sind güter- oder leistungswirtschaftliche Tätigkeiten
zu vollziehen: Werkstoffe, Betriebsmittel und Arbeitskräfte müssen beschafft
werden, die beschafften Faktoren sind zur Erstellung von Leistungen im Produk
tionsprozeß zu kombinieren, und schließlich gilt es, die durch die Produktion
gewonnenen Leistungen abzusetzen. Damit lassen sich im güterwirtschaftlichen
Bereich Beschaffung, Produktion und Absatz als Grundfunktionen unterscheiden.
Der güterwirtschaftliche Bereich findet seine Ergänzung in der finanzwirtschaft
lichen Sphäre der Unternehmung. Den Güterströmen entsprechen Zahlungsströme
in gegenläufiger Richtung, so daß das reale Geschehen in der Unternehmung ein
finanzielles Spiegelbild erhält. Es ergibt sich daraus die Möglichkeit, durch die
Betrachtung der Geldgrößen des Zahlungsstromes einen Eindruck vom Verlauf
der güterwirtschaftlichen Tätigkeiten zu gewinnen. Mit diesem Tatbestand, der
die Grundlage des betrieblichen Rechnungswesens bildet, erschöpft sich jedoch
die Bedeutung der finanziellen Sphäre nicht. Vielmehr wird die Finanzwirtschaft
erst dadurch zur eigenen Grundfunktion, daß sie eine zweifache Aufgabe zu
erfüllen hat: einmal ist das zur Durchführung der leistungswirtschaftlichen Tätig
keiten erforderliche Kapital bereitzustellen, zum anderen muß das finanzielle
Gleichgewicht erhalten werdenl•
Die erste Aufgabe der Finanzwirtschaft, die Bereitstellung des erforderlichen Kapitals,
bezieht sich zunächst auf die Gründung der Unternehmung. Dabei muß das be
schaffte Kapital nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, d. h. in seiner
Zusammensetzung, den Erfordernissen der geplanten leistungswirtschaftlichen
Tätigkeit angepaßt sein. Es handelt sich also darum, einen strukturellen Gleich
gewichtszustand herzustellen. Entsprechende Probleme des Kapitalaufbaus er
geben sich bei Erweiterungen der Unternehmung. Damit wird die Bereitstellung
des erforderlichen Kapitals als eine einmalige bzw. unregelmäßig anfallende Auf
gabe gekennzeichnet.
1 Vgl. Hax, Kar!, Finanzwirtschaft. Die langfristigen Finanzdispositionen. In: Handbuch der
Wirtschaftswissenschaften, hrsg. von Kar! Hax und Theodor Wessels, Bd. 1, Köln und Opladen
1958, S. 453-542, bes. S. 455, und Gutenberg Brich, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre.
In: Die Wirtschaftswissenschaften, hrsg. von Erich Gutenberg, Wiesbaden 1958. S. 93.
2 Einleitung
Im Gegensatz dazu stellt die Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts eine laufend
zu lösende Aufgabe der Finanzwirtschaft dar. Der Forderung nach einer Erhal
tung des finanziellen Gleichgewichts ist dann Genüge getan, wenn die Unter
nehmung in jedem Augenblick die notwendigen Geldausgaben zu vollziehen
vermag. Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen stehen Geldeinnahmen so
wie vorhandene Bestände an liquiden Mitteln zur Verfügung. Das "Postulat
dauernden Finanzgleichgewichts" 2 läßt sich also auch so formulieren: die Unter
nehmung soll jederzeit in der Lage sein, die erforderlichen Ausgaben aus den
Einnahmen und den vorhandenen liquiden Mitteln zu bestreiten, bzw. sie soll
sich stets im Zustand der Zahlungs bereitschaft befinden.
Es ist ohne weiteres einzusehen, daß zwischen den bei den Aufgaben der Finanz
wirtschaft - der Bereitstellung des erforderlichen Kapitals einerseits und der Er
haltung des finanziellen Gleichgewichts andererseits - Unterschiede bestehen.
Zwar bezieht sich auch die Aufgabe der Kapitalbereitstellung auf das finanzielle
Gleichgewicht der Unternehmung. Es ist jedoch durchaus denkbar, daß in einer
Unternehmung trotz eines gesunden finanziellen Aufbaus Störungen der Zah
lungsbereitschaft auftreten. In diesem Sinne scheint es zweckmäßig, im finanz
wirtschaftlichen Bereich strukturelles und dispositives Gleichgewicht3 zu unter
scheiden.
Die Erfüllung der finanzwirtschaftlichen Aufgaben vollzieht sich jeweils in den
drei Stufen der Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle, wobei auf der vorberei
tenden Stufe zwischen Planung und Organisation zu unterscheiden ist4• Diese
stufenmäßige Gliederung gilt für jede der beiden finanzwirtschaftlichen Aufgaben,
so daß es auch zwei Arten der finanziellen Planung gibt.
2 Vgl. Kosiol, Erich, Finanzplanung und Liquidität. In: ZfhF 7. Jg. N. F. (1955), S.251-272,
bes. S. 265.
3 Der Unterscheidung von strukturellem und dispositivem Gleichgewicht im finanzwirtschaft
lichen Sektor entsprechen etwa die in der Literatur gebrauchten Begriffe strukturelle und dis
positive Liquidität. Während sich die strukturelle Liquidität auf die Finanzierungsvorgänge bei
der Gründung bezieht, ergibt sich die dispositive Liquidität aus der laufenden Unternehmungs
tätigkeit und den damit verbundenen Zahlungsvorgängen. V gl. hierzu: Schäfer, Erich, Die Unter
nehmung. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Bd. 1, 2. Aufl., Köln und Opladen 1954,
S. 150; Mellerowicz, Konrad, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 3. Bd., 10. Aufl., Berlin 1959,
S. 25; Strobel, Arno, Die Liquidität. Methoden ihrer Berechnung. 2. Aufl., Stuttgart 1953, S. 48 f.
M. R. Lehmann verwendet im gleichen Sinne das Begriffspaar konstitutive und dispositive
Liquidität. Vgl. Lehmann, M[ax} R[udo!j}, Liquidität und Liquiditätsbilanz. In: Annalen der
Betriebswirtschaft, 1. Bd. (1927), S.329-347 und 480-504, bes. S. 345; siehe auch Schweitzer,
Robert, Liquidität. In: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, hrsg. von H[einrich] Nicklisch,
2. Aufl., 2. Bd., Stuttgart 1939, Sp. 891-901, bes. Sp. 893.
4 V gl. Hax, Karl, Planung und Organisation als Instrumente der Unternehmungsführung. In:
ZfhF 11. Jg. N. F. (1959), S. 605-615, bes. S. 612. Die drei Phasen der Vorbereitung, Ausführung
und Kontrolle sind nicht nur bei der Erfüllung finanzwirtschaftlicher Aufgaben zu erkennen. Sie
gelten für alle unternehmerischen Tätigkeiten bzw. für das sinnvolle Handeln des Menschen
überhaupt. Vgl. u. a. Kosiol, Erich, Grundlagen und Methoden der Organisationsforschung.
Berlin 1959, S. 41; Virkkunen, Henrik, Das Rechnungswesen im Dienste der Leitung. Helsinki
1956, S. 50; U/rich, Hans, Betriebswirtschaftliehe Organisationslehre. Bern 1949, S. 111. Nord-