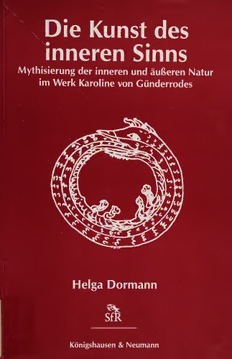Table Of ContentDie Kunst des
inneren Sinns
Mythisierung der inneren und äußeren Natur
im Werk Karoline von Günderrodes
Helga Dormann
Königshausen & Neumann
Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Kahle/Austin Foundation
https://archive.org/details/diekunstdesinnerOOOOdorm
Dormann Die Kunst des inneren Sinns
Stiftung für Romantikforschung
Band XXIV
Helga Dormann
Die Kunst des inneren Sinns
Mythisierung der inneren und äußeren Natur
im Werk Karoline von Günderrodes
Königshausen & Neumann
THomas J Ööta Library
vcNT UNIVERSITY
^trtRBOROUGH, ONTARIO
V
D \
l CJ
Umschlagabbildung:
Die kosmische Schlange. Aus: Wolfgang Bauer, Irmtraud Dümotz, Sergius Golowin
Lexikon der Symbole. Fourier Verlag Wiesbaden 1980, S.46.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
D 26
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Wllrzburg 2004
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
Umschlag: Hummel / Lang, Wtlrzburg
Bindung: Buchbinderei Diehl+Co.GmbH, Wiesbaden
Alle Rechte Vorbehalten
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechüich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zusümmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
ISBN 3-8260-2549-0
www.koenigshausen-neumann.de
www.buchhandel.de
INHALT
I. ZUR EINFÜHRUNG 7
II. KONZEPTE EINER NEUEN MYTHOLOGIE 28
Herders Vorstellung vom heuristischen Gebrauch der Alten 28
Friedrich Schlegels freie Ideenkunst 37
Die Mythologie der Vernunft 57
III. GÜNDERRODES ENTWURF DER SELBSTBILDUNG 62
IV. DIE MYTHISIERUNG DES POETEN 79
Der orphische Sänger 79
Begeisterung und Ironie in ihrer Wechselwirkung 92
V. DER INNERE SINN ALS WAHRNEHMUNGSORGAN DES 98
UNSICHTBAREN
Die Ansicht von der Natur des Menschen 98
Die Spekulationen um den inneren Sinn im 18.Jahrhundert 111
Der innere Sinn als Sinn für das Schöne 113
Der innere Sinn als moralisches Organ 117
Der innere Sinn als Sinn für die Welt der Geister 120
Der innere Sinn als Vermögen der Selbstanschauung 125
Das romantische Verständnis des inneren Sinns 128
Sehnsucht als Triebfeder zur Entfaltung des inneren Sinns 131
VI. DIE MYTHISIERUNG DER NATUR 138
Zurückweisung der Naturaneignung 148
Der Weg nach Innen als Weg zur Natur 157
Der werdende Gott der Erde 183
VII. DIE MYTHISIERUNG DER LIEBE 203
Unsterblichkeit der Liebe 207
Liebe als Versöhnung mit der Allheit 224
Liebe zum Schönen 227
VIII. ZUSAMMENFASSUNG 234
IX. LITERATURVERZEICHNIS 242
DANKSAGUNG
Mein besonderer Dank gilt Professor Günter Oesterle, der sich nach dem plötzlichen
Tod von Professor Norbert Altenhofer sofort bereit erklärte, mein gerade
begonnenes Forschungsvorhaben zu betreuen. Seine verständnisvolle Unterstützung
und seine vielfältigen fachlichen Anregungen ermöglichten die Fortsetzung des
Projekts. Frau Professor Lubkoll danke ich dafür, daß sie die Mühen einer
auswärtigen Begutachtung auf sich nahm.
Darüber hinaus sei sowohl der Fazit-Stiftung gedankt, die in großzügigster
Weise meine Forschungen über mehrere Jahre finanziell forderte, als auch Frau Dr.
Ottmann und der Stiftung für Romantikforschung für die Unterstützung des Drucks
der Arbeit.
Auch Annemarie Taeger-Altenhofer, die mich immer wieder ermutigte und von
deren konstruktiver Kritik und weitreichender Hilfe ich so sehr profitierte, möchte
ich an dieser Stelle herzlich danken.
Frankfurt am Main, im Frühjahr 2003 Helga Dormann
I. ZUR EINFÜHRUNG
Günderrodes Bildungshorizont
Karoline von Günderrodes kurzes Leben (1780-1806) kann als bekannt vorausge¬
setzt werden, auch ihre Dichtungen dürften sicherlich nicht mehr nur einem Kreis
von Spezialisten vertraut sein. Seit 1990 liegt ihr schmales Oeuvre in einer von Wal¬
ter Morgenthaler herausgegebenen historisch-kritischen Ausgabe1 vor. Die Korre¬
spondenz mit Friedrich Creuzer2 ist wieder zugänglich und eine umfangreiche Zu¬
sammenstellung aus verschiedenen Briefwechseln3 wurde 1992 veröffentlicht. Das
gewachsene Interesse an der Dichterin, die zunehmend der Romantik zugerechnet
wird, dokumentiert sich nicht zuletzt in einer von Hannelore Schlaffer besorgten
Werkauswahl4 und in einer 1998 erschienenen Biographie.5
Günderrode formuliert einen für ihre Zeit ungewöhnlichen Anspruch auf Eben¬
bürtigkeit und Zugehörigkeit zu einer Dichterelite, die zuvor ausschließlich von
Männern gebildet wurde, wenn sie in einem Brief an Clemens Brentano schreibt:
Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, meine Gedichte drucken
zu lassen, wollen Sie wissen? Ich habe stets eine dunkle Neigung dazu
gehabt, warum und wozu frage ich mich selten; ich freute mich sehr,
als sich jemand fand, der es übernahm, mich bei dem Buchhändler zu
vertreten, leicht und unwissend, was ich tat, habe ich so die Schranke
zerbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied; und noch
hab ich es nicht bereut, denn immer neu und lebendig ist die Sehn¬
sucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in
einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzuzutreten, sie
zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ja, nach dieser Ge¬
meinschaft hat mir stets gelüstet, dies ist die Kirche, nach der mein
Geist stets wallfahrtet auf Erden.6
Um 1800 produzieren Schriftstellerinnen gewöhnlich Romane und Lyrik7, Günder¬
rodes Werk hingegen umfaßt mehrere Gattungen: sie schreibt Dramen, Kurzprosa
1 Karoline von Günderrode. Sämtliche Werke und ausgewählte Studien. Historisch-Kritische
Ausgabe. Hrsg, von Walter Morgenthaler unter Mitarbeit von Karin Obermeier und Marianne Graf.
3Bde.Basel, Frankfurt am Main 1990-1991. (Nachfolgend als SW plus Bandangabe zitiert)
2 Die Liebe der Günderode. Ein Roman in Briefen. FIrsg. und mit einem Nachwort von Franz
Josef Görtz. München, Zürich 1991.
3 „Ich sende Dir ein zärtliches Pfand“. Die Briefe der Karoline von Günderrode. Hrsg, und mit
einer Einleitung versehen von Birgit Weißenbom. Frankfurt am Main, Leipzig 1992.
4 Karoline von Günderrode. Gedichte, Prosa, Briefe. Hrsg, von Hannelore Schlaffer. Stuttgart
1998.
5 Vgl. Hille, Markus: Karoline von Günderrode. Reinbek bei Hamburg 1999.
6 Brief an Clemens Brentano vom lO.Juni [1804], In: „Ich sende Dir ein zärtliches Pfand“. Die
Briefe der Karoline von Günderrode, a.a.O., S.151.
7 Die Forschungsliteratur, die sich den Bedingungen schreibender Frauen des 18.Jahrhunderts
widmet, ist umfangreich. Daher sei die informative Darstellung von Barbara Becker-Cantarino ex-
7
und Lyrik. Ihr ,männlicher’ Kunstanspruch mag ein Motiv für ihre umfassenden au¬
todidaktischen Studien bilden. Sie erhält zwar eine standesgemäße Erziehung8, aber
- wie für Mädchen üblich - keine systematische Ausbildung, z.B. in alten Sprachen.
Dennoch bezeugen die seit 1799 in ihrem Studienbuch9 niedergelegten Aufzeich¬
nungen vielfältigste Interessen und ein breites Wissensspektrum.10 Auf der intellek¬
tuellen Höhe ihrer Epoche nimmt sie an dem zeitgenössischen philosophischen Dis¬
kurs teil, denn sie rezipiert Kant" und Fichte12. Ab 1804 setzt ihre intensive Ausein¬
andersetzung mit Schelling ein13, dessen „göttliche Filosofie“14 sie mit „großem
Fleiß“15 studiert. Darüber hinaus liest sie Rousseau16, Herder17, Hemsterhuis18,
emplarisch angeführt. Vgl. dies.: Schriftstellerinnen der Romantik. Epoche-Werke-Wirkung. Mün¬
chen 2000, S. 19-69. (Mit Bibliographie)
8 Vgl. ebd., S.207.
9 Karoline von Günderrode in ihrer Umwelt. III. Karoline von Günderrodes Studienbuch. Hrsg,
von Doris Hopp und Max Preitz. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1975, S.223-323.
(Nachfolgend als Preitz III zitiert) Ausgewählte Studien sind publiziert in: SW II, S.273-483 und
werden kommentiert in: SW III, S.313-361. Eine Auflistung der im Studienbuch enthaltenen Auf¬
zeichnungen findet sich ebd., S.52f. Valentina Di Rosa analysiert das Studienbuch. Vgl. dies.: „Es
ist hier eine Lükke in meiner Seele...“. Una Lettura dello ‘Studienbuch’ di Karoline von
Günderrode. In: AION <F.G.> Sezione Germanica. Nuova Serie I, 1-2 (1991), S.83-106.
10 Eine Auflistung zu Werk und Studien findet sich in: SW III, S.378-381.
11 Günderrode exzerpiert umfangreich aus J.G.C.C. Kiesewetters Grundriß einer allgemeinen
Logik nach Kantischen Grundsätzen. Vgl. SW II, S.302-349 sowie SW III, S.328-331. Siehe auch
die Kant-Zitate in ihrem Studienbuch. Vgl. Preitz III, S.265E; S.282f.
12 Morgenthaler publiziert Exzerpte aus Fichtes Die Bestimmung des Menschen (1800).Vgl.
SW II, S.288-298. Das Studienbuch weist einige Fichte Zitate auf, die aus der Schrift Einige Vorle¬
sungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794) stammen. Vgl. Preitz III, S.265-267.
13 Günderrodes Kenntnis folgender Schelling Schriften ist nachweisbar: Ideen zu einer Philo¬
sophie der Natur (1797); Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799); Einleitung zu
dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799); Allgemeine Deduction des dynamischen
Processes oder der Categorien der Physik (1800); System des transcendentalen Idealismus (1800);
Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge. Ein Gespräch. (1802). Auch aus
der von Schelling edierten Zeitschrift für spekulative Physik (1800) liegen Notate vor. Zu allen Ex¬
zerpten siehe SW II, S.358-406, Kommentar SW III, S.336-343. Wichtige Briefstellen zu diesem
Themenkomplex ebd., S.343-345. Schellings Vorlesungen zur Philosophie der Kunst dürften Gün¬
derrode durch eine Mitschrift bekannt geworden sein, die ihr Creuzer schickte. Vgl. SW III, S.345.
14 Brief der Günderrode an Creuzer (22.3.1805). In: SW III, S.344.
15 Brief der Günderrode an F.Karl v. Savigny (Mitte Juni 1804). In: SW III, S.343.
16 Das Studienbuch weist Notate aus Emile und Contrat social auf. Vgl. Preitz III, S.265.
Ebd., S.264E; S. 276 Passagen aus Briefe zu Beförderung der Humanität (1794). Am 17.Juli
1799 schreibt Günderrode an Karoline von Barkhaus über ihre Herderlektüre: „Bisher las ich auch
sehr viel in Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, bei allen meinen
Schmerzen ist mir dies Buch ein wahrer Trost, ich vergesse mich, meine Leiden und Freuden in
dem Wohl und Wehe der ganzen Menschheit, und ich selbst scheine mir in solchen Augenblikken
ein so kleiner unbedeutender Punkt in der Schöpfung, daß mir meine eigne Angelegenheiten keiner
Thräne, keiner bangen Minute werth scheinen.“ Karoline von Günderrode in ihrer Umwelt. II. Ka¬
roline von Günderrodes Briefwechsel mit Friedrich Karl und Gunda von Savigny. Hrsg, von Max
Preitz. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1964, S.165f. (Nachfolgend als Preitz II zi¬
tiert)
8