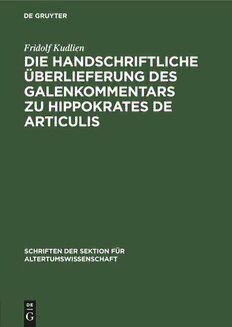Table Of ContentDEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
SCHRIFTEN DER SEKTION FÜR ALTERTUMSWISSENSCHAFT
27
DIE HANDSCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNG
DES GALENKOMMENTARS
ZU HIPPOKRATES DE ARTICULIS
VON
FRIDOLF KUDLIEN
A K A D E M I E - V E R L A G • B E R L IN
1960
Gutachter dieses Bandes:
Werner Hartke und Johannes Irmscher
Redaktor der Reihe: Johannes Irmscher
Redaktor dieses Bandes: Jutta Kollesch
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1960 by Akademie -Verlag GmbH, Berlin
Erschienen im Akademie-Verlag GmbH, Berlin W 8, Leipziger Str. 3—4
Lizenz-Nr. 202/100/195/60
Satz, Druck and Einband: Druckhaus „Maxim Gorki", Altenburg
Bestellnummer: 2067/27
Printed in Germany
ES 7M
Vorwort
Die vorliegende Untersuchung verdankt ihre Entstehung einer
Anregung von Herrn Prof. Dr. Konrad Schubring. Sie wurde im
Rahmen der Arbeitsgruppe Corpus Medicorum Graecorum beim
Institut für griechisch-römische Altertumskunde der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin als Vorarbeit für eine ge-
plante kritische Ausgabe von Galens De articulis-Kommentar an-
gefertigt. Eine vorläufige Fassung lag der philosophischen Fakultät
der Humboldt-Universität zu Berlin im Sommer des Jahres 1957
als Dissertation vor (begutachtet von Prof. Dr. J. Irmscher und
Prof. Dr. W. Hartke). Für mannigfache Anregungen und Rat-
schläge bei der Ausarbeitung der endgültigen Fassung möchte
ich Herrn Prof. Schubring an dieser Stelle auf das herzlichste
danken; ebenfalls bin ich den Herren Professoren Irmscher und
Hartke für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Schriften der
Sektion für Altertumswissenschaft" zu Dank verpflichtet.
Berlin, im Sommer 1960 Fr. Kudlien
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen 6
Einleitung 7
I. Beschreibung der Handschriften 11
1. Der Laurentianus (L) 11
Exkurs: Die sogenannte Blattversetzung 17
2. Der Parisinus (P) 21
II. Untersuchung eines Textstückes und Zusammenstellung von
Fehlergruppen 23
1. Auslassungen in P 29
2. Zufügungen in P 32
3. Interpolationen in L und P 35
4. Influenzfehler 37
5. Antizipationen 38
6. Perseverationen 39
7. Haplographien 40
8. Dittographien 41
9. Majuskelfehler 42
10. Itazismen 43
11. Korrigierende Tendenzen im Text von P 45
III. Der Text der Oribasiusexzerpte 49
IV. Der Hippokratestext 55
Zusammenfassung 67
Verzeichnis textkritisch behandelter Stellen aus Galens De articulis-
Kommentar 70
Verzeichnis der Abkürzungen
Handschriften
L = Laurentianus 74,7
P = Parisinus gr. 1849
R = Parisinus gr. 2248
Ausgaben
GALEN
Aid. Aldina, Gesamtausgabe des griechischen Textes in 5 Bänden,
Venedig 1525 in aedibus Aldi
Basiliensis Gesamtausgabe des griechischen Textes in 5 Bänden, Basel
1538 apud Andr. Cratandrum
Chartier griech.-lat. Gesamtausgabe (mit Hippokrates zusammen)
in 13 Bänden, Paris 1679 ed. R. Charterius
K. griech.-lat. Gesamtausgabe in 20 Bänden, Leipzig 1821 —
1833 ed. C. G. Kühn (zitiert nach Band, Seite, Zeile, wobei
nur die griechischen Textzeilen gezählt sind)
HIPPOKRATES
L. Gesamtausgabe mit französischer Übersetzung in 10 Bän-
den, Paris 1839—1861 ed. E. Littré (zitiert nach Band,
Seite, Zeile)
Kw. Hippocratis opera ed. H. Kühlewein, 2 voll., Leipzig (Teub-
ner) 1894 u. 1902 (zitiert nach Band, Seite, Zeile)
O RIB ASI US
R. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae ed. J. Raeder,
in: CMG VI 1,1; VI 1,2; VI 2,1; VI 2,2, Leipzig 1928-1933
(diese Bände tragen die Sondernumerierung I—IV, nach
welcher mit Angabe von Seite und Zeile zitiert ist)
Schöne, Ap. v. Kitium Apollonius von Kitium, illustr. Kommentar zu der hippo-
kratischen Schrift negi äg&Qcav, hrsg. v. H. Schöne, Leipzig
(Teubner) 1896
Vogt, Diss. S. Vogt, De Galeni in libellum xax' irjtQeiov conjmentariis,
Diss. Marburg 1910
Einleitung
Wie Galen selbst uns in seinem Schriftenverzeichnis berichtet1), hat er
neben vielen anderen Werken des hippokratischen Corpus auch die fol-
genden chirurgischen Schriften kommentiert: De fracturis in 3 Büchern,
De articulis in 4 Büchern, De ulceribus und De vulneribua capitis in je
einem Buch, De officina medici in 3 Büchern2). Die Kommentare zu De
ulceribus und zu De vulneribus capitis sind nicht auf uns gekommen,
doch hat Oribasius, Leibarzt des Kaisers Julian und Verfasser einer
medizinischen Enzyklopädie, wenigstens eine Reihe von Exzerpten aus
beiden erhalten3). Die übrigen chirurgischen Kommentare Galens sind in
folgenden Handschriften überliefert4):
1. Laurentianus 74,7
2. Parisinus gr. 1849
3. Marcianus gr. 279
4. Parisinus gr. 2247
5. Parisinus gr. 22485)
x) De libris propriis 6 (scr. min. II p. 112, 14 sqq. 25 und p. 113, 1 sq. 5 sq. 11).
2) Vgl. noch Galens eigene Angaben im II. Kommentar zu Epid. III (CMG V 10,
2, 1 p. 61, 3 sq. 17 ed. Wenkebach); für die Abfassungszeit siehe J. Ilberg, Über
die Schriftstellerei des Kl. Galenos, RhM44,1889, 229f., Vogt, Diss. 2ff. und neuer-
dings K. Bardong, Beiträge zur Hippokrates- und Galenforschung, NGG 1942, Nr. 7,
626 u. 639.
3) Die Fundstellen sind zusammengestellt von K. Deichgräber, Gnomon 9, 1933,
606.
4) Nach H. Diels, Die Handschriften der antiken Ärzte, I. Teil, Abh. Berlin 1905,
106 und 108. Der auf Seite 108 zum De fract.-Kommentar außerdem genannte Mosq.
466 bietet nach einer Notiz H. Schönes statt dessen eine abweichende Form von
Palladius In Hipp, de fracturis.
5) Hunain ibn Ishäq hat die Kommentare zu De articulis und De fracturis aus
dem Griechischen ins Syrische übersetzt (vgl. G. Bergsträsser, Hunain ibn Ishäq
über die syrischen und arabischen Galenübersetzungen, hrsg. u. übers, in Abh. f. d.
Kunde des Morgenlandes 17,2, Leipzig 1925, 33 Nr. 89 u. 90); von einer Übersetzung
ins Arabische ist nichts bekannt, und von der syrischen Übersetzung hat sich sonst
keine Spur erhalten. Für den De off. med.-Kommentar s. dagegen Vogt, Dias. 15—20
und Bergsträsser, a. a. O. 35 Nr. 98.
8 Einleitung
Und zwar ist der De articulis-Kommentar ohne die beiden anderen
Kommentare im Laurentianus und den Parisini 2247 und 2248, dagegen
mit den beiden übrigen Kommentaren zusammen im Parisinus 1849 und
im Marcianus enthalten. Die Venediger und die beiden Pariser Hand-
schriften 2247 und 2248 scheiden jedoch für eine Recensio des Textes
der chirurgischen Kommentare von vornherein aus, da erwiesenermaßen
die erstere, welche aus dem 15. Jh. stammt, eine Abschrift des Parisinus
1849 ist1), während die beiden letzteren im 16. Jh. aus dem Laurentianus
abgeschrieben sind2). Von den beiden verbleibenden Handschriften ist der
Laurentianus die weitaus ältere (vermutlich im 10. Jh. geschrieben3));
der Parisinus 1849 stammt dagegen wohl aus dem 14. Jh. Die Florenzer
Handschrift enthält ausschließlich chirurgische Schriften, von Hippo-
krates bis zu Paulus von Aegina; um so merkwürdiger ist es, daß in ihr
die beiden Kommentare Galens zu De fracturis und zu De officina medici
fehlen und, nach Ausweis des der Handschrift vorangesetzten, ebenfalls
alten Inhaltsverzeichnisses, auch niemals enthalten waren4). Aus dieser
Überlieferungslage ergibt sich der Aspekt, unter den die vorliegende Arbeit
gestellt ist. Der Vergleich des Textes der beiden Handschriften anhand des
De articulis-Kommentars soll das Verhältnis beider zueinander klären:
Läßt sich hier eine Unabhängigkeit der Pariser Handschrift — wie sie
auf Grund der Tatsache, daß in ihr allein die beiden anderen chirurgischen
Kommentare enthalten sind, zunächst einmal zu erwarten wäre — ein-
deutig erweisen? Andernfalls muß versucht werden, die Art ihrer Be-
ziehung zum Laurentianus und den Wert oder Unwert eventueller Ab-
weichungen möglichst konkret darzustellen. Dabei werden die Exzerpte,
die Oribasius aus dem De articulis-Kommentar gemacht hat, eine Rolle
spielen; diese werden aber auch für sich in ihrem Verhältnis zu dem Text
der beiden Galenhandschriften zu charakterisieren sein. Einen vor-
läufigen Eindruck von dem Wert der Pariser Handschrift kann man sich
übrigens leicht verschaffen, wenn man die beiden Kommentare zu De
fracturis und zu De officina medici auf ihre Nebenüberlieferung hin prüft.
In der Pariser Handschrift hört der De fracturis-Kommentar mit der
Erklärung des Schlußlemmas des Kapitels 37 von De fracturis auf. Die
restlichen 11 Kapitel der hippokratischen Schrift bleiben unerwähnt
und unerklärt. Wir wissen aber sicher, daß Galen die ganze Schrift
kommentiert hat; wie sich aus den Scholien der Oribasiushandschrift R
Vgl. Vogt, Diss. Uff.; eine Probekollation der ersten Seiten, die ich für den
De articulis-Kommentar angefertigt habe, bestätigt dies.
2) Vgl. Schöne, Ap. v. Kitium S. XXff.
3) Zur Datierung vgl. unten S. Ii f.
*) Vgl. Schöne, Ap. v. Kitium S. IX.
Einleitung 9
ergibt1), stammen nämlich Stücke, die Oribasius unter den Überschriften
negl äjiayfmroQ, TISQI TCÜV XAT äyxütva und TIEQI diaaraaeaiQ XEQXLÖOQ über-
liefert hat2), unzweifelhaft aus diesem Kommentar. Die genannten Oriba-
siusstücke hat bereits Cocchi in seinem Sammelwerk „Graecorum ehirurgici
libri", Florenz 17543), dem offenbar verlorenen Schlußteil des De fracturis-
Kommentars zugewiesen4); sie müssen einer künftigen kritischen Aus-
gabe dieses Kommentars am Schluß beigegeben werden. — Was den
Kommentar zu De officina medici betrifft, so hat Vogt, Diss. 22—26 mit
Hilfe der Oribasiusexzerpte und 15—19 anhand einer teilweise erhaltenen
arabischen Übersetzung des Textes gezeigt, wie lückenhaft und vielfach
korrupt auch hier die Überlieferung des Parisinus 1849 ist.
Soviel zu einer vorläufigen Charakterisierung der Pariser Handschrift.
Im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden Interpretationen, kritische
Bemerkungen und Besserungsvorschläge zum Text geboten, die zusammen
mit den übrigen Untersuchungen der Arbeit eine Vorarbeit bilden für eine
im Rahmen des Corpus Medicorum Graecorum geplante kritische Edition
x) Über die Genauigkeit der Scholienangaben vgl. Deichgräber, a. a. O. 606.
Ein Irrtum des Scholiasten sei hier wenigstens erwähnt: Während dieser sonst bei
Exzerpten aus Galenkommentaren immer dasjenige Hippokrateslemma mit wenigen
Worten zitiert, auf welches sich das von Oribasius exzerpierte Galenstück bezieht,
hat er einmal (III 199, zu Z. 27, R.), bei einem Exzerpt aus dem De fracturis-Kom-
mentar, irrtümlich nicht das richtige Lemma (XVIII B 371,8 K.), sondern ein un-
mittelbar vor diesem stehendes, noch zur vorangehenden Galenerklärung gehörendes
Hippokrateszitat aus einer ganz anderen Schrift (De officina medici 8; III 296,
2 sq. L. = II 35,4 sq. Kw.) als Lemma angegeben.
2) Siehe in der Ausgabe von Raeder vol. III p. 216,13-26 und p. 248,21—251,26.
3) Cocchi hat sich augenscheinlich mit der Florenzer Handschrift intensiv be-
schäftigt; denn auf ihrem linken Deckel ist, wie ich in Florenz feststellen konnte,
innen ein handgeschriebener Zettel mit folgender Notiz eingeklebt: Antonius Coc-
chius Florentinus huius codieis, quae edita sunt, contulit cum impressis, nondurn edita
exscripsit a. MDCCXXVII. Der florentinische Arzt plante eine große Ausgabe aller
in der chirurgischen Sammelhandschrift enthaltenen Stücke; es kam dann aber
doch nur zu einem Abdruck von Soran De fracturarum signis und der besagten
Oribasiusexzerpte (vgl. L. Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die ältere
Medizin, Leipzig 1841, 418f.).
*) Für das negi djidy/iarog überschriebene Stück s. Cocchi, 86 Anm. 2; für JISQI öia-
ardasayg XEQXIÖOQ S. ebendort S. 145 Anm. 2. Zu neoi rrJjv yjxt' äyxcöva schreibt Cocchi,
S. 141 Anm. 2, folgendes: Fuerunt haec fortasse a parte commentarii tertii de fractis
deperdita (Bas. V p. 575, v. 32) vel potius a cap. 1 comm. II de articulis (Bas. V
p. 598, v. 44, ubi E^yTjaig Xsinei). Die letztere Vermutung beruht auf einem Irrtum:
In der Tat fehlt in Galens De articulis-Kommentar jeder Hinweis auf die Kapitel
17—29 von De articulis, die, jedenfalls zum Teil, auch wirklich über den Ellenbogen
handeln und deren Erklärung an den Anfang des zweiten Buches des Galenkommen-
tars gehört hätte; es handelt sich aber bei dieser Kapitelreihe um Exzerpte aus dem
Mochlikon, die Galen in seinem Exemplar von De articulis ohne Zweifel gar nicht
gelesen hat (vgl. unten S. 55).
10 Einleitung
des De articulis-Kommentars1). Ich stütze mich dabei auf Kollationen, die
ich nach den mir aus dem CMG-Archiv zur Verfügung gestellten Photo-
graphien angefertigt habe, und zwar nicht nur von den beiden Haupt-
handschriften, von denen ich den Laurentianus in Florenz im Frühjahr
1956 selbst kurz habe einsehen können, sondern auch von dem Parisinus
2248 (im folgenden ß genannt)2), in dessen Text sich eine Anzahl guter
Konjekturen findet. Den Text der im Jahre 1525 erschienenen Aldina3)
habe ich nach einem ebenfalls im CMG befindlichen Exemplar verglichen.
Eine wertvolle Hilfe bildete ferner die bei Kühn abgedruckte, auf Vidius 4)
zurückgehende lateinische Übersetzung, die öfter das Verständnis des
Textes aus eigenem erheblich fördert. Schließlich konnte ein hand-
geschriebenes, vollständiges Wortregister zum De articulis-Kommentar
benutzt werden, das sich Hermann Schöne hatte anfertigen lassen5); aus
dessen Nachlaß hat es K. Deichgräber dankenswerterweise für diese
Untersuchung zur Verfügung gestellt. Nachträglich wurde mir auch durch
die Freundlichkeit von Herrn Prof. Zinn (Tübingen) das Kollations-
exemplar H. Schönes zugänglich gemacht, welches ich bei der Umarbei-
tung meiner Dissertation noch verwerten konnte.
Der Kommentar zu De articulis ist zuletzt in der Gesamtausgabe der Werke
Galens, Bd. XVIII A S. 300—767, im Jahre 1829 von C. G. Kühn ediert worden.
Zur Charakterisierung dieser Ausgabe vergleiche man beispielsweise, was J. Mewaldt
in der Praefatio seiner Ausgabe von Galens Kommentar zu De natura hominis,
CMG V 9,1 p. XXIV, schreibt. .
2) Die Handschrift enthält den De articulis-Kommentar auf fol. 438T—554r.
3) Der De articulis-Kommentar ist im 5. Bande, fol. 269—304 abgedruckt.
4) Vidus Vidius (Guido Guidi), der aus Florenz stammende Leibarzt des Königs
Franz I. von Frankreich, gab im Jahre 1544 in Paris eine „Chirurgia" heraus, welche
eine Reihe von Hippokrates- und Galenschriften in der lateinischen Übersetzung
des Herausgebers enthält, darunter die 3 chirurgischen Kommentare Galens (s.
Choulant, a. a. O. 417f.).
5) Schöne hatte die Aufgabe übernommen, die Kommentare zu De fracturis und
zu De articulis für das CMG zu edieren; er hatte bereits Kollationen zu beiden
Kommentaren angefertigt und auch mit der Ausarbeitung des kritischen Apparates
begonnen (vgl. die Berichte von Hermann Diels über das CMG, SB Berlin 1913, 114;
1914, 127; 1915, 93).