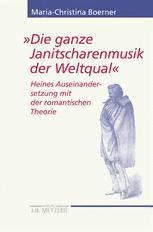Table Of Content»DIE GANZE JANITSCHARENMUSIK DER WELTQUAL«
Heine-Studien
Herausgegeben von J oseph A. Kruse
Heinrich-Heine-Institut
der Landeshauptstadt Düsseldorf
Maria-Christina Boerner
»Die ganze
Janitscharenmusik
der Weltqual«
Heines Auseinandersetzung
mit der romantischen Theorie
Verlag J. B. Metzler
Stuttgart . Weimar
Meiner Mutter und Bruno
Die Deutsche Bibliothek-CIP-Einheitsaufnahme
Boemer; Maria-Christina:
"Die ganze Janitscharenmusik der Weltqual" :
Heines Auseinandersetzung mit der romantischen Theorie I
Maria-Christina Boemer. -Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1998
(Heine-Studien)
ISBN 978-3-476-01598-3
ISBN 978-3-476-01598-3
ISBN 978-3-476-03740-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-03740-4
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim
mung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun
gen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
© 1998 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1998
Inhaltsverzeichnis
Vonwort 5
~------------------------------------------
Einleitung 6
I. Historische Voraussetzungen: Das "bürgerliche" Zeitalter.-Die
Ambivalenz von technisch-industriellem Fortschritt und
politischer Restauration 9
IL "Die wahren Zerrissenen sind die wahren Kreuzträger der
Zeit." 19
2.1. Heine und der "Chor weltschmerzlicher Hänflinge"
Melancholischer Weltschmerz, jungdeutsehe Zerrissenheit und
Heines Abgrenzungsversuche 19
2.2. Der "Milchbruder Lord Byrons"-Heines Zerrissenheit in der
zeitgenössischen Rezeption und in der Forschung 74
III. Romantik und Moderne 93
3.1. Heine und sein romantischer "Schulmeister" August Wilhelm
Schlegel 93
3.2. "Das Alte ist gestorben, und wer wahr ist, ist modern." Oder:
die Rivalität der romantischen Kunsttheorie und der Hegeischen
Asthetik 114
3.3. Heine und der ästhetische "Doktrinär" Friedrich Schlege1_132
3.4. Lucinde und Seraphine - Überwindung der Zerrissenheit durch
Liebe? 145
3.5. "0 süße Torheit, verlaß mich nicht!" (B II, 422) -Heine, der
romantische Narr? 154
IV. Spurensuche 169
4.1. Vorbilder oder: "Die Literaturgeschichte ist die große Morgue
wo jeder seine Toten aufsucht, die er liebt oder womit er verwandt
ist." (B 111, 372-373) 169
4.2. Cervantes-Lektüre- Mit Don Quixote im Kampf gegen Ludwig
Börne 198
4.3. Romantische Lesefrüchte: Roman, Witz und Kontrastästhetik
_________________________________________2 30
4.4. "Der beste der Humoristen!" -Heine und Jean Pani 257
4.5. Der "Meister der Ironie" in der Auseinandersetzung mit der
romantischen Ironie 268
4.7. Die Ambivalenz des Schönen und des Häßlichen und die
Diskussion um die Wahrheit in der Kunst 322
V. Schluß: Heine - ein moderner Dichter? 356
Literaturverzeichnis 3 71
I. Primärliteratur 371
I. Reine-Ausgaben 371
2. Quellen und Materialsammlungen zu Heine 371
3. Sonstige Texte und Anthologien 372
ll. Sekundärliteratur 375
1. Sammelbände und Handbücher 375
2. Monographien und Aufsätze 377
Namensregister 391
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1996 der Philosophischen
Fakultät der Freien Universität Berlin unter dem Titel "Die ganze Janitscha
renmusik der Weltqual" Heines Selbstverständnis als Prosa-Dichter und die Aus
einandersetzung mit der romantischen Theorie um die Paradigmen der moder
nen Literatur als Dissertation eingereicht. An dieser Stelle möchte ich noch
einmal all denen herzlich danken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen
haben. In erster Linie danke ich hierfür meinem Doktorvater Prof. Dr. Günter
Holtz (Berlin), der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Stefan Bodo Würffel (Fribourg),
der immer ein offenes Ohr für Fragen zu Heine hat und mich bei bei der
Drucklegung der Dissertation unterstützte.
Schließlich möchte ich auch Prof. Dr. Joseph A. Kruse (Düsseldorf) für die
Bereitschaft danken, diese Arbeit in die Reihe der Heine-Studien aufzunehmen,
sowie der Studienstiftung für das zweijährige Stipendium, das mir ein ungestör
tes Forschen ermöglichte.
Gewidmet ist diese Arbeit den beiden Menschen, die sie mir vermöge ihrer
Liebe, Geduld und jeweder Form der Unterstützung erst ermöglicht haben:
meiner Mutter und meinem Mann Bruno.
5
Einleitung
Den armen Magister traf wirklich das schlimmste Mißgeschick, jedesmal wenn er ein
Buch schrieb. Nachdem er nämlich für das Thema, das er beweisen wollte, alle seine
Gründe entwickelt, glaubte er sich verpflichtet die Einwürfe, die etwa ein Gegner an
führen könnte, ebenfalls mitzuteilen; er ergrübdte alsdann vom entgegengesetzten
Standpunkte aus die scharfsinnigsten Argumente, und indem diese unbewußt in sei
nem Gemüte Wurzel faßten, geschah es immer, daß, wenn das Buch fertig war, die
Meinungen des armen Verfassers sich allmählig umgewandelt hatten, und eine dem
Buche ganz entgegengesetzte Überzeugung in seinem Geiste erwachte. Er war alsdann
auch ehrlich genug [ ... ] den Lorbeer des literarischen Ruhmes auf dem Altare der
wa hrheit ZU opfern, d.h. sein Manuskript ins Feuer ZU werfen. (B m, 680)
So wie dem "armen Magister" in Heines Elementargeistern kann es leicht auch
dem Literaturwissenschaftler ergehen, der sich mit Heine beschäftigen und sein
Werk einer einheitlichen Interpretation unterziehen möchte. Denn kaum ein
anderer Dichter bietet eine solche Fülle von oftmals widersprüchlichen Ansich
ten und Äußerungen zu den wichtigen Fragen seiner Zeit, gleich ob es sich um
ästhetische, philosophische, religiöse oder politisch-gesellschaftliche Themen
handelt. Da die Forschung jedoch auf Veröffentlichungen angewiesen ist, wer
den die Manuskripte bzw. Computerausdrucke selbstverständlich nicht ver
brannt, sondern der Öffentlichkeit zur Diskussion angeboten. Eine Folge davon
ist, daß die gesamte Reine-Forschung wahrlich ein Musterbeispiel nicht nur für
die zu erwartende Mannigfaltigkeit an unterschiedlichen Deutungsversuchen
bietet, sondern mit Beginn ihrer Hochphase Anfang der sechziger Jahre unseres
Jahrhunderts zeitweise einem Schlachtfeld der kontroversen Meinungen ähnelte.
Der Kampf um das "Streitobjekt Heine"1 gewann dabei proportional an Stärke,
je mehr das Interesse an seinem Werk zunahm und dabei nicht nur seine Lyrik,
sondern auch die Prosaschriften Beachtung fanden.
In jüngster Zeit zeichnet sich nun doch, nach den Abebben der oftmals ideolo
gisch befrachteten "kriegerischen" Auseinandersetzungen um Heine, ein gewis
ser Friede in der Reine-Forschung ab, den man als wissenschaftlichen Konsens
bezeichnen könnte. Diese Einigkeit beruht auf der zunehmenden Akzeptanz
einer für Heines Werk charakteristischen Widersprüchlichkeit, die der Dichter
selbst nicht müde geworden ist, in seinen Schriften als Ergebnis einer Welt und
Ich gleichermaßen ergreifenden "Zerrissenheit" zu thematisieren. Da die Reine
Kritik des 19.Jahrhunderts Heines "Zerrissenheit" zumeist als in der Persön
lichkeit des Schriftstellers gründende Charakterlosigkeit, Scharlatanerie oder
So der sprechende Titel des Forschungsberichtes von Jost Hermand von 1975, der
die Jahre 1945-1975 umfaßt.
6
sentimentale Weltschmerzpose verurteilte und nur vereinzelte Stimmen darin
einen signifikanten Abdruck ihrer Zeit erkennen wollten, fiel es auch der Lite
raturwissenschaft schwer, hier einen positiven Neuansatz in der Dichtung zu
entdecken. Erst zu Beginn der 80er Jahre unseres Jahrhunderts zeigt sich ein
deutlicher Wandel in der Einschätzung von Heines Werk, indem dessen Brüche
und Dissonanzen nunmehr als bewußte Ausdrucksformen gewertet werden.
Dafür steht beispielhaft die Untersuchung von Stefan Bodo Würffel, der die
Widersprüchlichkeit in das Zentrum seiner Analyse der Heineschen Lyrik stellt
und sie als "negative Dialektik" im Sinne einer modernen Ästhetik im Sinne
Theodor W. Adornos interpretiert.2 Trotz dieses innovativen Ansatzes macht
Würffels Studie zugleich deutlich, wo in der Beine-Forschung ungeachtet der
nahezu erdrückenden Masse an Sekundärliteratur jene "Defizite und Lücken"
klaffen, die auch Gehard Höhn in seinem vorzüglichen Beine-Handbuch be
klagt: Es fehlt eine "systematische und erschöpfende" Darstellung seiner
"ästhetischen Theorie", die, so muß hinzugefügt werden, statt des letztlich ahi
storischen Verweises auf Adorno eine Einbettung seiner Anschauungen in den
Kontext der zeitgenössischen Kunstdiskussion vornimmt.3 Gerade bei der Frage
nach der "Modernität" von Heines Programm einerneuen Literatur rückt die
romantische Ästhetik ins Blickfeld, wie sie in erster Linie von ihren beiden
"Häuptern" August Wilhelm und Friedeich Schlegel in dem von Verunsiche
rung und Zweifeln geprägten Jahrzehnt nach der Französischen Revolution von
1789 entwickelt wurde. Denn entgegen dem von Heine selbst verbreiteten Bild
von der nicht nur politisch und religiös, sondern auch ästhetisch rückwärtsge
wandten Romantik konnte in den letzten Jahren in der literaturwissenschaftli
ehen wie philosophischen Forschung die besondere Bedeutung dieser Bewegung
für die Ausbildung einer modernen, zukunftsweisenden Kunsttheorie in Ab
grenzung zu einer am Ideal der antiken Dichtkunst orientierten Klassik und
idealistischen Philosophie nachgewiesen werden.
Obwohl Heines Auseinandersetzung mit der Romantik in verschiedenen Stu
dien behandelt wurde, gibt es dennoch keine umfassende Analyse seiner ästhe
tischen und philosophischen Positionen im Zusammenhang mit der frühen
Romantik, die sowohl die gemeinsame Grundlage des ausgeprägten
"Krisenbewußtseins" als auch die damit verbundene Neubewertung der roman
tischen Theorie in der Forschung berücksichtigt. Selbst Herben Clasen spart in
seiner fundamentalen Arbeit über Heines Romantikkritik ausdrücklich den
Bereich romantischer Philosophie und ästhetischer Theorie aus, wenngleich er
ihre Notwendigkeit für eine umfassende Analyse dieser Problematik offen ein
gesteht. 4 Mit der Einbettung von Heines Werk in diesen historischen Kontext
Stefan Bodo Würffel, Der produktive Widerspruch ... , vgl. bereits die Vorbemer
kung, S.7.
Gerhard Höhn, Reine-Handbuch. .. , SJCIV.
Herben Clasen, Heinrich Reines Romantikkritik. .. , S.13.
7