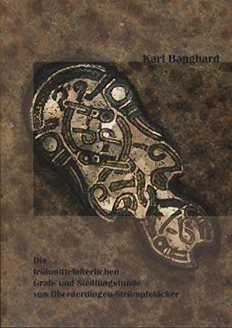Table Of ContentSCHRIFTEN DES ARCHÄOLOGISCHEN FREILICHTMUSEUMS OERLINGHAUSEN
ARCHÄOLOGISCHES FREILICHTMUSEUM OERLINGHAUSEN
SCHRIFTEN DES ARCHÄOLOGISCHEN FREILICHTMUSEUMS OERLINGHAUSEN
BAND 5
OERLINGHAUSEN
2009
ARCHÄOLOGISCHES FREILICHTMUSEUM OERLINGHAUSEN
KARL BANGHARD
Die frühmittelalterlichen Grab- und Siedlungsfunde von
Oberderdingen-Strümpfeläcker
OERLINGHAUSEN
2009
HERAUSGEBER: ARCHÄOLOGISCHES FREILICHTMUSEUM OERLINGHAUSEN
AM BARKHAUSER BERG 2-6 - D-33813 OERLINGHAUSEN
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Banghard, Karl:
Die frühmittelalterlichen Grab- und Siedlungsfunde von Oberderdingen-Strümpfeläcker
Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen. -
Oerlinghausen 2009
(Schriften des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen; Bd. 5)
ISBN 3-926933-04-6
978-3-926933-04-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet unter http//dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Kraichgau
Umschlagentwurf: Renate Müller-Fromme, Oerlinghausen.
© Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen 2009. Das Werk einschließlich aller seiner
Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig und strafbar. Dies gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie für die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany.
ISBN 3-926933-04-6
978-3-926933-04-1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ......................................................................................................................................................................... 7
1. Das Gräberfeld ................................................................................................................................................... 8
1.1 Entdeckung und Ausgrabung ......................................................................................................................... 8
1.2 Quellenkritische Vorbemerkungen: Störungen und Bodenerosion .......................................................... 8
1.2.1 Störungen .................................................................................................................................................. 8
1.2.2 Bodenerosion ............................................................................................................................................. 9
1.3 Die Entwicklung des Gräberfeldes im Lauf der Generationen ................................................................ 9
1.3.1 Darstellungsform und verwendete Chronologiemodelle ................................................................................. 9
1.3.2 Gräber vor der SD-Phase 9 ..................................................................................................................... 10
1.3.3 Gräber der SD-Phase 9 (zweites Viertel 7. Jahrhundert) ......................................................................... 12
1.3.4 Gräber der SD-Phase 10 (drittes Viertel 7. Jahrhundert) ........................................................................ 14
1.3.5 Gräber der WU-Phase 11 (letztes Viertel 7. Jahrhundert) ...................................................................... 16
1.3.6 Gräber der WU-Phase 12 (erstes Viertel 8. Jahrhundert) ........................................................................ 18
1.3.7 Gräber der WU-Phase 13 (zweites Viertel 8. Jahrhundert) ..................................................................... 20
1.3.8 Gräber der OD-Phase 14 (Mitte 8. Jahrhundert) .................................................................................... 22
1.3.9 Gräber der OD-Phase 15 (zweite Hälfte 8. Jahrhundert) ........................................................................ 24
1.4 Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten Grabdaten .................................................................. 26
2. Die zugehörige Siedlung und ihr unmittelbares Umfeld .......................................................... 30
3. Siedlungsgeschichtlicher Kontext .......................................................................................................... 40
3.1 Der Naturraum Kraichgau ............................................................................................................................. 40
3.2 Kurze Skizze der merowingerzeitlichen Besiedlung zwischen Neckar und Oberrhein ....................... 40
3.3 Infrastrukturelle Deutung des linearen Siedlungsmusters ......................................................................... 41
3.4 Siedlungskorridore ........................................................................................................................................... 42
3.5 Das Fließgewässersystem als Matrix früher Gaueinteilung? ...................................................................... 45
3.6 Grundraster der heutigen Siedlungsstruktur? .............................................................................................. 46
4. Zusammenfassungen ...................................................................................................................................... 47
4.1 Zusammenfassung ........................................................................................................................................... 47
4.2 Abstract ............................................................................................................................................................. 48
5. Fundlisten .............................................................................................................................................................. 49
5.1 Bartäxte aus Fundzusammenhängen der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts n. Chr. ............................ 49
5.2 Vielteilige Gürtelgarnituren, Spathagurte und Pferdegeschirr mit goldfarbenen Pressblecheinlagen 50
5.3 Bronzene vielteilige Gürtelgarnituren mit Vogelbaummotiv .................................................................... 51
5.4 Bronzene mehrteilige Garnituren mit Palmettenbaummotiv ................................................................... 51
5.5 Spätmerowingerzeitliche Polyederkapselohrringe ...................................................................................... 52
5.6 Polyederkapselohrringe der älteren Merowingerzeit aus dem südwestdeutschen Raum, die bislang
der jüngeren Merowingerzeit zugewiesen worden sind................................................................................ 55
6. Katalog .................................................................................................................................................................... 56
6.1 Vorbemerkungen zum Katalog ..................................................................................................................... 56
6.2 Katalog .............................................................................................................................................................. 57
7. Verzeichnis der abgekürzten Literatur ................................................................................................122
8. Tafeln
Vorwort
Als ich mich vor weit über einem Jahrzehnt für die Als 1996 sämtliche digitalen Daten zu dieser Arbeit
Bearbeitung des Gräberfeldes von Oberderdingen- verloren gingen, halfen Sonja Schaaf und Frau Buch
Strümpfeläcker als Magisterthema entschieden hatte, bei der Wiedereingabe. Dr. Samuel van Willigen
war mein Blick auf die Zimelien konzentriert. Erst im (Schweizer Landesmuseum Zürich) übernahm die
Lauf der Jahre wurde deutlich, dass es bei der Aus- komplizierteren Tuschezeichnungen. Die hohe
wertung eines Reihengräberfeldes nicht darum geht, Qualität seiner Zeichnungen lässt sich unschwer im
möglichst reiche Funde möglichst aufwändig gezeich- Katalog erkennen. Dr. Ulrich Zimmermann
net in einem möglichst umfangreichen Werk an mög- (Universität Bielefeld) ist die Endkorrektur dieser
lichst prominenter Stelle zu publizieren. Die fachliche Arbeit zu verdanken. Dr. Peter Pieper (Institut für
Aufgabenstellung wurde entsprechend im Lauf der Rechtsmedizin der Universität Düsseldorf) begutach-
Zeit neu definiert: Es galt nun, Aussagen über den tete die Graffiti auf einem Kamm. Die numismati-
Werdegang einer Siedlergemeinschaft des 7. und 8. schen Bestimmungen stammen von Dr. P. H. Martin
Jahrhunderts durch eine präzise chronologische Aus- (Badisches Landesmuseum Karlsruhe) und Dr. Tho-
wertung zu treffen. mas Becker (damals Provinzialrömisches Institut der
Die erste Vorlage der Gräber wurde im Winter 1992 Universität Freiburg). Hilfreich waren die technischen
als Magisterarbeit an der Rheinischen Friedrich-Wil- Beobachtungen der Restauratoren Wolfgang Frey
helms-Universität Bonn eingereicht. Diese Arbeit ba- (Regierungspräsidium Karlsruhe), Werner Wimmel
sierte auf den von mir selbst gewaschenen, restau- (Museum für Ur- und Frühgeschichte Freiburg) und
rierten und gezeichneten Funden. In den folgenden Ulli Hürten (Museum Allerheiligen Schaffhausen).
Jahren lieferte das Landesdenkmalamt die Restaurie- Prof. Dr. Helmut Roth sei für die Betreuung der ers-
rung der Metallfunde und den Gräberfeldplan nach. ten Version der Arbeit, Dr. Rolf-Heiner Behrends
Da ich in der Zwischenzeit beruflich eingebunden (damals Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Au-
war, wurde das Manuskript mit den jeweils neu ein- ßenstelle Karlsruhe) für die Überlassung des Fundma-
treffenden Daten Stück für Stück neu formuliert, so- terials gedankt. Wichtige Hinweise gaben weiterhin
dass es heute kaum noch etwas mit der Version von Erwin Breitinger (Bürgermeister a. D. der Gemeinde
1992 verbindet. Dass die Arbeit dennoch einen Ab- Oberderdingen), Dr. Norbert Goßler (Landesmuse-
schluss finden konnte, ist der Hilfe von vielen Kolle- um Brandenburg), Dr. Heiner Kowarsch (BASF Lud-
gen und Freunden zu verdanken, allen voran meiner wigshafen) und Dr. Andreas Thiedmann (Landesamt
Frau Eva Stauch (Universität Münster). Unschätzbare für Denkmalpflege Hessen, Außenstelle Marburg).
Hilfe bei der Druckvorbereitung leistete Bernhard Schließlich schulde ich dem Entdecker des Gräberfel-
Schroth M.A. (Bereich Ur- und Frühgeschichte der des, Martin Kößler, großen Dank. Ohne sein Engage-
Universität Jena). Die anthropologische Bearbeiterin ment wäre der Fundplatz längst stillschweigend weg-
des Gräberfeldes, Dipl. Biol. Elke Frauendorf (An- gebaggert worden; ohne unsere ungezählten gemein-
thropologisches Institut Mainz), stellte für diese Pub- samen Prospektionen wären mir die Besonderheiten
likation ihre Ergebnisse zu Alter, Körpergröße und der Fundlandschaft Kraichgau eine fremde Größe
Krankheiten zur Verfügung. Darüber hinaus lieferte geblieben.
sie die Zeichnungen der Skelettschemata mit den er-
haltenen Knochen. Gewidmet sei die Arbeit meinen Eltern.
7
1. Das Gräberfeld
1.1 Entdeckung und Ausgrabung
Im Mai 1989 meldete Martin Kößler, ein ehrenamtli- Insgesamt sind dabei 83 Grabnummern vergeben
cher Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes Baden- worden2. Neben den frühmittelalterlichen Gräbern
Württemberg, dass bei Erschließungsarbeiten zum wurden auch vorgeschichtliche Siedlungsreste erfasst.
Oberderdinger Industriegebiet „Strümpfeläcker“ Grä-
ber angeschnitten worden waren. Da man bis dahin
von dieser Gemarkung keine Funde kannte, musste
1.2 Quellenkritische Vorbemerkungen:
von der Außenstelle Karlsruhe zunächst eine kurzfris-
Störungen und Bodenerosion
tige Kleingrabung vom 12. 5. bis zum 22. 5. 1989 im-
provisiert werden.
1.2.1 Störungen
Keine der beigabenführenden Bestattungen wurde
sicher ungestört angetroffen. Nur in wenigen Fällen
ist eine frühmittelalterliche Beraubung direkt durch
den Befund nachweisbar: Grab 59 scheint bei der An-
lage von Grab 60 gestört worden zu sein, da sich der
Umriss des Raubschachtes von Grab 59 auffällig an
Grab 60 orientiert. Sicher ist dagegen eine Beraubung
des Grabes 38 im Rahmen der Anlage von Grab 37
zu belegen. Anzeichen für eine Hakenberaubung3 sind
durch die verzogen wirkenden Lagebefunde der Ske-
lette aus den Gräbern 9, 39 und 48 gegeben. Diese
Beraubungstechnik ist nur vor dem Einbrechen der
Grabkammer sinnvoll.
Auffällig häufig kommt Keramik des 17. Jahrhunderts
in den Störungsschächten tiefer Gräber vor – ein In-
diz dafür, dass die Oberderdinger Gräber in dieser
Zeit erneut beraubt wurden. Das 17. Jahrhundert war
für das nördliche Oberrheingebiet eine Krisenzeit.
Schriftquellen dieses Jahrhunderts schildern Schatz-
gräberei im südwestdeutschen Raum als nahezu alltäg-
lichen Vorgang4. Bezeichnend ist auch die Darstellung
von routiniert wirkenden Öffnungen früh- und hoch-
mittelalterlicher Gräber in der bildenden Kunst des
Abbildung 1: Oberderdingen liegt im baden-württembergischen 17. Jahrhunderts, die auf eine detailreiche Erfahrungs-
Landkreis Karlsruhe. basis zu solchen Vorgängen hinweist. In diesem Zu-
sammenhang zu nennen ist der Stich von A. Aubri
zur versuchten Beraubung des Grabes der Richmon-
Infolge der bevorstehenden flächigen Überbauung dis von Anducht auf dem Friedhof von St. Aposteln
des Geländes setzte das Landesdenkmalamt unter an-
derer technischer Leitung eine Notbergung in zwei
Kampagnen (18. Juli bis 13. Oktober 1989 und 14.
Mai bis 4. Juli 1990) an1. 2 Bei 3 Befunden („Gräber“ 6-8) bleibt jeglicher Hinweis auf ein
Grab aus. Ein Grab erhielt zwei Grabnummern (Grab 31/66). Ei-
ne Tierbestattung (Grab 13) ist nicht sicher mit dem Gräberfeld in
Verbindung zu bringen.
3 Zur Definition GRÜNEWALD 1988, 33 ff.
4 Etwa bei H. J. C. GRIMMELSHAUSEN, Die Lebensbeschreibung
1 Allgemeine Grabungsleitung: R. H. Behrends. der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courage, 1670, Kap. 19.
8