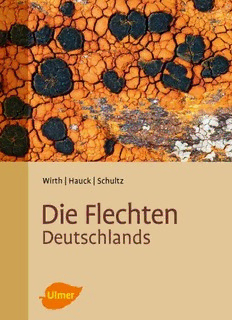Table Of ContentWirth | Hauck | Schultz
Die Flechten
Deutschlands
Die Flechten Deutschlands
Die Flechten
Deutschlands
Volkmar Wirth,
Markus Hauck & Matthias Schultz
unter Mitarbeit von
Uwe de Bruyn
Helga Bültmann
Volker John
Birgit Litterski
Volker Otte
Band 1
GGeefföörrddeerrtt dduurrcchh
Gefördert durch
Foto Seite 2:
Die Becherflechte Cladonia macroceras kommt haupt-
sächlich in moosreichen Zwergstrauchges ellschaften in
subalpinen und alpinen Lagen vor (6 cm).
Bibliografische Information der Deutschen N ationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; d etaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der e ngen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim mung des Verlages unzu-
lässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2013 Eugen Ulmer KG
Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart (Hohenheim)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ulmer.de
Umschlagentwurf: Atelier Reichert, Stuttgart
Lektorat: Ina Vetter
Herstellung: Jürgen Sprenzel
Reproduktion: timeray Visualisierungen, Herrenberg
Satz: r&p digitale medien, Echterdingen
Druck und Bindung: Firmengruppe APPL, aprinta druck, Wemding
Printed in Germany
ISBN 978-3-8001-5903-1 (Print)
ISBN 978-3-8001-8909-0 (PDF)
5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .............................................................. 6
1 Einführung ..................................................... 9
1.1 Was sind Flechten? ............................................... 9
1.2 Zur Ökologie von Flechten ......................................... 9
1.3 Verbreitung von Flechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 Sammeln, Untersuchen und Bestimmen .............................. 19
2.1 Sammeln und Herbarisieren ........................................ 19
2.2 Untersuchen und Präparieren ....................................... 19
2.3 Diagnostisch wichtige Merkmale .................................... 21
3 Erläuterungen zum Speziellen Teil .................................. 42
3.1 Allgemeines ..................................................... 42
3.2 Berücksichtigte Arten ............................................. 43
3.3 Geobotanische Charakterisierung der Arten ........................... 44
3.4 Bilddokumentation ............................................... 56
4 Fachausdrücke und Abkürzungen ................................... 57
5 Bestimmung der Flechten- und Algengattungen ........................ 67
5.1 Aufbau und Handhabung der Schlüssel ............................... 67
5.2 Bestimmung der Flechtenalgen ..................................... 68
5.3 Bestimmung der Flechtengattungen ................................. 71
5.3.1 Wegweiser zu den Hauptschlüsseln .................................. 71
5.3.2 Hauptschlüssel .................................................. 74
Hauptschlüssel I: Strauchflechten ................................... 74
Hauptschlüssel II: Blattflechten ..................................... 78
Hauptschlüssel III: Cyanoflechten ................................... 87
Hauptschlüssel IV: Coniokarpe Flechten .............................. 90
Hauptschlüssel V: Pyrenokarpe Flechten .............................. 92
Hauptschlüssel VI: Flechten mit länglichen oder fleckförmigen Fruchtkörpern 97
Hauptschlüssel VII: Placodioide Krustenflechten ........................ 99
Hauptschlüssel VIII: Discokarpe Krustenflechten ....................... 101
Hauptschlüssel IX: Sterile Krustenflechten ............................ 109
6 Die Gattungen und ihre Arten ...................................... 129
Band 1: Absconditella bis Lempholemma ............................... 129
Band 2: Lepraria bis Zwackhia ...................................... 677
7 Literatur ........................................................ 1199
8 Register ........................................................ 1214
6
Vorwort
Seit 1931, dem Erscheinungsjahr von Migulas schiedener Gattungen. Diese Zusammenfassung
Flechtenflora von Deutschland, Österreich und der von morphologisch-anatomisch ähnlichen Gruppen
Schweiz, ist keine umfassende Flechtenflora von unabhängig von ihrer Verwandtschaft in den
Deutschland mehr vorgelegt worden. In diesem Schlüsseln erwies sich auch unter dem Aspekt der
Zeitraum von über 80 Jahren ist der Kenntnisstand sich ständig ändernden Gattungseinteilungen als
in der Lichenologie zunächst allmählich, in den vorteilhaft. Das Erscheinen dieser Flechtenflora fällt
letzten Jahrzehnten jedoch fast sprunghaft ange- in eine Zeit stärkster Umwälzungen in der Flech-
stiegen. Selbst in den gut 15 Jahren, die seit der tensystematik und -taxonomie, vielfach bedingt
Herausgabe der „Flechten Baden-Württembergs“ durch molekularphylogenetische Untersuchungen.
und der textlich weitgehend identischen „Flech- Die Tendenz zu kleinen Einheiten ist unverkennbar.
tenflora“ vergangen sind, Werken, die bereits ei- Dieser starke Umbruch ist voll im Gange. Bei etli-
nen Großteil der deutschen Flechtenflora abdeck- chen großen Gattungen steht eine Neugliederung
ten, haben sich ganz erhebliche Fortschritte in unmittelbar bevor, aber zum Zeitpunkt der Fertig-
floristischer und tiefgreifende Änderungen in ta- stellung dieser Flora noch nicht zur Verfügung.
xonomischer und systematischer Hinsicht ergeben. Selbstverständlich greifen Taxonomie und Be-
Schon aus diesem Grund ist eine Neuausgabe einer schreibung der Gattungen und Arten auf die ent-
umfassenden Flechtenflora wünschenswert. Die sprechenden Spezialarbeiten und die bedeutenden
hier vorgelegte Übersicht der Flechten Deutsch- grundlegenden, oben genannten Flechtenfloren
lands baut auf den erwähnten Flechtenfloren auf zurück. Darüber hinausgehend mussten jedoch
und erweitert sie um die dort nicht berücksich- einige im Gebiet besonders kritische Gattungen
tigten, nur im norddeutschen und im Alpenraum und Artengruppen von Grund auf neu bearbeitet
vorkommenden Arten sowie die zahlreichen werden. Ebenso sind Schlüsselkonstruktion und
Neunachweise für die deutsche Flechtenflora. Die die ökologisch-arealkundlichen Beschreibungen
Schlüssel mussten hierfür teilweise oder ganz Eigenleistungen dieser Flora.
überarbeitet werden. Die ökologischen Beschrei- Die Bearbeitung der Gattungen Absconditella
bungen der Arten, ein Charakteristikum der vor- bis Aspicilia, Geisleria bis Lecanora, ferner Lecidella
liegenden Flechtenflora und ihrer Vorgänger, sowie der Gattungen mit lirellaten Apothecien
haben im Prinzip weiter Gültigkeit. Die Verbrei- übernahm M. Hauck, die der Cyanoflechten (außer
tung der Arten in Deutschland wird in Form von Collema) sowie die Anpassung des Cyanoflechten-
relativ detaillierten Naturraumangaben vermittelt. schlüssels M. Schultz. Frau H. Bültmann, Frau B.
Auch an der den einzelnen Gattungen vorange- Litterski und die Herren U. de Bruyn, V. Otte und
stellten morphologisch-anatomischen Charakteri- V. John haben die naturräumlichen Angaben der
sierung wurde festgehalten. Sie hat in umfassen- west-, nord- und ostdeutschen Regionen zusam-
den Bestimmungswerken lange Tradition und ist mengetragen und überprüft, die ersteren vier auch
auch in den Flechtenfloren von Poelt (1969), die Texte gegengelesen und verbessert.
Poelt & Veˇzda (1977, 1981), Purvis et al. Arbeit und Arbeitsanteil an diesem Werk waren
(1992), Smith et al. (2009) oder der Nordic Li- größer als angenommen und geplant. Sie gingen
chen Flora enthalten. Sie ist für das vorliegende an die Grenze des Möglichen. Leidtragende waren
Buch besonders notwendig, da die Schlüssel im meine Frau, Kinder und Enkelin. Ihnen, Renate,
Interesse einer leichteren Bestimmung oft zu „Sam- Gesine, Johannes und Anja, widme ich dieses Buch.
melgattungen“ führen, also zu Konglomeraten ähn-
licher, aber nicht unbedingt verwandter Arten ver- Volkmar Wirth
Vorwort 7
Danksagung
Sehr wichtige, zielführende Verbesserungen in den
Schlüsseln gehen auf Dr. J. Vondrák (Pru˚honice/
Prag, Caloplaca), Dr. Z. Palice (Pru˚honice, epiphy-
tische biatorine Lecanora und Lecidea), Dr. C.
Printzen (Frankfurt, epiphytische Lecidea) und Dr.
P. Clerc (Genf, Usnea) zurück. Dr. P. Diederich
(Luxembourg), dem auch weitere Hinweise zu
verdanken sind, und Dr. D. Ertz (Meise) halfen bei
der Aktualisierung der Texte von Opegrapha s.lat.,
Dr. R. Lücking (Chicago) informierte über neueste
Entwicklungen bei Gyalecta und Lobaria. Es halfen
bei Fragen zu zahlreichen Problemen und auch
mit teilweise unveröffentlichten Fakten Dr. W.
Obermayer (Graz) und Dr. C. Roux (Mirabeau),
zu Celothelium Dr. F. Berger (Kopfing), zu Lecidea
Prof. Dr. H. Hertel (München), zu Rinodina Prof.
Dr. H. Mayrhofer (Graz), zu Verrucariaceae Dr. O.
Breuss (Wien), Dr. A. Orange (Cardiff) und Dr. H.
Thüs (London), zu Cyanoflechten Prof. Dr. P. M.
Jørgensen (Bergen), zu Pertusaria Prof. Dr. Imke
Schmitt (Frankfurt) und Dr. T. Lumbsch (Chi-
cago), zu Polysporina Dr. K. Knudsen (Los Ange- Prof. Dr. T. Moberg (Uppsala), Dr. P. Scholz
les), zu Lepraria J. Lendemer (New York), zu Aca- (Markleeberg), Dr. U. Schiefelbein (Rostock),
rospora, Silobia/Myriospora und Sarcogyne Dr. M. G. Stolley (Kiel), Dr. Regine Stordeur (Halle). Für
Westberg (Stockholm), des weiteren M. Heklau die Ausleihe von Belegen danken wir den Kurato-
(Stuttgart), Dr. S. Kondratyuk (Kiew), Prof. Dr. X. ren der Museen und den Besitzern von Privather-
Llimona (Barcelona), Dr. H. Sipman (Berlin), Dr. barien.
A. Thell (Lund). Bei Fragen zu Inhaltsstoffen hal- Fotos steuerten bei: Dr. K. Ammann (Bern),
fen Prof. Dr. T. Tønsberg (Bergen) und Prof. Dr. Dr. F. Berger, Dr. P. Bilovitz (Graz), Prof. Dr. B.
K. Kalb (Neumarkt) weiter. Büdel (Kaiserslautern), Dr. P. Diederich, Prof. Dr.
Fundangaben stellten zur Verfügung Dr. A. U. Kirschbaum, Dr. R. Lücking, Dr. W. Obermayer,
Beck (München), W. von Brackel (Hemhofen), Dr. A. Orange, Dr. C. Printzen, Dr. A. Riedel (Karls-
R. Cezanne & Marion Eichler (Darmstadt), P. Dor- ruhe), Prof. Dr. R. Türk und E. Zimmermann
nes (Pforzheim), Dr. Esther Guderley (Essen), (Lüters wil). Herr J. Wirth (Freiberg/N.) half
Prof. Dr. J. Hafellner (Graz), Prof. Dr. U. Kirsch- bei der Bildbearbeitung und bei den nicht we-
baum (Gießen), J. Nixdorf (Scharfstein), Dr. Mo- nigen PC-Problemen. Die Reinzeichnung der
nica Otálora (Madrid), S. Rätzel (Frankfurt/Oder), Natur raumkarten übernahm Herr B. Raufeisen
M. Schönbrodt (Halle), D. Teuber (Gießen), Prof. (Göttingen).
Dr. L. Tibell (Uppsala), Prof. Dr. R. Türk (Salz- Herr R. Heinzmann (Karlsruhe) war bei der
burg), Prof. Dr. Ute Windisch (Gießen), G. Zim- Mittelbeschaffung behilflich. Frau Baumhof-Pre-
mermann (Düsseldorf). Für verschiedene Aus- gitzer und der Stiftung Naturschutzfonds sowie
künfte danken wir Prof. Dr. T. Ahti (Helsinki), Heike und Peter Krcmar sei herzlich gedankt für
Dr. C. Dolnik (Kiel), Prof. Dr. E. Hertel (Bayreuth), die Übernahme nicht einkalkulierter Mehrkosten.
8
9
1 Einführung
1.1 Was sind Flechten ? Den Vegetationskörper der Flechten nennt man
Thallus oder Lager. Nach der Wuchsform des Thal-
Flechten sind keine einheitlichen Organismen, lus unterscheidet man Krustenflechten, Blatt- oder
sondern bestehen jeweils aus zwei, mitunter auch Laubflechten und Strauchflechten. Strauchflech-
drei ganz verschiedenen Lebewesen und zwar aus ten besitzen strauchige bis bärtige Formen, Blatt-
einem Pilz sowie einer Alge bzw. einem Cyano- flechten lappige, mehr flächig entwickelte Thalli,
bakterium, die in engem Kontakt zusammenleben. Krustenflechten krustenähnliche, mit dem Sub-
Ihre Doppelnatur ist äußerlich nicht erkennbar. strat verwachsene Thalli, die nicht unverletzt ab-
Oft besitzt die Flechte mit keinem der beiden sie gelöst werden können. Gallertflechten sind in
aufbauenden Partner eine Ähnlichkeit. Über die trockenem Zustand spröde, in feuchtem aufge-
gestaltliche Eigenständigkeit hinaus ist die Flechte quollen und mehr oder weniger zäh-gallertartig.
durch zahlreiche spezifische Leistungen ausge- Die verschiedenen Wuchsformen sind im Lauf der
zeichnet. Diese sind nur durch „Zusammenarbeit“ Evolution wiederholt entstanden und treten daher
der Partner möglich. Manche Phänomene sind nur in unterschiedlichen Verwandtschaftsgruppen auf.
von dieser Organismengruppe bekannt. Andererseits können in einer Gattung Arten ver-
Eine solche, aufeinander abgestimmte Lebens- schiedenster Wuchsform vorkommen.
gemeinschaft zweier verschiedener Organismen
nennt man Symbiose. Man kennt Symbiosen von
verschiedensten Tier-, Pilz- und Pflanzengruppen, 1.2 Zur Ökologie der Flechten
doch selten ist die Symbiose so perfektioniert wor-
den wie bei den Flechten. Flechten sind weltweit verbreitet. Man schätzt ihre
Die Flechtensymbiose bringt den Partnern er- Artenzahl auf ca. 25.000. Flechten wachsen grund-
hebl iche Vorteile. Der Pilz (Mykobiont) erhält die sätzlich langsamer als Blütenpflanzen und sind
zu seiner Existenz notwendigen Kohlenhydrat e daher in der Regel auf Standorte beschränkt, an
vom sogenannten Photobionten, den zur Photo- denen die Konkurrenz der Blütenpflanzen einge-
synthese fähigen Algen bzw. Cyanobakterien. Die schränkt ist. Wir finden Flechten an Baumrinde
Cyanobakterien beliefern ihre Symbiosepartner und Holz, an Felsen, Mauern, Grabsteinen und
zudem mit Stickstoff, den sie aus der Luft fixieren. Dächern, auf dem Boden lichter Wälder, in Hei-
Der Photobiont ist in der Umhüllung durch das den, Trockenrasen und Mooren. Die meisten Arten
Pilzgeflecht vor raschem Wasserverlust, vor inten- leben unter recht spezifischen Standortbedingun-
siver Sonnenstrahlung oder vor leichtem Z ugriff gen. Kennt man diese Bedingungen, kann man
algenfressender Tiere geschützt. Mit Hilfe der Sym- gezielt nach den Arten suchen. Viele Flechtenarten
biose in der Flechte haben sowohl die beteiligten leben ausschließlich auf Rinde, andere auf Holz,
Pilze als auch die Algen und Cyanobakterien ihre weitere entweder auf Karbonatgestein (z. B. Kalk-
ökologischen Möglichkeiten erheblich erweitert stein, Dolomit) oder auf kalkfreiem Silikatgestein
und sind in der Lage, Standorte zu besiedeln, die (z. B. Granit, Gneis, Basalt), andere bewohnen den
sie allein nicht erfolgreich einnehmen könnten. Erdboden.
Die meisten epiphytischen, d. h. auf Baumrinde
lebenden Arten kommen nicht gleichermaßen auf
Die Strauchflechte Cetraria ericetorum unterscheidet
allen Baumarten vor, sondern zeigen eindeutige
sich vom bekannten „Isländisch Moos“ (C. islandica)
durch schmalere Lagerabschnitte. Sie kommt in Schwerpunkte. Eine Ursache dafür ist, dass die
Zwergstrauchheiden vor (2,1 cm breit). Rinde der verschiedenen Baumarten recht unter-