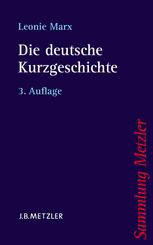Table Of ContentI
III
Leonie Marx
Die Deutsche Kurzgeschichte
3., aktualisierte und erweiterte Aufl age
Verlag J.B. Metzler Stuttgart · Weimar
IV
Die Autorin
Leonie Marx ist Professorin für Neuere deutsche Literatur und Skan-
dinavistik an der University of Kansas, USA. Buchpublikationen und
Aufsätze zur deutschen und dänischen Literatur und zum Thema der
deutsch-skandinavischen literarischen Beziehungen.
Bibliografi sche Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN-13: 978-3-476-13216-1
ISBN 978-3-476-05090-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-05090-8
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim-
mung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun-
gen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© 2005Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprünglich erschienen bei J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2005
www.metzlerverlag.de
[email protected]
V
Vorwort
Die deutsche Kurzgeschichte ist nicht ganz so jung, wie sie oft dar-
gestellt wird. Wie ihre Geschichte zeigt, ist die Aufnahme der ameri-
kanischen Short Story von ausschlaggebender Bedeutung, doch gilt
es, genau betrachtet, drei verschiedene Rezeptionsphasen zu unter-
scheiden.
Die vorliegende Einführung untersucht, welche Themen die Dis-
kussion um die Gattung im deutschen Sprachraum bestimmt und
welche Aspekte in ihrer theoretischen und historischen Entwicklung
Akzente gesetzt haben. Auf welche Weise sie das Profi l der Kurzge-
schichte geprägt haben, wird anhand der Schwerpunkte, Kontroversen
und bisweilen auch Polemiken dargestellt, die diese Gattung in den
verschiedenen Epochen durch gut ein Jahrhundert begleitet haben.
Dazu gehört auch die besondere Rolle der Schule für die Entwick-
lung der Kurzgeschichte nach 1945. Dem Anstieg der Gattung nach
1945 entsprechend konzentrieren sich die Beiträge zur neueren For-
schung auf diesen Zeitraum. Dennoch sind die frühen theoretischen
Ansätze innerhalb der Forschung zur Kurzgeschichte von Bedeutung,
denn sie belegen die intensive Auseinandersetzung mit der Gattung,
deren Schwerpunkte verschiedentlich noch in der Diskussion nach
1945 zu erkennen sind.
Vor dem Hintergrund der frühen Rezeption der Short Story um
1900, der erneuten in den 1920er Jahren und dem problematischen
Intermezzo während der NS-Zeit kommt dem Interesse an der Gat-
tung nach 1945 ein besonderer Stellenwert zu, da es nun mit einem
tief greifenden Erneuerungsanspruch einherging, der Sprache, Litera-
tur und Wertvorstellungen umfasste. In diesem Rahmen erwies sich
die Übernahme der Short Story aus Sicht von Autoren, Lesern und
Lehrern als zeitgemäß und ließ die Kurzgeschichte zur populärsten
Erzählgattung avancieren, bis sich nach zwanzig Jahren das Gleich-
gewicht unter den Gattungen verschob. Statt zu dominieren wurde
die Kurzgeschichte ein fester Bestandteil des literarischen Lebens.
In dieser Position bewährt sie sich auch in jüngster Zeit durch die
Bereitstellung neuer Foren, nicht zuletzt im neuen Medium Internet.
Die Darstellung der deutschen Kurzgeschichte führt in dieser drit-
ten, überarbeiteten und erweiterten Aufl age bis an die Gegenwart
heran. Hervorhebungen durch Fettdruck wurden ausschließlich für
diese Ausgabe vorgenommen und fi nden sich nicht im Originaltext
von verwendeten Zitaten.
Lawrence, Kansas im Dezember 2004
VI
Für P.
Den Mitarbeitern des Deutschen Literaturarchivs
in Marbach danke ich für die freundliche
Unterstützung bei der Materialbeschaffung.
Außerdem gilt mein Dank der University of
Kansas für einen einjährigen Forschungsurlaub.
VII
Inhaltsverzeichnis
1. Wort und Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Wortgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Begriffsentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 Die Ausgangssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Präzisierung und Polemik . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3 Ideologische Positionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.4 Neue Klärungsversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Bisherige Ergebnisse zur Theorie
der Kurzgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1 Entstehungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1 Tradition und Moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 Rezeption und Rückblick . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Frühe theoretische Vorbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 Das Echo auf Poes Poetik . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2 Die Verbindung zu Tschechow . . . . . . . . . . . . . 25
2.3 Defi nitionsansätze vor 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.1 Die Anfänge um 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.2 Theoretische Neuansätze zwischen 1918
und 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4 Theoriebildung seit 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.1 Erste Typologisierungsversuche:
Inhalt versus Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4.2 Kompositionsprinzipien und Strukturtypen . . . 40
2.4.3 Aufarbeitung vernachlässigter Aspekte . . . . . . . 47
2.5 Theoretische Schwerpunkte der Kurzgeschichten-
forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.5.1 Die Kürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.5.2 Stoff und Stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.5.3 Raum und Figuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.5.4 Der Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.5.5 Anfang und Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.5.6 Der Erzähler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.5.7 Zeit und Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
VIII Inhaltsverzeichnis
3. Das Verhältnis zu anderen Kurzprosa-
gattungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Historische Entwicklung der deutschen
Kurzgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.1 Modelle und Versuche: Die Kurzgeschichte um 1900 92
4.2 Kunst und Ware: Die Kurzgeschichte
in den zwanziger Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.3 Im Zerrspiegel der Ideologie: Die Kurzgeschichte
im Dritten Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4 Die konstitutive Phase der Nachkriegskurzgeschichte
(1945–1950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.4.1 Die Rezeption der Short Story . . . . . . . . . . . . 114
4.4.2 Aufstieg und Stellenwert der Kurzgeschichte . . 125
4.4.3 Themen und Formenvielfalt
der Kurzgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.5 Konsolidierung: Die Kurzgeschichte in den
fünfziger Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.5.1 Das Repertoire: Stoff, Stil, Struktur . . . . . . . . 139
4.5.2 Das Themenrepertoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.5.3 Literarischer Markt und Leser . . . . . . . . . . . . 144
4.5.4 Neue Autor/innen, Themen, Experimente . . . 148
4.6 Verschiebungen: Die Kurzgeschichte bis Ende
der siebziger Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.6.1 Abkehr und Umorientierung . . . . . . . . . . . . . 151
4.6.2 Konstanten und Wandlungsfähigkeit . . . . . . . . 154
4.6.3 Foren und Leserkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.7 Vom 20. ins 21. Jahrhundert: Die Kurzgeschichte
zwischen Wettbewerb und Internet . . . . . . . . . . . . . . 159
4.7.1 Erneuerungsinitiativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.7.2 Erweiterung der Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.7.3 Neue Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5. Die Kurzgeschichte im Schulunterricht . . . . . . . . . . 172
5.1 Theorie und Didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2 Kanon und literarische Öffentlichkeit . . . . . . . . . . . . 179
Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6. Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7. Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
1
1. Wort und Begriff
1.1 Wortgeschichte
Das Wort ›Kurzgeschichte‹ geht auf eine Lehnübersetzung aus dem
angloamerikanischen short story = ›kurze Geschichte‹ zurück, deckt
sich mit der englischen Bezeichnung aber nur teilweise, da short story
auch längere Erzählungen wie die Novelle umfasst.
Im Deutschen bleibt seit Anton E. Schönbachs Übersetzung des
englischen Ausdrucks (1886) zunächst ›kurze Geschichte‹ die ver-
breitete Benennung; sie wird synonym verwendet mit ›Novellette‹
und ›Skizze‹. Adolf Bartels’ Vorschlag (1897), short story mit ›kleine
Geschichte‹ oder ›Geschichte‹ zu übertragen, setzt sich nicht durch.
R.M. Meyer behält in seiner deutschen Literaturgeschichte des 19. Jh.s
noch den englischen Terminus neben der Übersetzung ›kurze Erzäh-
lung‹ bei (1900). Die zusammeng esetzte Form ›Kurzgeschichte‹ taucht
bereits um 1895 im Untertitel einer Sammlung von kurzen Geschich-
ten auf (Karl Pröll: Am Seelentelefon. Neue Kurzgeschichten); mögli-
cherweise entsteht sie um diese Zeit analog zu ähnlichen Wortzusam-
menziehungen, die dem neuen technischen Denken entsprechen und
meistens Eile, technische Vervollkommnung oder besondere Quali-
tätssteigerung ausdrücken (wie Kurzstunde, Kurzwelle, Kurzschrift,
Kurzrom an; vgl. Zierott 1952, 72). Danach erscheint die Wortbil-
dung ›Kurzgeschichte‹ 1904 in Karl Bienensteins Rezension einiger
Geschichtensammlungen, und zwar schon als der verbreitete »unaus-
stehliche, technische Ausdruck« (1344). In einem Nachschlagewerk,
Meyers Konversationslexikon, ist Kurzgeschichte erstmalig 1910 zu fi n-
den (Supplementband), doch nur als in Klammern gesetzte Übertra-
gung für das Stichwort short story.
Julius Wiegand nimmt ›Kurzgeschichte‹ 1922 als Übersetzung für
die Bezeichnung short story in seine literaturgeschichtliche Darstel lung
des Zeitraumes um 1900 (1885-1910) auf; zum Ende der 1920er
Jahre hin verbreitet sich die Wortbildung ›Kurzgeschichte‹ zusehends
in Ant hologien (vgl. M. Rockenbach 1926, H. Rinn/P. Alverdes 21936)
und in Sachartikeln (F. Langer 1929/30, H.M. Elster 1930, H.H. Bor-
cherdt 1930) wie auch in Literaturgeschichten (W. Mahrholz 1930, A.
Soergel 1934). Dabei fällt die Bedeutung, die man dem Wort jeweils
beimisst, noch genauso unterschiedlich aus wie um die Jahrhundert-
wende. Bedeutungsvariationen umfassen ›kurze Geschichte‹, oberfl äch-
2 Wort und Begriff
liche Zeitungs- oder Magazingeschichte, künstlerisch anspruchsvolle
Kurzprosagattung bis hin zur Gleichsetzung mit der Anek dote. Auch
die Aufnahme des Stichwortartikels »Kurzgeschichte« in den Gro-
ßen Brockhaus von 1931 ändert nichts an diesem Bedeutungspluralis-
mus; in den Zeitungen erfährt der Terminus weiterhin eine ziemlich
willkür liche Verwendung (H. v. Kraft 1942). Während des Dritten
Reiches mehren sich die Versuche, das Wort unter Ausschluss frem-
der Einfl üsse auf eine deutsche Tradition zurückzuführen. So schlägt
Hans-Adolf Ebing für die Zusammen ziehung ›Kurzgeschichte‹ eine
mögliche etymologische Entwicklung aus ›kurz‹ und ›Geschehen‹ und
deren adverbialer Zusammensetzung vor.
Erst nach 1945 – und zwar seit Klaus Doderers ausschlaggebender
Untersuchung (1953) – setzt sich das Wort ›Kurzgeschichte‹, verstan-
den als Lehnübersetzung aus dem angloamerikanischen short story
durch, nachdem es zunächst neben den rezipierten Bezeichnungen
story und short story verwendet wird. Als Ausdruck für eine eigen-
ständige künstlerische Erzählform, die der modernen Short Story
entspricht, fi ndet Kurzgeschichte ab 1958 Eingang in wissenschaft-
liche Nachschlagewerke.
1.2 Begriffsentwicklung
Mit Doderers Arbeit (1953) hat sich zunächst nicht nur die Ansicht
verbreitet, das Wort ›Kurzgeschichte‹ sei um 1920 als direkte Lehn-
übersetzung aus dem amerikanischen short story entstanden, son-
dern auch die Auffassung, der Begriff habe erst seit dieser Zeit, als
in Deutschland das Interesse an den Short Storys der jungamerika-
nischen Bewegung aufkam (so z.B. von O. Henry, Theodore Drei-
ser, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, William Faulkner, Ernest
Hemingway u.a.), eine Rolle in der literarischen Diskussion gespielt
(Doderer 1953, 9-10). Helga-Maleen Damrau (1967) widerlegt diese
Behauptung in ihrer Untersuchung zur Begriffsgeschichte und weist
nach, dass der Begriff ›short story‹ 1886 bereits von Schönbach
auf die Short Storys der amerikanischen Schriftstellergeneration um
1850 und später bezogen wird, desgleichen von R.M. Meyer (1900,
21913, 1913), der in diesem Zusammenhang 1913 auch schon den
Ausdruck ›Kurzgeschichte‹ benutzt.